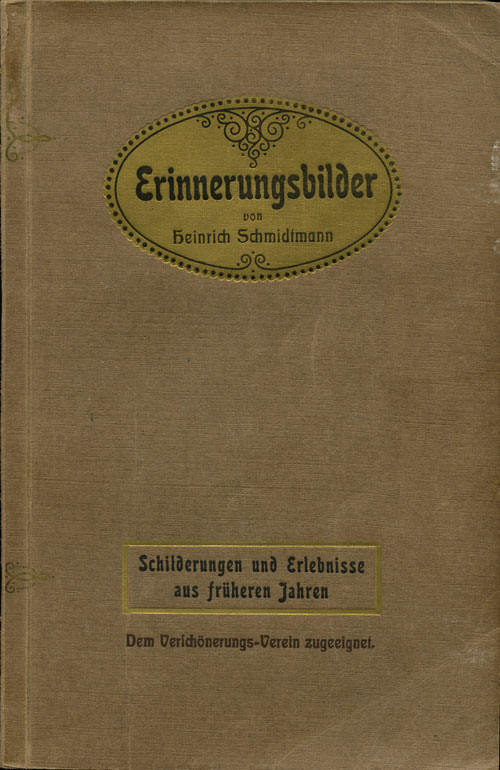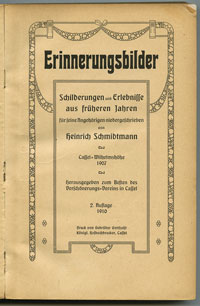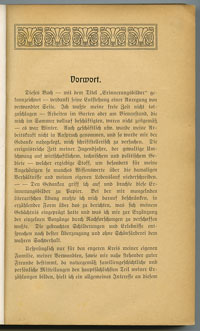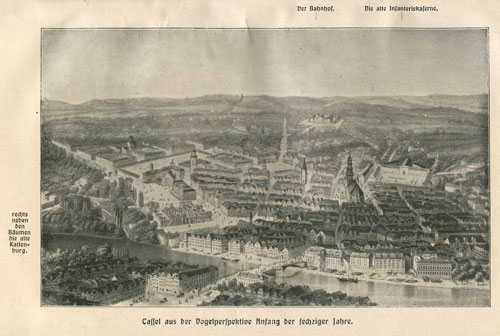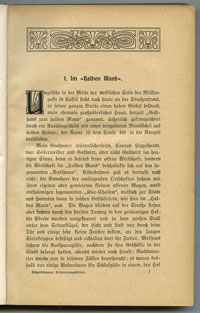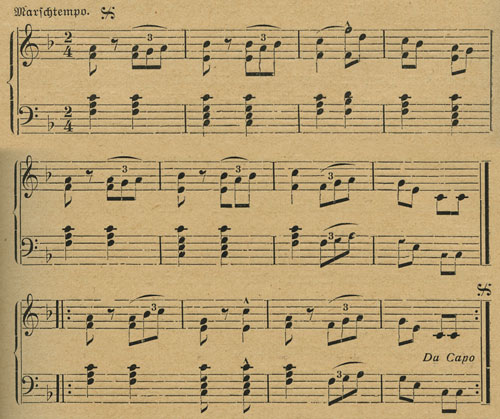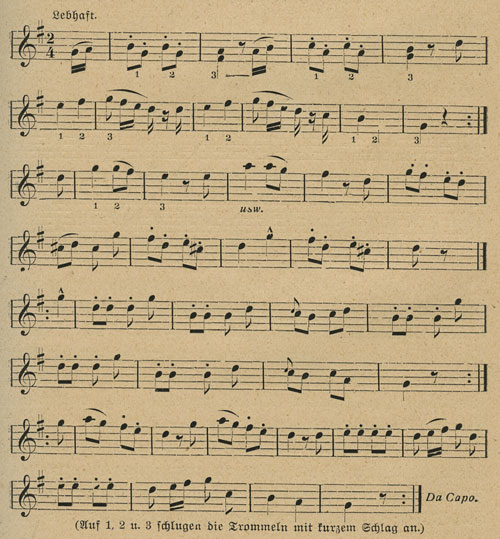- Startseite
- Villenkolonie Mulang
- Kurort Wilhelmshöhe
- Chinesisches Dorf
- Park Wilhelmshöhe
- Stadtteil Wilhelmshöhe
- Heidelbach: Geschichte der Wilhelmshöhe
- Heinrich Schmidtmann
- Persönlichkeiten
- Gustav Henkel
- Herkulesbahn
- Töchterheime
- Artillerie-Album
- Herkules-Bergrennen
Autor der Website:
Friedrich Forssman
Schloßteichstraße 3
34131 Kassel
mail@kassel-mulang.de
© für alle Bilder aus dem Schmidtmann-Album: Friedrich Forssman 2020 / Mulang-Archiv (»*MA«)
Hinweis: Wie bei den meisten Bildern aller Kapitel dieser Website öffnet sich beim Klicken auf ein Bild eine große Ansicht; je breiter das Browser-Fenster ist, desto größer die Ansicht. Beim Klicken auf diese große Ansicht erscheint das nächste Bild der Gruppe. – Das Symbol »(→)« zeigt an, daß sich beim Anklicken des Links ein neues Fenster öffnet.
Hier klicken (→) für den HNA-Bericht vom 9.6.2020 über den Kauf des Albums.
Hier klicken (→) für den HNA-Bericht vom 14.3.2024 über die Digitalisierung der »Erinnerungsbilder«.
Heinrich und Emma Schmidtmann:
Fotoalbum für
Fritz Schmidtmann
Im April 2020 konnte ich für mein privates Stadtteilarchiv, das »Mulang-Archiv«, ein Fotoalbum erwerben, das der Villenkolonie-Gründer Heinrich Schmidtmann (1842–1921) und seine zweite Frau Emma, geb. Buerdorf, für ihren gemeinsamen Sohn Fritz angelegt haben. Es ist auf das Jahr 1902 datiert und war wohl eine Abschiedsgabe beim Auszug des Sohnes (*16.10.1879) aus dem Elternhause. Die kleine Namensprägung rechts unten auf dem ledernen Einbanddeckel scheint dafür zu sprechen, daß auch andere der sechs Kinder solche Alben erhalten haben.
Das Album enthält 68 Fotos aus der Villenkolonie, darstellend die von der Familie Schmidtmann bewohnten Häuser Burgfeldstraße 8 sowie Wigandstraße 4 (beide erhalten), weitere Bilder der aufblühenden Kolonie sowie Schloßpark- und Familienfotos.
Das Schmidtmann-Album
• Das Album in Doppelseiten
• Scans aller Einzelfotos
* * *
Heinrich Schmidtmann:
Erinnerungsbilder
Heinrich Schmidtmanns Autobiographie »Erinnerungsbilder« gehört laut Karl-Hermann Wegner, dem Gründer und ersten Direktor des Kasseler Stadtmuseums, »zu den anschaulichsten und liebenswertesten Quellen für die Geschichte des 19. Jahrhunderts in Kassel«. Ich habe das Werk für diese Website vollständig digitalisiert und durfte Karl-Hermann Wegners vortreffliche Einführung voranstellen, die er für die Ausgabe von 1993 verfaßt hat.
Heinrich Schmidtmann: »Erinnerungsbilder«
• Einführung von Karl-Hermann Wegner (1993)
• »Erinnerungsbilder«: vollständiger Text (1910)
• Innentitel
• Vorwort
• Ausführliches Inhaltsverzeichnis
• Textbeginn
* * *
Zur Familie Schmidtmann:
• Wolfgang Hermsdorff: »Erleben in Erinnerungsbildern« (1971)
• Das Schmidtmann-Grab auf dem Kasseler Hauptfriedhof
• Über Nachkommen Heinrich Schmidtmanns
Das Album in Doppelseiten
Nach den Doppelseiten folgen alle einzelnen Bilder in hoher Auflösung, kontrastverstärkt sowie teils retuschiert und gedreht.



4 Links: Die Schmidtmann-Villa Burgfeldstraße 8, aufgenommen aus der Burgfeldstraße 9. Rechts hinter der Burgfeldstraße 8 ein Stall, heute steht dort das von Schmidtmann erbaute Haus Schloßteichstraße 5.
Rechts: Die Villa im Winter.
Hier klicken, um zu den Einzelfoto-Scans dieser Doppelseite zu springen.

5 Links: Der Schloßteich (der »Lac«)
Rechts: Blick auf den Abfluß des Lac von der Einmündung der Mulangstraße in die Wigandstraße. Die Brücke ist heute steingesäumt, den Weg links am Wasserlauf gibt es nicht mehr.
Hier klicken, um zu den Einzelfoto-Scans dieser Doppelseite zu springen.

6 Links: Blick von der Wilhelmshöher Allee den Lac-Abfluß hinauf.
Rechts oben: Der Lac.
Rechts unten: Blick von der Verlängerung der Wilhelmshöher Allee zum Schloß; von hier an wurde die Straße seinerzeit »Kaiserweg« genannt. Vor dem Schilderhäuschen wohl ein Schmidtmann-Sohn.
Hier klicken, um zu den Einzelfoto-Scans dieser Doppelseite zu springen.

7 Der Garten der Burgfeldstraße 8.
Rechts unten: Burgfeldstraße 8, links die Schloßteichstraße 7 (abgerissen 1970), rechts die Burgfeldstraße 6 im Bau (erhalten).
Hier klicken, um zu den Einzelfoto-Scans dieser Doppelseite zu springen.

Hier klicken, um zu den Einzelfoto-Scans dieser Doppelseite zu springen.

9 Links: Die Familie beim Haus Burgfeldstraße 8.
Rechts: Interieur-Aufnahme aus der Schmidtmann-Villa, Burgfeldstraße 8.
Hier klicken, um zu den Einzelfoto-Scans dieser Doppelseite zu springen.

10 Links oben: Großfamilie Schmidtmann.
Links unten: Das Ehepaar Schmidtmann vor dem Haus Burgfeldstraße 8.
Rechts oben: Emma und Heinrich Schmidtmann mit drei Söhnen und einer Schwiegertochter:
Rechts unten: Ilse Schmidtmann, geb. Wolff, Ehefrau von Sohn Christel.
Hier klicken, um zu den Einzelfoto-Scans dieser Doppelseite zu springen.

11 Links unten: Der Bauplatz der Villa Mummy, Kurhausstraße 13; rechts im Bild die Villa Henkel, Kurhausstraße 7. Hier klicken für einen Bildausschnitt mit Straßennamen und Hausnummern.
Rechts oben: Blick aus der Burgfeldstraße 8 nach Nordwesten: links die Schloßteichstraße 5, dann Schloßteichstraße 3 und Schloßteichstraße 1.
Rechts unten: Blick aus der Burgfeldstraße 8 nach Westen: Schloßteichstraße 7, dahinter Lindenstraße 2. Mitte hinten: Villa Henkel.
Hier klicken, um zu den Einzelfoto-Scans dieser Doppelseite zu springen.

12 Links oben: Blick aus der Burgfeldstraße 8 nach Osten. Vorn rechts die Burgfeldstraße 5 (dahinter die Wigandstraße 4), vorn links die Burgfeldstraße 7. Mittelgrund: Das Pensionshaus Wilhelmshöhe, Wigandstraße 5.
Links unten: Die Villa Mummy ist fertig.
Rechts: Die Burgfeldstraße 6. Links die Burgfeldstraße 8, rechts die Schloßteichstraße 3.
Hier klicken, um zu den Einzelfoto-Scans dieser Doppelseite zu springen.

Hier klicken, um zu den Einzelfoto-Scans dieser Doppelseite zu springen.

14 Familienbilder.
Rechts unten: Die Schloßteichstraße 10 von Süden, von der Brabanter Straße her aufgenommen.
Hier klicken, um zu den Einzelfoto-Scans dieser Doppelseite zu springen.

15 Links: Familienbilder.
Rechts: Auf der Kanone steht »Abschied | C. – 1896/7 | der Einj.-Freiwilligen | 3. reitende Batterie«. Das Bild wurde vor dem Hotel »Ridinger Schloß« aufgenommen, Löwenburgstraße 3.
Hier klicken, um zu den Einzelfoto-Scans dieser Doppelseite zu springen.

16 Links oben: Blick aus dem Schmidtmannschen Sommerhaus, Wigandstraße 4, nach Süden. Rechts hinten die Kuranstalt Dr. Greger, Burgfeldstraße 17.
Links unten: Wigandstraße 4 von Süden.
Rechts oben: Wigandstraße 4, Ostseite, also Straßenseite.
Rechts unten: Familienbild.
Hier klicken, um zu den Einzelfoto-Scans dieser Doppelseite zu springen.

Hier klicken, um zu den Einzelfoto-Scans dieser Doppelseite zu springen.

Hier klicken, um zu den Einzelfoto-Scans dieser Doppelseite zu springen.

Hier klicken, um zu den Einzelfoto-Scans dieser Doppelseite zu springen.

20 Links: Familienbilder, im Garten und gewiß im Inneren der Wigandstraße 4.
Rechts: Die Wigandstraße 4 von Westen, links ein »Pensionshaus Wilhelmshöhe«-Nebengebäude.
Hier klicken, um zu den Einzelfoto-Scans dieser Doppelseite zu springen.

21 Der Garten der Wigandstraße 4.
Links unten: Der Garten der Burgfeldstraße 8.
Hier klicken, um zu den Einzelfoto-Scans dieser Doppelseite zu springen.

Hier klicken, um zu den Einzelfoto-Scans dieser Doppelseite zu springen.




Die Fotos in der Reihenfolge des Albums.
Auch hier gilt: Beim Klicken auf ein Bild öffnet sich eine große Ansicht. Beim Klicken auf diese große Ansicht erscheint das nächste Bild; so lassen sich die 68 Einzelbilder durchblättern.
Doppelseite 4 (Nach oben zum Seitenkopf)
4.1 Die Schmidtmann-Villa Burgfeldstraße 8, aufgenommen nach Westen aus der Burgfeldstraße 9. Rechts hinter der Burgfeldstraße 8 ein Stall, heute steht dort das von Schmidtmann erbaute Haus Schloßteichstraße 5. Ganz rechts eine Ecke der Burgfeldstraße 6, dahinter der Turm der Schloßteichstraße 3. Auf der Eingangstreppe Heinrich Schmidtmann, am Erdgeschoßfenster seine zweite Frau Emma, geb. Buerdorf aus Hannover.
4.2 Die Schmidtmann-Villa im Winter. Schmidtmanns und ein Freund auf dem Balkon.
Doppelseite 5 (Nach oben zum Seitenkopf)
5.1 Der »Lac« im Winter.
5.2 Blick auf den Abfluß des Lac von der Einmündung der Mulangstraße in die Wigandstraße. Die Brücke ist heute steingesäumt, den Weg links am Wasserlauf gibt es nicht mehr. Die Mulangstraße wiederum ist heute breiter, asphaltiert und dient als Parkplatz für die Ayurveda-Klinik; der Park ist durch eine Hecke abgetrennt, der Wasserfall dadurch kaum sichtbar.
Doppelseite 6 (Nach oben zum Seitenkopf)
6.1 Blick von der Wilhelmshöher Allee den Lac-Abfluß hinauf. In der Mitte ein Schmidtmann-Sohn?
6.2 Der Lac. Ein Schmidtmann-Sohn am Ufer rechts?
6.3 Blick von der Verlängerung der Wilhelmshöher Allee zum Schloß; von hier an wurde die Straße seinerzeit »Kaiserweg« genannt. Vor dem Schilderhäuschen wohl ein Schmidtmann-Sohn.
Doppelseite 7 (Nach oben zum Seitenkopf)
7.1 Die Eingangstreppe zur Burgfeldstraße 8. Vor dem unteren Eingang Emma Schmidtmann mit zwei Enkelkindern. Oben auf dem Treppenabsatz Heinrich Schmidtmann.
7.2 Burgfeldstraße 8: Der hintere Garten mit einer Apollo-Statue.
7.3 Burgfeldstraße 8: Vordergarten mit Venus (links) und Emma Schmidtmann (rechts).
7.4 Burgfeldstraße 8, links die Schloßteichstraße 7 (abgerissen 1970), rechts die Burgfeldstraße 6 im Bau (erhalten). Die Fenster sind noch leer, die seitliche Terrasse wird errichtet. Ganz im Hintergrund: Siebertweg 1.
Doppelseite 8 (Nach oben zum Seitenkopf)
8.1–8.4 Innenaufnahmen aus dem Hause Burgfeldstraße 8.
Doppelseite 9 (Nach oben zum Seitenkopf)
9.1 Die Familie vor dem Haus Burgfeldstraße 8. Im Hintergrund der Giebel des Hauses Burgfeldstraße 9.
»Ganz links: Christian mit seiner Frau, meine Großeltern.« (H.v.H.)
9.2 Die Schmidtmann-Kinder; v. l. n. r.:
Aus erster Ehe mit Sophie, geb. Buerdorf (23.2.1850–9.12.1875): Emilie (*8.1.1870); Franziska (»Fränzchen«, *8.3.1871 / ∞ 7.5.1892 Alexander Potente, Architekt, *8.4.1862 in Kassel, †9.9.1948, zwei Kinder, darunter Erich Heinrich Georg Friedrich Potente); Hermann (*20.11.1875; »Von Bruder Hermann wurde erzählt, er sei zur See gefahren und sehr früh gestorben.«, H.v.H.); Christian, genannt »Christel« (2.3.1872–23.10.1955), Großvater von H.v.H.
Aus zweiter Ehe mit Emma, geb. Buerdorf (25.11.1848–22.12.1933), Schwester der ersten Frau: Karl (*4.3.1878), Fritz (*16.10.1879).
9.3 Ein Interieur-Foto mit Besitztümer-Arrangement.
Doppelseite 10 (Nach oben zum Seitenkopf)
10.1 Großfamilie Schmidtmann.
10.2 Das Ehepaar Schmidtmann senior vor dem Haus Burgfeldstraße 8.
10.3 Schmidtmanns mit dreien der vier Söhne und einer Schwiegertochter: Fritz (*16.10.1879); Christian (2.3.1872–23.10.1955) mit seiner Frau Ilse, geborene Wolff (19.4.1882–7.7.1966), aus Potsdam; Hermann (*20.11.1875).
10.4 Christian Schmidtmanns Frau Ilse Wolff, »meine Großmutter, wohl am selben Tag wie das vorhergehende Bild aufgenommen, weil sie das selbe Kleid trägt.« (H.v.H.)
Doppelseite 11 (Nach oben zum Seitenkopf)
11.1 Hund Schmidtmann.
11.2 Der Bauplatz der Villa Mummy, Kurhausstraße 13 (abgerissen 1970). rechts im Bild die Villa Henkel, Kurhausstraße 7 (erhalten). Ganz links der spitze Turm: Steinhöferstraße 11 (teilerhalten). Hier klicken für einen Bildausschnitt mit Straßennamen und Hausnummern.
11.3 Blick aus der Burgfeldstraße 8 nach Nordwesten zur Schloßteichstaße: links der Stall auf dem Grundstück Schloßteichstraße 5 (der Nachfolge-Bau, ein prächtiges Haus von Heinrich Schmidtmann, ist erhalten), dann die Schloßteichstraße 3 (erheblich ausgebaut erhalten), in der Bildmitte die Schloßteichstraße 1 (erheblich ausgebaut erhalten). Rechts ein Giebelstück vom Schmidtmann-Bau Burgfeldstraße 4 (erhalten). Zwischen den Häusern ist der Schloßteich zu erspähen.
11.4 Blick aus der Burgfeldstraße 8 nach Westen: links die Schloßteichstraße 7 (abgerissen 1970), dahinter die Lindenstraße 2 (abgerissen um 1970). Mitte hinten, mit den auffälligen Balkonen: die Villa Henkel, Kurhausstraße 7 (erhalten).
Doppelseite 12 (Nach oben zum Seitenkopf)
12.1 Blick aus der Burgfeldstraße 8 nach Osten. Vorne links Burgfeldstraße 5, rechts Burgfeldstraße 7, ganz rechts Burgfeldstraße 9 (alle erhalten). Bildmitte: Das Luxus-Hotel »Pensionshaus Wilhelmshöhe«, Wigandstraße 5; links davon die Grevelersche Heilanstalt, Wigandstraße 1–3 (erhalten). Hinter der Burgfeldstraße 7 das Schmidtmann-Sommerhaus Wigandstraße 4 mit dem Pavillon an der Straße. – Die Dächer in der rechten Bildmitte sind die der Domänengebäude. Im Hintergrund der Turm der Kirchditmolder Kirche.
12.2 Die Villa Mummy ist fertig, der Garten wir angelegt. Das prächtige Haus wurde in den 1930er Jahren Kurhaus, in den 1950ern erneut. Es wurde 1970 barbarisch abgerissen. – Ganz rechts im Wald die Kurhausstraße 1, ein Haus, das schon vor der Villenkolonie-Gründung stand und Schmidtmanns Vetter und Freund Louis Hochapfel gehörte.
12.3 Der Schmidtmann-Bau Burgfeldstraße 6 (erhalten). Ganz links die Burgfeldstraße 8, rechts die Schloßteichstraße 3 (erhalten). Links über den Bäumen das Dach der Lindenstraße 2 (abgerissen 1970).
Doppelseite 13 (Nach oben zum Seitenkopf)
13.1 Heinrich und Emma Schmidtmann mit zwei Enkelchen.
13.2 Heinrich Schmidtmann (rechts) mit Gemahlin, mit dem jüngsten Sohn Fritz – und links einem (noch) unbekannten Herrn.
13.3 Die jüngere Tochter Franziska Schmidtmann (*8.3.1871) mit einem Kinde.
13.4 Heinrich Schmidtmann und seine vier Söhne (v.l.:) Karl (*4.3.1878), Fritz (*16.10.1879), Hermann (*20.11.1875); rechts vom Vater sitzend: Christian (»Christel«, *2.3.1872). Aufnahme im Garten der Burgfeldstraße 8, links im Hintergrund der Schmidtmann-Bau Burgfeldstraße 7.
Doppelseite 14 (Nach oben zum Seitenkopf)
14.1 Mit Familie und Freunden. »Vorne links meine Großeltern« (H.v.H.), also Christel mit seiner Frau Ilse, geb. Wolff, aus Potsdam.
14.2 Das Ehepaar Schmidtmann mit Tochter Franziska, Schwiegersohn (?) und Enkelchen.
14.3 Da oben ist was. Ein Waschbär kann es nicht gewesen sein, von denen kamen die ersten beiden Paare am 12. April 1934 nach Nordhessen.
14.4 Der Schmidtmann-Bau Schloßteichstraße 10 von Süden, von der Brabanter Straße her aufgenommen, ca. 1895. Auf dem Balkon gewiß Georg Schwartzkopff.
Doppelseite 15 (Nach oben zum Seitenkopf)
15.1 Stehend, rechts: Sohn Karl; sitzend, ganz rechts: Sohn Christel. Sowie weitere Leute. (Links, sitzend, Tochter Franziska?)
15.2 Links stehend: Tochter Franziska (?) – und weitere Leute.
15.3 Auf der Kanone steht »Abschied | C. – 1896/7 | der Einj.-Freiwilligen | 3. reitende Batterie«. Auf dem Schaukelpferd Sohn Christel. – Das Bild wurde vor dem Hotel »Ridinger Schloß« aufgenommen, Löwenburgstraße 3. Zum Ridinger Schloß und der Flaschen-»Kanone« siehe auch das »Artillerie-Album« auf dieser Website.
Doppelseite 16 (Nach oben zum Seitenkopf)
16.1 Blick aus dem Schmidtmannschen Sommerhaus, Wigandstraße 4, nach Süden. Rechts hinten die Kuranstalt Dr. Greger, Burgfeldstraße 17, dahinter die Burgfeldstraße 19.
16.2 Das Haus Wigandstraße 4 von Süden nach der Aufstockung; die Wigandstraße verläuft rechts.
16.3 Wigandstraße 4, Ostseite, von der Straße aus.
16.4 Ehepaar Schmidtmann mit Freunden oder Verwandten. – Ganz rechts Sohn Christel – stehend vielleicht Fritz?
Doppelseite 17 (Nach oben zum Seitenkopf)
17.1 Wigandstraße 4: das Bienenhaus.
17.2 Tochter Emilie mit ihrem Mann (?).
17.3 Der Pavillon an der Wigandstraße.
17.4 Schmidtmanns und Kinder. (Wer besser im Zuordnen ist als ich, darf sich gern melden.)
Doppelseite 18 (Nach oben zum Seitenkopf)
18.1 Eine junge Frau – die Braut von Fritz? – im Garten der Wigandstraße 4.
18.2 Heinrich Schmidtmann mit der jüngeren Tochter Franziska – und vielleicht seiner Schwiegermutter. Seine Mutter und seine ebenso innig geliebte Stiefmutter waren bereits verstorben.
18.3 Die Familie.
18.4 Gartenidyll.
18.5 Die ältere Tochter, Emilie.
Doppelseite 19 (Nach oben zum Seitenkopf)
19.1 Die jüngere Tochter, Franziska.
19.2 Ein Garten – welcher? Hinten wohl der Habichtswald. Vielleicht das Grundstück der Wiederhold’schen Kuranstalt an der heutigen Hugo-Preuß-Straße?
19.3 Freundinnen im Garten der Burgfeldstraße 8.
19.4 Tochter Franziska mit einem Verehrer oder ihrem Mann Alexander Potente.
Doppelseite 20 (Nach oben zum Seitenkopf)
20.1 Stehend, v. l.: Fritz, ?, »dritter von links: mein Großvater Christel im hellen Anzug. Die geknöpfte Weste spannt etwas über den Bauch; von den vier Söhnen war er der beleibteste« (H.v.H.), ?, ?, ?. – Sitzend, v. l.: Franziska, Heinrich und Emma Schmidtmann, Emilie (?).
20.2 Familienbild, wohl im Inneren des Hauses Wigandstraße 4.
20.3 Die Wigandstraße 4 vor der Aufstockung, aufgenommen von Nordwesten mit Blick zur Stadt. Links ein Nebengebäude des Pensionshauses Wilhelmshöhe.
Doppelseite 21 (Nach oben zum Seitenkopf)
21.1 Wigandstraße 4 vor der Aufstockung, von Süden.
21.2 Im Garten der Burgfeldstraße 8.
21.3 Wigandstraße 4: Der Pavillon. Das Haus ist noch nicht aufgestockt.
21.4 Im Garten der Wigandstraße 4. Oben von links die Häuser Burgfeldstraße 9 und Burgfeldstraße 7.
Doppelseite 22 (Nach oben zum Seitenkopf)
22.1 Franziska Schmidtmann mit Mann und Kindern. Das Bild ist mit Bleistift bekritzelt.
22.2 Wigandstraße 4 vor der Aufstockung, aufgenommen von Süden.
22.3 Im Garten der Wigandstraße 4, Blick nach Süden. Rechts das »Pensionshaus Wilhelmshöhe«.
22.4 Wigandstraße 4 nach der Aufstockung, Blick von Norden.
»Erinnerungsbilder«: Die Autobiographie von Heinrich Schmidtmann
• Einführung von Karl-Hermann Wegner (1993)
• »Erinnerungsbilder«, Einbandvorderseite
• Innentitel
• Vorwort
• Ausführliches Inhaltsverzeichnis
• Textbeginn
Das Buch war 1907 in kleiner Auflage erschienen (wer hat ein Exemplar? Bitte melden). Das Bild zeigt zwei Exemplare der zweiten Auflage von 1910 (Einband und Innentitel) sowie den Einband der gekürzten Ausgabe von 1993, »Erinnerungsbilder. Heinrich Schmidtmann (1842–1921). Bauhandwerker und Unternehmer in Kassel. Bearbeitet von Karl-Hermann Wegner«.
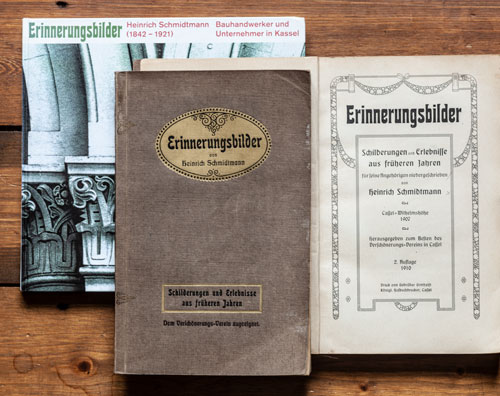
Hier klicken (→), um zu einem Foto der Schmidtmann-Villa an der »Terrasse« zu kommen, wo die Schmidtmanns vor dem Umzug nach Mulang wohnten. (Universitäts-Bibliothek Kassel)
* * *
Das Hessische Staatsarchiv Marburg bietet Digitalisate zweier Zeichnungen von Heinrich Schmidtmann zum Depotgebäude der Kasseler Pferdebahn, jeweils von 1886.: Aufrisse und Schnitt (→) sowie Grundriß (→).
* * *
Bei der Erbauung des Hauptbahnhofs (1851–1856) wirkte Schmidtmann als Lehrling mit: »Im zweiten Sommer wurden mir schon bessere und größere Arbeiten anvertraut, u.a. Sandsteinarchitektur-Arbeiten für das neue Bahnhofsgebäude, die zu meiner Genugtuung jedesmal für gut oder wenigstens für tauglich befunden und mir abgenommen wurden.«

Der Hauptbahnhof. Architekt: Gottlob Engelhard.*MA

Abfahrt von Cassel: »Winter-Fahrplan 1900.«*MA
* * *

Heinrich Schmidtmann hat – mit seinen Freunden Friedrich Potente und August Zahn – die Bau-Ausführung der Neuen Galerie besorgt. Postkarte des fertigen Baus, 1902 gestempelt.*MA – Beim Wikipedia-Artikel zur Neuen Galerie (→) findet sich ein Foto des Bau-Gerüstes. Bei einem Gerüst-Einsturz kamen Arbeiter ums Leben; Schmidtmann (der vor Gericht freigesprochen wurde) schildert in den »Erinnerungsbildern« freimütig, wie ihn dieser Vorgang in eine lange, tiefe Depression stürzte.
Einführung zur »Erinnerungsbilder«-Ausgabe von 1993 von Karl-Hermann Wegner, Gründer und erster Direktor des Stadtmuseums Kassel
Die »Erinnerungsbilder« von Heinrich Schmidtmann gehören zu den anschaulichsten und liebenswertesten Quellen für die Geschichte des 19. Jahrhunderts in Kassel. Sie schildern Begebenheiten und Verhältnisse einer längst vergangenen Zeit so menschlich und lebensnah, daß sie auch den Leser ansprechen, der an der Fülle lokalgeschichtlicher Informationen nicht interessiert ist. Überall spricht uns der Erzähler selbst an, so daß er uns in seinem Werk so begegnet, wie es der Nachruf einer Kasseler Zeitung bei seinem Tode 1921 schrieb: »Eine hingebende, offene und gesellige Natur, dabei schaffensfreudig und für alle Schönheiten in Kunst und Natur empfänglich, für den Nächsten und die Allgemeinheit besorgt, ohne nach Anerkennung und nach Ämtern zu streben – das war Heinrich Schmidtmann!« [...]
Für manche der bisher [in der Reihe »Kassel trifft sich – Kassel erinnert sich«, die im hier ausgelassenen Textteil vorgestellt wird] gewürdigten Persönlichkeiten war die kurhessische Haupt- und Residenzstadt nur das Forum ihres Schaffens, von dem sie angezogen wurden, von dem aus sie weit über die Stadt hinaus wirkten. Oft wurde Kassel dadurch verändert, aber häufig verließen die berühmten Bürger die Stadt sehr bald wieder und wandten sich anderen geistigen Zentren zu. Mit Heinrich Schmidtmann begegnet uns das alte Kassel selbst. Er stammte aus alter einheimischer Handwerkertradition und blieb dieser ebenso wie der Heimatstadt Kassel das ganze Leben lang innerlich verbunden.
Heinrich Schmidtmann wurde am 22. Februar 1842 in Kassel als Sohn des Lackierers Georg Ludwig (Louis) Schmidtmann geboren. Seine frühe Kindheit verlebte er im Hause seines Großvaters, des Seilermeisters Conrad Engelhardt, der in der nördlichen Altstadt (Müllergasse 21) das Gasthaus »Zum halben Mond« betrieb. Bei dem Maurer und Steinmetz Georg Löser schloß Schmidtmann seine Steinhauerlehre ab. Er besuchte die Bauhandwerkerschule in Kassel ebenso wie Kurse der kurfürstlichen Kunstakademie. Wegen der wirtschaftlichen Not der Familie konnte er die Ausbildung auf der Baugewerkschule in Holzminden nicht in gewünschter Weise fortsetzen, sondern mußte sich mit einem Semester begnügen (Wintersemester 1859/60). Als Geselle kam Schmidtmann 1860 nach Hannover, arbeitete dort zunächst als Steinhauer am »Welfenschloß«, dann als Bauführer an verschiedenen kommunalen Vorhaben und schließlich selbständig für private Auftraggeber.
Entscheidend war hier das Erleben einer wirtschaftlich blühenden und aufstrebenden Stadt, die sich mit ihrem freieren wirtschaftlichen Leben so auffällig von Kassel vor 1866 abhob. Unterschiedlich waren nun auch die Reaktionen der beiden Städte auf das gemeinsame Schicksal der preußischen Annexion von 1866. ln Hannover kam das Wirtschaftsleben zum Erliegen, Bauvorhaben wurden eingestellt und die Zukunft der einstigen Königsresidenz erschien ungewiß. ln Kassel beflügelten die »neuen Verhältnisse« das wirtschaftliche und geistige Leben der Stadt. So kehrte Heinrich Schmidtmann 1866 nach Kassel zurück, die Gewerbefreiheit (seit 1867) ersparte ihm auch den Aufwand der bisher notwendigen Meisterprüfung, so daß er nun eine einzigartige unternehmerische Aktivität entfalten konnte.
Schmidtmann nahm teil an der architektonischen Neugestaltung der Stadt, aber auch an ihrem gesellschaftlichen Leben. Mit einer eigenen Bauunternehmung, die bei den Großbauten der neuen Herrschaft wie der Gemäldegalerie (1871–1877) oder dem Regierungsgebäude (1876–1882) gemeinsam mit den Verwandten Zahn und Potente auftrat, prägte er das Stadtbild. Mit Privatbauten, insbesondere im neuen »Hohenzollernviertel« (Vorderer Westen) und in der Villenkolonie Wilhelmshöhe trieb er die Ausdehnung Kassels und seine Entwicklung zur Großstadt tatkräftig voran. Hier verwirklichte er auch eigene Entwürfe als Architekt. Er griff sogar mit eigenen Plänen in die Diskussion der großen Bauaufgaben Kassels um 1900 ein, wie seine Zeichnungen für eine Stadthalle im Fürstengarten am Standort des späteren Landesmuseums zeigen.
Schon in Hannover hatte Heinrich Schmidtmann das Leben in den bürgerlichen Vereinen und in der Loge kennengelernt Der persönliche Austausch dort hatte ihm seine Arbeit und sein Fortkommen wesentlich erleichtert. So trat er auf diesem Gebiet auch in Kassel als nimmermüder Anreger und Initiator auf: 1879 betrieb er die Gründung (23. Januar) des »Kasseler Verkehrsvereins«, den er als 1. Vorsitzender lange Jahre leitete, und er engagierte sich besonders im bereits am 2. November 1866 gegründeten »Verschönerungsverein«, dem er auch die zweite Auflage seiner »Erinnerungsbilder« widmete.
Ebenso setzte sich Schmidtmann ein für die Organisation des Handwerks, die Hebung seiner Ausbildung und seiner Stellung in der sich nun ausbildenden Industriegesellschaft Die alte kurhessische Höhere Gewerbeschule in Kassel (gegr. 1832) war nach 1866 zur »Gewerblichen Zeichenschule« abgesunken. lm Jahr 1888 erhielt »Herr Maurermeister Schmidtmann in seiner Eigenschaft als Mitglied der ›Wirtschaftlichen Konferenz‹ den Auftrag, beim Regierungspräsidenten dahin zu wirken, daß an der gewerblichen Zeichenschule ein Fachkurs für das Baugewerbe« eingerichtet würde. Dieser Fachkurs ist die Grundlage der späteren staatlichen Baugewerkschule, die dann als Ingenieurschule Teil der Gesamthochschule Kassel wurde. Die »Wirtschaftliche Konferenz« war Vorläufer und Ersatz für die noch nicht bestehende Gewerbe- bzw. Handwerkskammer. Am 28. April 1921 starb Heinrich Schmidtmann in Kassel.
Heinrich Schmidtmann war kein Schriftsteller, sondern er folgte dem Drängen von Freunden und Verwandten, sein Erleben in und mit Kassel zu Papier zu bringen. Seine »Erinnerungsbilder – Schilderungen und Erlebnisse aus früheren Jahren« waren nur für einen kleinen Kreis Vertrauter gedacht. Als sich weiteres Interesse zeigte, erschien 1907 eine kleine Auflage und wegen des großen Erfolges 1910 eine zweite, der die vorliegende Ausgabe folgt. Schmidtmann war von dem großen Wandel, der sich innerhalb seines eigenen Lebens vollzogen hatte, selbst fasziniert. Dies bleibt ein Grundthema seines Werkes. Er schrieb 1910: »Mögen meine Schilderungen dem Leser so recht vor Augen führen, wie anspruchslos und bescheiden die früheren Verhältnisse waren im Vergleich zu den heutigen – möge dieser Vergleich auf der anderen Seite aber auch dartun, was aus Cassel seit dem Beginn des von mir geschilderten Zeitabschnittes geworden ist ...« Schon zum Zeitpunkt des ersten Druckes 1907 erschien dem Leser im damals modernen, reichen Kassel, der jungen Großstadt mit über 100.000 Einwohnern, das von Schmidtmann gezeichnete Leben seiner Jugend wie das Bild aus einer versunkenen Kleinstadtidylle. Auch heute noch fasziniert der Wandel von der Postkutschenzeit zum technischen Fortschritt des beginnenden 20. Jahrhunderts. Hinzu kommt jetzt ein zweiter Sprung noch größerer Veränderung in den zurückliegenden 80 Jahren. Denn das Kassel, das Schmidtmann bei seinem Leser als erlebt und gegenwärtig voraussetzt, ist durch die Zerstörung 1943 und den Wiederaufbau endgültig untergegangen.
Der besondere Reiz der Schilderung Schmidtmanns liegt darin, daß er selbst aktiv zur Entwicklung beitrug: Er beschreibt den alten Posthof mit Kutschen und Stallbetrieb am Königsplatz, den Einbruch des Eisenbahnwesens mit dem Bau des Bahnhofes, die große Industrieausstellung in Kassel (1870) und die Reaktion der Kasseler Bürger auf die »neue Zeit«, die er so engagiert mitgestaltete. Immer erinnert er sich an seine Herkunft aus dem handwerklichen Milieu, an die harte Arbeit seiner Eitern, an die engen nachbarschaftlichen und verwandtschaftlichen Bindungen. Die reinlich bescheidene Biedermeierstube seiner Kindheit bleibt der Maßstab, als er mit vollem Bewußtsein aus diesen vorindustriellen Lebensverhältnissen heraustritt. Mit viel Liebe schildert er diese Weit, doch er verschweigt die wirtschaftliche Not, die unerfreulichen politischen Verhältnisse und die Härte des Daseinkampfes keineswegs. Das Gegenüber von »alter« und »neuer Zeit« wird in seiner Auseinandersetzung mit dem eigenen Vater exemplarisch dargestellt.
Der Fleiß, die Disziplin und die wagende Tatkraft von Schmidtmann und seiner Generation nötigen uns heute Bewunderung ab. Es ist die Generation, die Deutschland aus einer uns heute kaum vorstellbaren Armut – er schildert sie gerade für Kassel und die eigene Familie – zum Reichtum einer Industrienation führte.
Schmidtmanns Biographie ist beispielhaft für die Entwicklung der Gesellschaft während der industriellen Revolution in Deutschland, die er selbst als Aufstieg aus der vorindustriellen Handwerkerschaft zum Großbürgertum der Wilhelminischen Zeit erlebte. Das dichte Netz von erwähnten Verwandten, die einen ähnlichen Lebensweg hatten, wie in den Familien Hochapfel, Seidler, Engelhardt, belegen den Wert von Schmidtmanns »Erinnerungsbildern« als einer exemplarischen Quelle.
Hier erfahren wir den Optimismus der Revolutionsbewegung von 1848, die lähmende Stimmung in der kurhessischen Residenz- und Hauptstadt seit der Reaktion von 1850, die in diesen Kreisen freudig begrüßte Annexion sowie die Reichs- und Hohenzollernbegeisterung, die uns heute die Gründerzeit so fremd werden läßt. Die persönliche Betroffenheit des Autors erzeugt aber Verständnis und manche Erkenntnis. Schmidtmanns Schilderungen sind um so wertvoller, als er in Hannover 1866 eine ganz andere Stimmung kennengelernt hatte und sich mit dieser auseinandersetzte. Diese Erfahrung, wie auch seine Reisen, geben seinem Urteil eine Weltoffenheit, die bei aller Liebe zu Kassel frei von lokaler Enge bleibt. Daß dieses Leben dennoch immer den Einsatz für die Vaterstadt und ihr Wohl zum Ziel hatte, mag heute noch beispielhaft sein.
Leider können die Erinnerungsbilder nur in gekürzter Form neu herausgegeben werden. Besonderer Wert wurde auf eine umfangreiche Bebilderung gelegt, die heute, da das historische Stadtbild Kassels untergegangen ist, für die Vorstellung notwendig erscheint. Dafür wurden fünf Kapitel geopfert, die Schmidtmanns Zeit in Holzminden und Hannover beschreiben. Ebenso verzichtet die Neuauflage auf die z.T. breite Darstellung von historischen Ereignissen, die Schmidtmann von anderen Autoren übernimmt, wie beispielsweise die Schilderung der revolutionären Ereignisse von 1848 aus Friedrich Wilhelm Müllers »Cassel seit siebzig Jahren«, oder die etwas langatmige Beschreibung des Kriegsgeschehens 1870/71. Diese und ähnliche gekürzte Abschnitte in den »Erinnerungsbildern« können keinen historischen Quellenwert für die Ereignisse selbst beanspruchen und geben nur die allgemeine »öffentliche Meinung« ihrer Zeit wieder.
Dem Kasseler Bürger wird mit den »Erinnerungsbildern« von Heinrich Schmidtmann eine einzigartige Fundgrube für die Geschichte des 19. Jahrhunderts wiedergeöffnet. [...] Seiner Zielsetzung getreu, die Geschichte der Stadt für die Zukunft fruchtbar zu machen, wünscht das Stadtmuseum allen Bürgern Freude an der Stadtgeschichte, vielfältige Erkenntnisse und – ganz im Sinne Schmidtmanns – die Ermutigung, sich für das Wohl Kassels einzusetzen.
(Dank an Karl-Hermann Wegner für die Erlaubnis zur Wiedergabe seines Textes.)
Die Seitenzahlen der Druck-Ausgabe stehen in eckigen Klammern im Text. Die ersten acht Seiten sind nicht paginiert, ich habe sie mit römischen Ziffern bezeichnet.
Im Druck Gesperrtes wird kursiv wiedergegeben.
Offensichtliche Setzfehler wurden stillschweigend und behutsam korrigiert.
Gelegentliche Fragezeichen in Rundklammern, »(?)«, stammen vom Autor und bezeichnen Erstaunen, Ironie oder auch Unsicherheiten.
Die 26 Abbildungen finden sich im Buch auf eingeklebten, einseitig bedruckten, nicht paginierten Kunstdruckpapier-Seiten. Ich habe sie an den entsprechenden Stellen eingefügt.
• Einführung von Karl-Hermann Wegner (1993)
• »Erinnerungsbilder«, Einbandvorderseite
• Innentitel
• Vorwort
• Ausführliches Inhaltsverzeichnis
• Textbeginn
[Einbandvorderseite:]
Erinnerungsbilder
von Heinrich Schmidtmann
Schilderungen und Erlebnisse aus früheren Jahren
(Seite IV: unbedruckt)
[III] Erinnerungsbilder
Schilderungen und Erlebnisse
aus früheren
Jahren
für seine Angehörigen niedergeschrieben
von
Heinrich Schmidtmann
Cassel-Wilhelmshöhe 1907
Herausgegeben zum Besten des
Verschönerungs-Vereins in Cassel
2. Auflage 1910
Druck von Gebrüder Gotthelft
Königl.
Hofbuchdrucker, Cassel
* * *
[Abbildung zwischen den Seiten IV und V:]
[V] Vorwort.
Dieses Buch – mit dem Titel »Erinnerungsbilder« gekennzeichnet – verdankt seine Entstehung einer Anregung von verwandter Seite. Ich wußte meine freie Zeit nicht totzuschlagen – Arbeiten im Garten oder am Bienenstand, die mich im Sommer vollauf beschäftigten, waren nicht zeitgemäß – es war Winter. Auch geschäftlich usw. wurde meine Arbeitskraft nicht in Anspruch genommen, und so wurde mir der Gedanke nahegelegt, mich schriftstellerisch zu versuchen. Die ereignisreiche Zeit meiner Jugendjahre, der gewaltige Umschwung auf wirtschaftlichem, technischem und politischem Gebiete – welcher ergiebige Stoff, um besonders für meine Angehörigen so manches Wissenswerte über die damaligen Verhältnisse und meinen eigenen Lebenslauf niederschreiben. – – Den Gedanken griff ich auf und brachte diese Erinnerungsbilder zu Papier. Bei der mir mangelnden literarischen Übung mußte ich mich darauf beschränken, in erzählender Form über das zu berichten, was sich meinem Gedächtnis eingeprägt hatte und was ich mir zur Ergänzung der einzelnen Vorgänge durch Nachforschungen zu verschaffen wußte. Die gebrachten Schilderungen und Erlebnisse entsprechen nach bester Überzeugung und ohne Schönfärberei dem wahren Sachverhalt.
Ursprünglich nur für den engeren Kreis meiner eigenen Familie, meiner Verwandten, sowie mir nahe stehender guter Freunde bestimmt, da naturgemäß familiengeschichtliche und persönliche Mitteilungen den hauptsächlichsten Teil meiner Erzählungen bilden, hielt ich ein allgemeines Interesse an diesem [VI] Buche für ausgeschlossen; infolgedessen ließ ich nur eine beschränkte Anzahl Exemplare drucken, welche bis auf wenige bereits in andere Hände übergegangen sind.
Der Inhalt dieser »Erinnerungsbilder«, der ohne mein Zutun in weiteren Kreisen bekannt wurde, fand jedoch wider Erwarten eine günstige Beurteilung, selbst bei mir ganz fern stehenden Lesern, und von diesen erging allseitig die Aufforderung an mich, meine Erinnerungsbilder zu veröffentlichen und im Buchhandel erscheinen zu lassen.
Wenn ich es nun wage, dieser Aufforderung nachzukommen und das Buch mit mehrfachen Ergänzungen herauszugeben, so tue ich es in der Annahme und mit dem Wunsche, dadurch auch zur Geschichte meiner Vaterstadt aus damaliger Zeit ein kleines Scherflein beigesteuert zu haben.
Mögen meine Schilderungen dem Leser so recht vor Augen führen, wie anspruchslos und bescheiden die früheren Verhältnisse waren im Vergleich zu den heutigen – möge dieser Vergleich auf der anderen Seite aber auch dartun, was aus Cassel seit dem Beginn des von mir geschilderten Zeitabschnittes geworden ist, wie es sich au einer rückständigen und in baulicher Beziehung unter der Regierung des letzten Kurfürsten verwahrlosten Residenz zu einer der schönsten Großstädte unseres deutschen Vaterlandes erhoben und entwickelt hat. Ein Verdienst, hierbei tatkräftig, fördernd und anregend mitgewirkt zu haben, ist unstreitig auch dem Verschönerungsverein in Cassel zuzuerkennen, dem ich mit dessen Zustimmung dieses Buch widme und zu seinem Besten herausgebe.
Die Kapiteltitel stammen aus dem gedruckten Buch, die Zwischenkapitel in eckigen Klammern habe ich hinzugefügt.
(Seite VIII: unbedruckt)
* * *
Alle Original-Abbildungen (Seitenzahlen des gedruckten Buches):
Der Verfassser.
zwischen IV und V
Cassel aus der Vogelperspektive Anfang der sechziger Jahre. • Friedrich Wilhelm I., der letzte Kurfürst von Hessen.
zwischen VIII und 1
Das holländische Tor mit dem Blick in die Stadt. • Das ehemalige Wesertor. • Das ehemalige Königstor von der Außenseite.
zwischen 22 und 23
Das Auetor mit einem Blick auf die Kattenburg.
zwischen 24 und 25
Das ehemalige Postgebäude am Königsplatz.
zwischen 26 und 27
Das ehemalige Hoftheater.
zwischen 28 und 29
Links das ehemalige Frankfurtertor, im Vordergrund das Eingangstor zum Landgestüte.
zwischen 30 und 31
Der Judenbrunnen am Brink.
zwischen 32 und 33
Die alte Fuldabrücke.
zwischen 34 und 35
Das alte Hallengebäude am Königsplatz.
zwischen 42 und 43
Kurfürst Friedrich Wilhelm I. von der Parade in der Carlsaue zurückkehrend.
zwischen 58 und 59
Das ehemalige Meßhaus an der Königsstraße.
zwischen 88 und 89
Die St. Martinskirche vor dem Umbau.
zwischen 116 und 117
Das Welfenschloß in Hannover.
zwischen 132 und 133
Der Potthof in Hannover.
zwischen 138 und 139
[Harzer Reise- und Singgemeinschaft mit dem jungen Schmidtmann]
zwischen 222 und 223
Mein erstes Grundstück. | Plan von Cassel aus dem Jahr 1870.
zwischen 284 und 285
»Das S.C.H.-Quartett.« Zur Erinnerung an sangesfrohe Zeiten.
zwischen 306 und 307
Die ehemalige Kattenburg von der Aue aus gesehen.
zwischen 310 und 311
Napoleon mit dem Prinzen Murat.
zwischen 336 und 337
Napoleon auf Wilhelmshöhe.
zwischen 338 und 339
Einholung der Leiche des letzten Kurfürsten von Hessen.
zwischen 376 und 377
Die ersten verkäuflichen Villen der Villen-Kolonie in Wilhelmshöhe.
zwischen 382 und 383
* * *
Ich habe Bilder hinzugefügt, die teils nicht aus der geschilderten Zeit, sondern aus der Entstehungszeit des Buches stammen. So läßt sich der Wandel im Stadtbild verstehen, den Schmidtmann miterlebt und mitgestaltet hat.
[VII] Inhalt.
[Einband]
[Innentitel] [Vorwort]
1. Im »Halben Mond« • [Die Ausspannwirtschaft in der Müllergasse] • [Großeltern, Eltern, Hausaufteilung] • [Die Kasseler Altstadt] • [Wasserversorgung] • [Straßenbeleuchtung] • [Straßenreinigung] • [Tierhaltung] • [Brennmaterial] • [Geräuschkulisse] • [Freunde und Kinderspiele] • [Verwandte und Nachbarn] • [Familienleben] • [Wohnumstände] • [Umzug in die Mauerstraße]
2. Hinter der Mauer • [Die nördliche Altstadt] • [Militärfriedhof und Gardekaserne] • [Die alte Stadtmauer] • [Fabriken nördlich der Altstadt] • [Bebauung nördlich der Stadtmauern] • [Wie man zur Wilhelmshöhe fuhr] • [Das verwahrloste Kassel] • [Post und Verkehrsverhältnisse] • [Hallengebäude und »Kattenburg«] • [Exerzierplatz, Friedrichsplatz, Bellevue] • [Frankfurter Tor und Friedrichstraße] • [Wilhelmshöher Tor, Garde-du-Corps-Kaserne, Ständeplatz] • [Altstadt: Martinskirche, Straßenpflaster, Druselteich] • [Unterneustadt] • [Bahnhof] • [Druckereien]
3. Aus der Zeit meiner ersten Schuljahre 1848–1851 • [Schulen in Kassel] • [Bildung für Jungen und Mädchen] • [Gesellschaftliches Leben der Jugend] • [1848er Revolution] • [Kassel in der Revolution] • [Bürgergarde] • [Schutzwache] • [Garde-du-Corps-Übergriffe] • [Der Kurfürst bei Schutzwachen-Fahnenweihe und Volksfest] • [Streit zwischen Fürst und Bürgern] • [Deutschland in der Revolution] • [Kassel unter Hassenpflug 1850] • [Cholera-Epidemie und Tod der Mutter] • [Konflikt zwischen Hassenpflug und den Ständen] • [Kriegszustand in Kurhessen] • [Verlegung der Regierung nach Hanau] • [Anrufung des Bundestags, Militärdiktatur] • [Protest des Offizierskorps] • [Preußische, bayerische, österreichische Truppen in Kassel]
4. Aus meinen letzten Schuljahren 1851–1856 • [Einquartierungen an Weihnachten] • [Alltag mit den Einquartierungen] • [Rückkehr des Kurfürsten] • [Hofleben in Kassel] • [Das Hofteater] • [Fürstin und Prinzenerziehung] • [Fürstliche Fahrten zur Wilhelmshöhe] • [Ausflüge der Fürstin] • [Fürstlicher Jähzorn] • [Eigenheiten des Fürsten] • [Militärparaden] • [Zapfenstreich, Fürstengeburtstag] • [Wiederverheiratung des Vaters] • [Väterliche Arbeit und Autorität] • [Alltagsvergnügungen] • [Messen] • [Spiele der Jugend] • [Schule] • [Neue Geschwister, Beginn der Lehrzeit] • [Liebe zur Musik]
5. Meine Lehrjahre • [Konfirmation] • [Beginn der Lehrzeit] • [Versehentliche Spargelmißhandlung] • [Tätige Reue] • [Die erste Probearbeit] • [Lehr-Alltag] • [Winterunterricht in Bauhandwerkschule und Akademie] • [Tanzstunden] • [Freundschaftsbund, Eisvergnügungen] • [Familiengeselligkeiten] • [Taschengeld, Geschenke] • [Hausschlachtung] • [Der zweite Lehrsommer] • [Fußreise nach Wahlhausen] • [Familienleben im Elternhaus] • [Berufskrankheit des Vaters] • [Bürger-Feuerwehr] • [Schlußzeit der Lehre, Modellieren] • [Gesellengrad] • [Baugewerkschule in Holzminden]
6. In der Fremde • [Reise nach Holzminden, Schulbeginn] • [Schul-Schlafsaal] • [Unterricht, Verpflegung] • [Pausen und freie Zeit] • [Ende der Holzminden-Zeit] • [Rückkehr nach Kassel, Wanderbuch] • [Reise nach Hannover, Begegnung mit Hrn.Gille] • [Steinhauerherberge in der Knochenhauerstraße] • [Arbeit am Welfenschloß] • [Hr.Gille und Familie Kirchweger] • [Umzug in den Potthof] • [Umzug hinter den Bahnhof] • [Arbeitsbeginn am Welfenschloß] • [Zunftgebräuche] • [Arbeitsumstände] • [Polytechnikum und Baubüro] • [Volontär am Stadtbauamt]
7. Auf anderer Bahn • [Arbeiten an Mühlengebäuden] • [Geldsorgen und Hoffnungen] • [Anstellung bei der Stadt] • [Alte und neue Freundschaften] • [Arbeit am Brauergildehaus, Wohnungswechsel] • [Wohn-, Bier- und Geldverhältnisse] • [»Lieder-Tafel Union« und »Quartett-Verein Kongreß«] • [Fortgang der Arbeiten, neue Freundschaften] • [Zusatzaufträge, finanzielle Entspannung] • [Neue Bekanntschaften, Fertigstellung der Brauergilde] • [Friedhof-Bauführung, Wohnung bei Familie Senne] • [Das Zirkusbären-Schrecknis] • [Das Hannoversche Schützenfest, König Georg V.] • [Hofleben in Hannover] • [Welfenstolz, Partikularismus, Orthodoxie] • [Katechismusstreit, Revolte, leichte Entspannung] • [Deutschnationaler Patriotismus, Sangesbrüderschaften] • [Bierreisen von Sangesbrüdern, Arrest] • [Arbeiten am Friedhof Engesohder Berg]
8. Auf dem Döhrener Turm • [Lage und Geschichte des Turms] • [Begegnung mit Familie Buerdorf] • [Teilnahme am Familienleben] • [Einzug im Turm] • [Die Buerdorf-Töchter] • [Archäologische Funde auf dem Friedhofsgelände] • [Der Kronprinz interessiert sich für die Altertümer] • [Schwierigkeiten beim Friedhofsbau] • [Fertigstellung des Friedhofs, neue Bauten, Umzug]
9. In der »Langenlaube« • [Wohnung bei Familie Jansen] • [Überarbeitung] • [Harzreise-Pläne] • [In Musikerrunde nach Quedlinburg] • [Suderode, Stubenberg, Georgshöhe, Hexentanzplatz] • [Bodetal, »Schurre«, Roßtrappe] • [Blankenburg, Wernigerode] • [Mit dem Chef Droste ab Seesen nach Grund] • [Clausthal, Grubenbesichtigung] • [Brocken] • [Bodetal, Rübeland, Treseburg, Alexisbad] • [Auerberg, Stolberg, Kyffhäuser] • [Beim Einsiedler Beyer auf der Rothenburg] • [Kyffhäuser, Kelbra, Nordhausen, Ellrich] • [Durchs Ockertal nach Goslar, zurück nach Hannover]
10. In Hannover bis zum Kriege • [Architekten- und Ingenieurfest in Bremen] • [Hannoversche Diebesgeschichte] • [Stellensuche bei Kasseler Bahnen] • [Weiterbildung in Hannover, neue Anstellung] • [Freimaurer] • [Mühsame Reise nach Magdeburg] • [Bahnbau auf Java? Nein.] • [Weitere Aufträge, Umzug an den Theaterplatz] • [Geldsorgen und neue Projekte] • [Verlobung mit Sophie Buerdorf] • [Ausbleibende Zahlungen, Prozeß] • [Zwist zwischen Österreich und Preußen] • [Hannover beim Herannahen des Krieges] • [Kriegserklärung, Hannover auf Seite Österreichs] • [Mobilisierungwirren, Preußen rücken ein] • [Einquartierung im Döhrener Turm] • [Pyrrhussieg bei Langensalza] • [Hannover und Kurhessen werden preußisch] • [Geldsorgen, Rückkehr nach Kassel
11. Wieder in Cassel • [Neue Dynamik unter preußischer Herrschaft] • [Nebelthau und das Verhältnis zu Preußen] • [Kassel, Sitz der Provinzialregierung] • [Bedauerliche und erfreuliche Veränderungen] • [Arbeit an Kasseler Bauprojekten] • [Anstellung bei der Bahn] • [Reisen nach Hannover, Nebenprojekte] • [Meisterprüfung] • [Selbständigkeit, Grundstückserwerb] • [Finanzierung, Anschaffungen] • [Aufträge und Erfolg] • [Heiratspläne, Haus-Umbau, Hochzeit] • [Mit Ehefrau Sophie im neuen Hausstand]
12. Einer neuen Zeit entgegen • [Wilhelm I. von Preußen kündigt sich an] • [Der erste Besuch des Königs] • [1866er Krieg und Deutsches Reich] • [Kassel blüht auf, Vergrößerung des Unternehmens] • [Abenteuerliche Pferdewagenfahrt] • [Zweites Pferd, neuer Pferde-Ärger] • [Pannenreiche Kutschfahrt nach Wilhelmshöhe] • [Häuslichkeit und Verwandte] • [Freundes- und Singkreise] • [Hausschlachtung] • [Grunderwerb-Pläne] • [Geburt von Tochter Emilie, Industrie-Ausstellung] • [Verkehrsverhältnisse, Wigands Pferdebahn, Thaliatheater] • [Westliche Stadterweiterung durch Aschrott, Weinberg-Ausbau, Grundstückskäufe]
13. Während des deutsch-französischen Krieges • [Der 1870er Krieg] • [Kassel während des Krieges] • [Mobilmachung] • [Neuigkeiten, Gefangene und Verwundete treffen in Kassel ein] • [Frankreich vor der Niederlage] • [Die Stimmung in Kassel] • [Siegesnachricht, Reaktionen in Kassel] • [Napoleon III kommt nach Wilhelmshöhe] • [Napoleons Zeit auf der Wilhelmshöhe] • [Verwundete Franzosen in Kassel] • [Das Ende des Krieges] • [Napoleon und seine Offiziere beim Kriegsende] • [Abreise Napoleons, sehr kalter Winter]
14. Zum Frieden und was die folgenden Jahre
brachten • [Kaiserproklamation in Versailles] • [Patriotische Festlichkeiten in Kassel] • [Rückkehr der Truppen, Einquartierung] • [Erholungsreise über Straßburg in die Schweiz] • [Spekulationserfolg, Tod des Vaters] • [Der Kronprinz auf der Wilhelmshöhe] • [Rückkehr der letzten Truppen] • [Sohn Christel, Umzug in die Wolfhager Straße] • [Gerüsteinsturz an der Neuen Galerie] • [Niedergeschlagenheit, Versuche zur Abhilfe] • [Reiten als Therapie, Kur in Wolfsanger] • [Tätigkeiten im Vorderen Westen, Umsiedlung dorthin] • [Umzug in die Sophienstraße, Familienleben] • [Verwandte beider Seiten] • [Geburt des Sohnes Hermann, Tod der Ehefrau Sophie] • [Reise in den Schwarzwald und nach Paris] • [Tod der Mutter, Heirat mit Schwägerin Emma Buerdorf] • [Sohn Karl, Sohn Fritz, Aufschwung des Bauens] • [Gründung einer Firma mit Freunden, Bestattung des Kurfürsten] • [51. Tagung der Naturforscher und Ärzte, Besuch des Kaisers] • [Gründung des Fremdenverkehrsvereins] • [Erwerb des Hanauischen Palais’] • [Gründung der Villenkolonie Mulang]
* * *
[Zwei Abbildungen zwischen den Seiten VIII und 1:]
[1] 1. Im »Halben Mond«.
[1.1 Die Ausspannwirtschaft in der Müllergasse]
Hier klicken (→) für eine Website des »Geoportals« der Stadt Kassel, auf der man historische Pläne mit einem aktuellen Stadtplan überblenden kann.
Hier klicken für ein Foto der Müllergasse um 1900 von Georg Friedrich Leonhardt (→). (Universitäts-Bibliothek Kassel)
Hier klicken für ein Foto der Müllergasse um 1900 von Conrad Seldt. Der »Halbe Mond« ist das große dreigeschossige Haus mit dem Mansardgiebel und dem mittigen Torbogen, das 10. Haus von links. • Hier klicken (→) für einen helleren Abzug vom selben Negativ; der Vordergrund ist besser erkennbar, der Hintergrund hingegen weniger gut.
(Universitäts-Bibliothek Kassel; Dank an Dr. Christian Presche für die Bild-Erklärung.)
* * *
Heinrich Schmidtmanns Großvater Conrad Engelhard (jun.) wird im Adreßbuch für 1850 als Eigentümer des Hauses Holländische Straße 864 geführt (hier klicken (→) für das Namensregister / hier klicken (→) für das Straßenregister).
Die Nummer Holländische Straße 864 (bis 1839 Nr. 574, hier klicken (→)) war das spätere Haus Müllergasse 21; vgl. die Urkatasterkarten von 1836/37 (hier klicken (→) für Blatt A II von 1836): (schwarz die älteren, rot die jüngeren Hausnummern).
(Dank an Dr. Christian Presche.)
Ungefähr in der Mitte der westlichen Seite der Müllergasse in Cassel steht noch heute an der Straßenfront, in seiner ganzen Breite einen hohen Giebel bildend, mein ehemals großväterliches Haus, derzeit »Gasthaus zum halben Mond« genannt, äußerlich gekennzeichnet durch ein Aushängeschild mit einer vergoldeten Mondsichel auf beiden Seiten; der Name ist dem Hause bis in die Neuzeit verblieben.
Mein Großvater mütterlicherseits, Conrad Engelhardt, war Seilermeister und Gastwirt, aber nicht Gastwirt im heutigen Sinne, denn er betrieb keine offene Wirtschaft, sondern die Wirtschaft im »Halben Mond« beschränkte sich auf den sogenannten »Ausspann«. Eisenbahnen gab es damals noch nicht; die Bewohner der umliegenden Ortschaften fuhren mit ihren eigenen oder gemieteten kleinen offenen Wagen, meist einspännigen sogenannten »Klee-Chaisen«, vielfach zur Stadt und spannten dann in solchen Gasthäusern, wie hier im »Halben Mond«, aus. Die Wagen blieben auf der Straße stehen oder fuhren durch den breiten Torweg in den geräumigen Hof; die Pferde wurden ausgespannt und in dem großen Stall unter dem Seitenflügel, der Licht und Luft nur durch seine Tür und einige sehr kleine Fenster bekam, an den langen Steinkrtppen befestigt und erhielten dort ihr Futter. Meistens fuhren die Ausspanngäste, nachdem sie ihre Geschäfte in der Stadt besorgt hatten, abends wieder nach Hause; Nachtquartier wurde nur in seltenen Fällen beansprucht; es waren deshalb nur einige Wohnräume für Schlafgäste in einem, den Hof [2] nach hinten abschließenden Hintergebäude vorhanden. Vor diesem befand sich, in einer großen gepflasterten Vertiefung seitwärts, die Stätte für die Ablagerung des reichlichen Mistes aus den Ställen.
Die Hauptkundschaft bestand in Landleuten und Viehhändlern, die ihr Vieh, hauptsächlich Schweine und Kälber, in den Ställen des »Halben Mondes« unterbrachten; darunter waren die Händler aus Lohne, einem Dorf bei Gudensberg, besonders stetige Gäste. Diese Handelsleute, »die Löhner« – wie sie genannt wurden – trugen meist einen blauen Kittel über einem schwarzen Rock, der handbreit unter dem Kittel hervorsah und die erste Garnitur bei besseren Besuchen ersetzen mußte, weitere Garderobestücke pflegten die Herren nicht mit auf die Fahrt zu nehmen.
Eine andere regelmäßige Kundschaft bildeten die jüdischen Fellhändler, die ihre Felle auf den großen Böden in einem zweiten großen Seitenflügel lagerten.
Im Erdgeschoß des vorderen Hauses, links vom Torwege, lag nach der Straße hin die lange schmale Gaststube, in deren Längsrichtung eine durchgehende, in mehrere Teile getrennte Tafel mit einer dahinter an der Wand entlang stehenden Holzbank sich befand. Die Tafeln waren jede durch ein Querstück in der Mitte mit der Hausmauer durch eine Art Scharnierband verbunden, so daß die Tafel an der Wand in die Höhe geklappt werden konnte und durch einen Riegel festgehalten wurde. Durch diese damals vielfach gebräuchliche Einrichtung, welche sich heutzutage noch in alten Dorfwirtschaften hin und wieder vorfinden dürfte, konnte das Zimmer sofort ohne große Umstände in einen freien Raum verwandelt werden. In diesem Zimmer hielten sich die Gäste auf, tranken ihren Kaffee oder verzehrten ihr meist selbst mitgebrachtes Mahl: Brot, Wurst, Käse usw., dazu wurde ein Schnäpschen verschänkt.
Die jüdischen Fellhändler besorgten in der Gaststube, unbekümmert um etwa anwesende andersgläubige Gäste, auf und [3] ab gehend ihre Morgenandacht, ein Gebetbuch in der Hand und um den entblößten Unterarm den Gebetriemen gewunden, der in einer Kapsel oder kleinen Rolle unter der auf dem Kopfe nach hinten zurückgeschobenen Mütze endete, was alles ohne Störung durch andere geschah, denn Antisemiten kannte man damals noch nicht.
[1.2 Großeltern, Eltern, Hausaufteilung]
Meine Großeltern bewohnten die erste Etage mit ihren beiden Kindern, einer Tochter und einem Sohn; mit ersterer, Katharine Pauline, verheiratete sich mein Vater im Jahre 1839 in einem Alter von 22 Jahren. Durch den frühen Tod der Eltern war mein Vater genötigt, mit der Übernahme des väterlichen Geschäftes als »Wagenlackierer, Maler und Vergolder« sich seinen eigenen Hausstand in sehr jungen Jahren zu begründen. Nach seiner Verheiratung siedelte mein Vater mit seinem Geschäft in das schwiegerväterliche Haus »Zum halben Mond« über, woselbst ihm im Seitenflügel, anschließend an das Vorderhaus, eine sehr große Remise zur Werkstätte eingeräumt wurde.
Die Familienwohnung befand sich in der zweiten Etage, dort wurden wir fünf Kinder aus erster Ehe, Konrad, ich, August, Marie und Louise, geboren, und ich verlebte meine Kinderjahre bis zum Eintritt in die Schule in der Müllergasse.
[1.3 Die Kasseler Altstadt]
Die damalige Beschaffenheit dieser Straße war eine durchaus kleinstädtische, sie entsprach etwa einer alten holperigen Straße in Münden, Wolfhagen usw., wie sie sich dort heute noch vorfinden. Der Fahrdamm war unregelmäßig mit rund abgefahrenen, glatten Basaltsteinen gepflastert, an beiden Seiten befanden sich offene flache Druseln (Gossen), zwischen diesen und den Häusern war etwas besseres Pflaster von Sandsteinen; Trottoire mit Randsteinen gab es nicht. In die Druseln durfte man die Spüleimer mit dem Wirtschaftswasser ausgießen. Die Fußsteige wurden verengt durch weit vorliegende Stufen vor den Haustüren. Die meisten Häuser hatten den Eingang in den Keller von der Straße aus durch [4] sogenannte Kellerhälse, mit im Fußsteig liegenden schrägen oder auch wagerechten zweiflügeligen Falltüren. Bei uns im »Halben Mond« lag dieser Kellereingang seitwärts vom Torwege; schwere Lasten, Kisten oder Fässer wurden auf sogenannten Schrotleitern, die über die Sandsteinstufen zum Schutze derselben gelegt wurden, in den Keller hinabgelassen.
Vor den Ladenfenstern – Schaufenster gab es noch nicht – waren vielfach erhöhte Schwellen eingepflastert, auf die man sich stellte, um die vor dem Ladenfenster befindliche »Ladenbank« erreichen zu können, denn nur im Winter, bei schlechtem Wetter oder bei größeren Einkäufen ging man in den Laden selbst; sonst klopfte man von außen mit dem Geldstück ans Ladenfenster, hinter welchem die Verkäuferin saß, und ließ sich die Waren durch ein kleines Fensterchen herausreichen. Neben den Eingängen zu den Metzgerläden an der Straße hingen an eisernen Armen die im Hause ausgeschlachteten Schweine, Kälber und Hämmel oder halbe Ochsen, die je nach Bedarf außen abgenommen und im Laden zerlegt wurden.
[1.4 Wasserversorgung]
Der Trinkwasserbedarf wurde aus Brunnen – »Bumpeln« genannt – gepumpt, welche in den Straßen ziemlich nahe an den Häusern standen; das Wirtschaftswasser holte man an den »Zaiten«, so bezeichnete man die Druselwasserleitungsständer, die mit Holz umkleidet nach vorn einen Ausflußarm mit messingenem Druckknopf hatten, aus dem je nach den Witterungsverhältnissen das Wasser mehr oder weniger trübe langsam herauslief. Dem »Halben Mond« gegenüber, vor dem Hause des »Megsters« Meth an der Kruggassenecke, stand ein Bumpelbrunnen mit einem schlichten, grün angestrichenen Holzkasten; das Wasser wurde durch Holzröhren – ineinandergeschobene ausgehöhlte Eschenholzeinstämmlinge – mit einem Holzschwengel, der durch den Gebrauch wie poliert glatt gegriffen war und beim jedesmaligen Anhub einen kreischenden Ton von sich gab, in die Höhe »gebumpelt«. Die Instandhaltung in unserem Stadtteile lag dem Brunnenmacher Kolbe ob, dessen Söhne mithalfen. Kolbens Jungens waren stramme, [5] hübsche Kerle mit schwarzen Augen; so halb Zigeuner und richtige Radaubrüder, führten sie in der Kastenalsgasse das Regiment und wurden deshalb von der Müllergässer Jugend, die sich für eine Nummer besser hielt, sehr gefürchtet und gemieden.
An den Bumpeln und Zaiten wurde zu bestimmten Tageszeiten von den Dienstmädchen das Wasser geholt, zum Trinken in irdenen Steinkrügen, für die Wirtschaft in Eimern, die an einem auf den Schultern hinter dem Nacken liegenden Tragholz hingen. Zwei Eimer voll nannte man »einen Gang Wasser holen«, wovon 3 bis 4 Gänge zum Füllen der »Bornstanne« – des Wasserbehälters in der Küche – nötig waren. Morgens wurde dies Geschäft in möglichster Eile besorgt, und oft habe ich es gesehen, mit welcher Geschwindigkeit und Grazie kleinere Dienstmädchen den Pumpenschwengel, halb in die Höhe mithüpfend, zu handhaben wußten. Aber am Abend wurde sich fein gemacht zum Wasserholen, da fand an den Brunnen oder den Zaiten das erste Stelldichein mit den Herren Soldaten statt, denn die meisten Mädchen hatten ihre Schätze – es waren Soldaten vom kurhessischen Schützen-Bataillon – aus der damals am Walle, dem heutigen Platze der städtischen Badeanstalt liegenden Schützenkaserne, die die Liebesbedürfnisse der Müllergässer Küchenfeen befriedigten und sich nicht gern Kameraden von anderen Regimentern ins Gehege kommen ließen.
[1.5 Straßenbeleuchtung]
Die Verhältnisse zu zärtlichen Annäherungen mit den Soldaten der Schützenkaserne waren aber auch sehr günstig, denn eine Straßenbeleuchtung wie jetzt in den größeren Städten gab es nicht, das Leuchtgas war noch nicht in der Stadt eingeführt. Die Straßen wurden durch Öllaternen beleuchtet, welche an starken Seilen, die zwischen zwei Masten über Rollen zum Herauf- und Herablassen liesen, über der Mitte der Straße baumelten. – Der Laternenanstecker kam des Morgens und orgelte mit einer Kurbel das Seil, das über einer in einem Kasten angebrachten Rolle hing, soweit herunter, daß [6] er Öl auf die Lampe gießen und den Docht reinigen konnte, damit für den Abend die Laterne in Ordnung war. Unser Laternenanstecker hieß Semmler, der Straßenjugend wohl bekannt wegen seines gewaltigen Riechers und deshalb »Nasensemmler« genannt, weil seine rote und stets tropfende, feuchte Nase den bösen Jungen Gelegenheit zum Hänseln gab, besonders wenn er selbst »zu viel Öl auf die Lampe« gegossen hatte. – Sein Sohn Hennes lernte später mit mir zusammen als Maurer und Steinhauer »bie’m ahlen Leser« und wir waren durch unsere Müllergässer Beziehungen stets gute Freunde. In der Müllergasse war eine solche Hängelaterne in der Nähe unseres Hauses, die, bei stürmischem Wetter mit pfeifendem Geräusch hin und her schwingend, ihre düsteren matten Schatten an den Häusern entlang huschen ließ.
Außer den Laternen, die in den offenen Torwegen einiger Häuser, darunter das unsere, einen schwachen Lichtschein spendeten, gab es keine Beleuchtung. Der Nachtwächter trug bei seinen Rundgängen stets eine brennende Laterne, mit der er unsicheren Passanten in der Dunkelheit heimleuchtete. Von 10 Uhr nachts an rief der Nachtwächter nach zweimaligem, in die Höhe schrillendem Pfiff die Stunden ab mit den Worten: »Die Stunde hat – ansteigend bis zum Worte »hat«, und dann absetzend weiter murmelnd – »zehn (usw.) geschlagen zehn ist die Glock«. Zum Glück gab es damals noch nicht soviel Spitzbuben wie heute, sonst hätten sich diese kein besseres Warnungssignal wünschen können, wie den Pfiff des Nachtwächters, der dessen Annäherung rechtzeitig verriet, so daß der Dieb sich vor Entdeckung sichern konnte.
[1.6 Straßenreinigung
Die Straßenreinigung besorgten die sogenannten Eisengefangenen – Zuchthäusler aus dem Zuchthaus an der Fulda. Es waren meist schwere Verbrecher, die Raub, Mord und Totschlag auf dem Kerbholz hatten, welche unter Aufsicht eines uniformierten, mit einem Seitengewehr bewaffneten Gefangenwärters die Straßen reinigten. Eine Kolonne düsterer Gestalten mit glattrasierten Galgengesichtern und kurzgeschorenen [7] Köpfen, in langen hellgrauen Röcken mit schwarzen Kragen und Aufschlägen, anschließender viereckiger Kopfbedeckung, ähnlich der katholischer Geistlicher, und grauen Drellgamaschen bis zum Knie, so bekleidet durchzog die unheimliche Gesellschaft die Straßen der Stadt. Der Name »Eisengefangene« war ihnen beigelegt, weil am rechten Unterschenkel über dem Knöchel und unter dem Knie zwei starke eiserne Ringe befestigt waren, die mit einer Eisenschiene verbunden waren, an welche die Unglücklichen in ihren Zellen mit eisernen Ketten angeschlossen wurden. Die schwersten, mit lebenslänglicher Zuchthausstrafe belasteten Verbrecher wurden als Zugtiere benutzt und mußten die schweren zweiräderigen Karren ziehen; als äußeres Merkmal begangener größerer Schandtaten hatten sie eine an der Schiene befestigte schwere eiserne Kugel mit sich zu schleppen. Lautlos mußten die Gefangenen mit Reiserbesen den Schmutz der Straße zusammenkehren, in die Karren laden und abfahren. – Alljährlich ein- oder mehreremal konnte man die Unglücklichen damit beschäftigt sehen, mit stumpfen Messern das vielfach auf Straßen und Plätzen zwischen den Pflastersteinen hervorwuchernde Gras herauszustechen, wobei es ihnen gestattet war, sich auf die Steine zu setzen.
Wie überall in den alten Stadtteilen, bestanden auch in der Müllergasse zwischen den Häusern durchgehende, stark mannsbreite Zwischenräume – die »Winkel« genannt wurden und nach der Straße zu mit einer Tür abgeschlossen waren. In diese lief das Regenwasser von den Dächern ab, ebenso das Gossenwasser aus den Küchen durch steinerne Ausflüsse an den Gossensteinen. Die intimen Bedürfnisörtlichkeiten waren etwa wie in der Form von Starenkasten in die Winkel hineingebaut und vermittelten in diese durch eine viereckige Holzrinne – »Abtrittshose« genannt – den Speditionsverkehr mit der Außenwelt, völlig frei, ohne Schutz vor Zug und Kälte; man war damals weniger empfindlich wie heute, nicht allein gegen Zug und Kälte, sondern »überhaupt und so – – –«
[1.7 Tierhaltung]

»Cassel. Partie aus dem Schockethal.« Das Schocketal liegt nördlich von Kassel, und also gehört diese Karte nicht zwingend hierher, aber erstens habe ich sie nun mal, zweitens ist sie hübsch, und drittens gibt es gewiß nicht viele Schweinehirten-Postkarten aus Kassel und Umgebung.*MA•dr
[8] Fast jeder Hausbesitzer in der Müllergasse mästete sich sein Schwein, um es im Winter für den Haushalt zu schlachten, einige hielten sich auch noch Kühe. Im Frühjahr und Sommer wurden sowohl Schweine wie Kühe auf die städtischen Weideplätze beim Eichwäldchen oder bei Wolfsanger täglich durch den Schweine- bezw. Kuhhirten abgeholt und zu diesem Zwecke zu bestimmten Stunden aus den Ställen gelassen. Der Schweinehirt »Schinken-Willem« zog mit einer großen Peitsche knallend durch die Straßen, die Schweine aus den Häusern lockend. Sein Äußeres war nicht weniger wie vertrauenerweckend; in einen zerlumpten blauen Kindel gehüllt, mit zerrissenen Hosen, einen großen Sack um die Schultern, an den Füßen schief getretene zerrissene Schaftstiefeln, aus denen die Zehen herausguckten, mit ungekämmtem Haar und struppigem Vollbart, einem aufgedunsenen, schnapsgeröteten Gesicht, das wohl kaum jemals mit Seife in Berührung gekommen war, in den Mundwinkeln den Kautabak äußerlich verratend, mit einem Wort ein »Schweine«-Hirt im besten Sinne des Wortes – war der Willem Schinken bei seiner recht zweifelhaften Ehrlichkeit dennoch ein Original, das in der ganzen Stadt bekannt war und besonders mit uns Jungen gute Beziehungen unterhielt. Seine »Schwinnerchen« nannte er nach den betreffenden Besitzern; wenn ein Schwein mal sich nicht fortbewegen wollte oder zu langsam war, dann lockte er es erst im Guten und rief es mit näselnder Stimme an: »Na, Litzenbauerchen – oder Reedelchen – hoste dann noch nit ußgeschlofen? Widde dann nit mitte – na, so komm doch, du kannst doch nit alleine derheime bliewen?« Folgte dann aber das Tier nicht, dann wurde er wild und es gab »lange Hawwer« (Hafer), d.h. Schläge mit der Peitsche, dabei schimpfte er: »Nu gucke mo einer so’n Schwinnehund von Needel ahn, wie hä sich do rumräkelt – gehste uß d’r Drusel, du scheiwes Aas, du sadd’s Gewidder krichen, basse mo uff, ich will däh Beine machen« – es waren nämlich Schweine vom Tuchbereiter (Dekateur) Litzenbauer oder Dachdecker Nöthel, die er meinte, auf [9] die er dann mit seiner Peitsche unbarmherzig einhaute, daß sie laut quiekend und grunzend aufsprangen und mit den anderen Schweinen fortgingen. Abends, wenn »Schinken« mit den Schweinen zurückkam, brachte er uns öfters Hirschkäfer oder Einhornkäfer mit, die er in einem Säckchen aufbewahrt hatte, oder auch Vogeleier, die er »ausgenommen« hatte. In späteren Jahren war ich Abnehmer von letzteren zur Bereicherung meiner Eiersammlung; heute bedauere ich es tief, daß ich ein solches verabscheuungswürdiges Ausrauben der Vogelnester durch meine Sparheller unterstützt habe – aber Jugend hat keine Tugend – und ich war am wenigsten dazu angetan, eine Ausnahme zu machen. – Daß Schinken-Willem bei dem alljährlich während der Herbstferien im Rothenditmolder Felde sich abspielenden Kleinkrieg zwischen Casseler und Rothenditmolder Schuljungen als Anführer der Casseler Streitmacht außerdem eine Rolle spielte, wird manchem alten Casselaner noch erinnerlich sein.
Schinkens Kollege, der Kuhhirt, blies jeden Morgen, durch die Müllergasse ziehend, bewehrt mit einem langen Stocke mit losen eisernen Ringen, in ein langes Tutehorn, worauf dann die Kühe, mit mehr oder weniger überschnappenden Muh-Tönen aus den Torwegen kommend, ihren Morgengruß erwiderten und dem Hirten folgten, ihre Visitenkarte in breitem, grünem Format klatschend auf dem Straßenpflaster zurücklassend. Abends kamen sie mit vollgepfropftem, kugelrunden Wampen zurück und blieben so lange heiser »muhend« vor den Toren stehen, bis ihnen diese geöffnet und sie in den warmen Stall getrieben wurden.
[1.8 Brennmaterial]
Eine weitere stadtbekannte Straßenpersönlichkeit war der »Kohlen-Keßler«. Er entstammte einer gut bürgerlichen Familie, war jedoch verbummelt und heruntergekommen, dabei aber ein Original – so eine Art Eulenspiegel – das sich zu allerlei Ulk herbeiließ, von dem in meiner Jugend viel erzählt wurde. Den Beinamen bekam er als Begleiter der Kohlenfuhrleute, welche mit ihren Wagen aus den benachbarten Bergwerken [10] Braunkohlen zum Kleinverkauf in die Stadt brachten. Auf diesen Wagen befand sich stets ein Holzkasten als Maß, aus welchem die Kohlen den Käufern zugemessen wurden, und mit dieser Arbeit verdiente sich Keßler seinen Unterhalt.
Unsere hessische Braunkohle und Buchenscheitholz war damals das übliche Brennmaterial. Der eigenartige Braunkohlengeruch, mit dem die sonst so reine Casseler Luft geschwängert war, machte sich jedem auffällig bemerkbar, wenn er das Weichbild der Stadt betrat. Steinkohlenbrand war noch nicht eingeführt, er galt als Luxus, den man nicht mitmachen konnte, weil die hiesigen sogen. »Casseler Öfen« für solchen Brand nicht eingerichtet waren. Außerdem befaßte sich damals die Kaufmannschaft noch nicht mit dem Kohlenhandel, der jetzt, besonders in der westfälischen Steinkohle, im großkaufmännischen Betriebe eine so bedeutende Rolle spielt. Wer derzeit seinen Bedarf an Brennmaterial decken wollte, mußte seine Bestellung rechtzeitig bei den betreffenden Verwaltungsstellen machen, die dort eingetragen wurde. Die Anfuhr erfolgte dann der Reihe nach, oft erst nach mehreren Wochen, ja Monaten. Dies Verfahren nannte man »sich die Kohlen verschreiben lassen«. Das Buchenscheitholz wurde aus dem fiskalischen Holzmagazin vor dem Wesertore bezogen, wo die Forstverwaltung das Holz aus den Staatswaldungen in mächtigen Stapeln aufgespeichert hatte. Neben dem Holzmagazin befand sich auch die sogenannte »Wilpertschirne«, die Sammel- und Verkaufsstelle für das bei den herrschaftlichen Jagden erlegte Wild. Das Buchenscheitholz wurde nach »Klaftern« gemessen, ein Fuder hatte gewöhnlich zwei Klaftern. Das Holz wurde auf der Straße vor dem Hause abgeladen und wurde dort für Rechnung des Käufers »kleingemacht«, d.h. vom Holzhacker auf dem mitgebrachten »Sagebock« mit der Handsäge in Stücke geschnitten – oft mit Hilfe der Frau – und dann mit der Axt gespalten. Zum Schmieren der Säge wurde in der Regel ein Schweinenabel verwandt, der meist seitlich am Sagebock baumelte. Beim Kleinverkauf der Schmiedekohlen – so nannte [11] man die Holzkohle, die zum Erhitzen der Bügeleisen auf offenen Feuern gebrannt wurde – zogen die Kohlenbrenner, ihre hohen »Kötzen« auf dem Rücken, mit dem lauten zweitönigen Ausruf: »Kohlenkauf« oder »Kaufkohlen« durch die Stadt. Auf ähnliche Weise machten sich auch die Zwehrener Sandbauern bemerkbar, um ihren »Strausand« an den Mann bezw. die Frau zu bringen. Mit der damals typischen »Strumbetzel« auf dem Kopfe schlenderten diese »Zwehrenschen Buern« neben ihrem Fuhrwerk durch die Straßen einher mit dem in nur geringen Pausen unterbrochenen, oft markerschütterndem Rufe: »Jausaand – Jausaand – Jau – –«
[1.9 Geräuschkulisse]
Auch die Heidelbeerenweiber, welche zur Zeit der Beerenernte mit den flachen Wannen auf ihren Kötzen die Stadt durchzogen und durch meist blaue »Schnutten« ihre Ware verrieten, ließen ihre hellen Stimmen laut erklingen in dem gedehnten, singenden, ebenfalls zweitönigen Ruf: »Hei–delbeeren kauf«.
Neben diesen Ankündigungen auf offener Straße wurde auch von amtswegen die Ruhe oft gestört durch den städtischen Ausrufer – er hieß »Neuber«, so viel ich mich entsinne. – Mit einer großen Handglocke in der einen und einem Blatt Papier in der anderen Hand zog er mit ernster Amtsmiene durch die Straßen, die Strassenjugend im Gefolge, und kündete, an den Straßenecken haltend, nach kräftigem Läuten mit der Glocke, mit vollem Brustton, was er im Auftrage des Magistrats o.A. auf diesem Wege zur Kenntnis der Bürgerschaft zu bringen hatte.
Das waren eigentümliche Gebräuche der damaligen Zeit, welche heute – wie so viele andere – in der Großstadt nicht mehr zulässig erscheinen, einesteils, weil sie von dem Skandal des Straßenverkehrs übertönt werden, und dann, weil die hohe Polizei – – –. Sie bleiben aber den alten Casselanern in guter Erinnerung und so auch mir, und deshalb will ich diese Gebräuche hier nicht unerwähnt lassen.
[1.10 Freunde und Kinderspiele]
Doch zurück zur Müllergasse.
[12] Meine frühesten Jugendbekanntschaften in der Müllergasse beschränkten sich auf die Nachbarskinder, mit denen wir spielen durften. Dies waren der Schorsche Gallhöfer, dessen Vater Schlossermeister war und dicht nebenan wohnte; ferner der Konrad, d’s Guste und d’s Mimi Riemann, von Bäcker Riemanns, und dann noch der Hennes Nöthel vom Dachdecker Nöthel, genannt der »scheiwe Reedel« wegen seiner furchtbar krummen Beine. Der Hennes war der älteste und ein durchtriebener Junge mit rötlichem Haar, er zeichnete sich durch sein geschicktes hohes Werfen mit Steinen aus; ich entsinne mich noch, wie er mal hoch über die Häuser bis in die Schäfergasse warf und dort eine Scheibe zertrümmerte, was ihm eine tüchtige Tracht Prügel eintrug, von der wir Jungen auch noch etwas abbekamen.
Zum Geburtstag unseres hochseligen Kurfürsten am 20. August war es Sitte, daß die Jugend die Brunnenhäuschen mit Blumengirlanden und bunten Lämpchen dekorierte, oben drauf ein ausgehöhlter Kürbis mit eingeschnittenem Gesicht, der von innen durch ein Wachslichtchen transparent erleuchtet wurde. – Die Müllergässer Jungen betätigten ihren Patriotismus an diesem Tage durch die Ausschmückung des Brunnens an Meths Ecke und wir Kleinen mußten in einer irdenen Sparbüchse die nötigen Heller zusammenbetteln, die dann von den älteren Jungen, nach Deckung der geringen Unkosten, verschnökert wurden, für »Bollerchen, Lakrizius, Süßholz, Johannisbrod, Jumfdernleder« und Gott weiß was es sonst noch an »Schnuckereien« für die jugendlichen Naschmäuler gab.
Im Torweg des »Halben Mond« befand sich, in den Boden versenkt, ein kleiner Schacht zur Aufbewahrung des Teers (casselsch »Zehr«), der zum Schmieren der Wagenräder in den Achsen gebraucht wurde, in welchem ein Schöpfgefäß mit einem langen Stiel stand; es machte uns immer ein Hauptvergnügen, den zähen Teer zu schöpfen und dann sich schlängelnd wieder einlaufen zu lassen; bei dieser Spielerei holten wir uns meist schwarze Pfoten und Flecken in die Hosen, sie brachten uns manche Schelte oder Ohrfeige ein.
[1.11 Verwandte und Nachbarn]
[13] Mein Großvater hatte seine Seilerbahn an der alten Stadtmauer neben dem Holländischen Tor, wo er seine Seile drehen ließ, was ich öfters mit ansah. Der Großvater selbst war durch ein schweres Bruchleiden gelähmt und konnte nur an zwei Stöcken gehen, konnte deshalb die Seilerbahn nicht besuchen. Den Bindfaden aber, der ihn in Waschkörben ins Zimmer gestellt wurde, wickelte er selbst viele Jahre lang über ein glattes, schwarzes Wickelholz zu Rollen auf in den verschiedensten Größen, wie sie verkauft wurden. Der Verkauf fand in der Gaststube statt, in deren Ecke nach der Straße hin die Seile hingen, und wurde von meiner Großmutter besorgt. Meine Großmutter, eine geborene Horchler, ist mir noch erinnerlich in ihrer schneeweißen, den Kopf ganz umschließenden Haube mit »geduddeten« Spitzen rings ums Gesicht und breiten Bindebändern.
Ein Bruder meines Großvaters, der Onkel Bernhard, war Schreinermeister und wohnte in der Kastenalsgasse; von seinen Söhnen verkehrten wir mit dem »Schorsche«, der in späteren Jahren als Schreinermeister in langjähriger Geschäftsverbindung mit mir stand.
Im Hause gegenüber wohnte eine Frau Dittmar, deren Mann als Sergeant beim Kurhessischen Leibregiment, den so genannten »Konräderchen«, stand. Frau Dittmar weißnähte für meine Mutter, und wenn uns diese gern los sein wollte, schickte sie uns hinüber; ich habe oftmals, auf dem Fußbänkchen sitzend, ihren Erzählungen gelauscht.
Unser Nachbar, der Bäckermeister Riemann, ein großer, stattlicher Mann mit scharfgeschnittenem, glatt rasiertem Geheimratsgesicht, stand meistens, wenn er mit Backen fertig war, in der Haustür. Mit aufgekrempelten Hemdsärmeln, die Arme über der breiten Brust übereinander geschlagen, von den Hüften ab die nackten Beine usw. nur mit einem mehlbestaubten, blauen Bäckerhemd umschürzt und Lederschlappen an den bloßen Füßen, war er in seiner männlich schönen Erscheinung eine besondere Respektsperson. Er begrüßte die vorübergehenden [14] Bekannten in seiner derb-jovialen Weise; auch ich wurde als »Hennerchen« stets von ihm begrüßt und mußte ihm die Hand reichen, wenn ich Brot holte.
[1.12 Familienleben]
Aus unserem engeren Familienleben erinnere ich mich noch, wie wir drei Jungens morgens in buntgeblümtem Nachtkittel um den Tisch saßen und unsere selige Mutter aus einer braunen irdenen Kaffeekanne uns den Kaffee einschenkte. In der Wohnstube stand ein altmodischer großer, viereckiger, eiserner Ofen, hoch von der Erde auf geschwärzten Tonfüßen; um den Ofen befand sich ein Lattengestell, auf dem die Kinderwäsche hing, um sie bequem zur Hand zu haben; wir Kinder wurden in der Nähe dieses Ofens von der Mutter gewaschen und angezogen und mußten uns dabei sehr ruhig verhalten, besonders wenn der Vater in der Stube war.
Unsere Eltern waren beide musikalisch veranlagt, Mutter sang und begleitete sich die Lieder selbst auf der Gitarre, damals das zumeist eingeführte Instrument für den Hausbedarf. Ebenfalls sang mein Vater, der eine schöne Baßstimme hatte; vollendet schön aber verstand er zu pfeifen, womit er uns lauschenden Kindern viel Freude machte – besonders waren es Opernmelodien, die nach einer im Theater gehörten Oper mit Vorliebe gesungen oder gepfiffen wurden.
Das erste Familienfest, dessen ich mich noch erinnere, war die Taufe meiner Schwester Louise, zu welcher unsere nächsten Verwandten eingeladen waren, darunter auch mein damals noch lebender Pate, der einzige Bruder meines Vaters, Onkel Heinrich. Wir drei Jungen durften aufbleiben und vorher der Tauffeierlichkeit durch Konsistorialrat Meyer beiwohnen. Die Feier fand in der »guten Stube« statt, die blendend hell gescheuert war, mit frisch gestreutem weißen Sand, der vor dem Eintritt der Gäste von uns Jungen nicht vertreten werden durfte.
[1.13 Wohnumstände]
Gestrichene Fußböden gab es damals in den bürgerlichen Wohnhäusern noch nicht; jeden Morgen wurde von einer Blechschippe nasser Sand auf die Fußböden der Zimmer geworfen, [15] der dann mit einem Reiserbesen hin und her geschoben wurde, damit der Sand vom Tage vorher und die Staubteile sich mit dem genäßten Sand zusammenballten, dadurch wirbelte weniger Staub auf; dieser Kehricht wurde dann auf einer »Dreckschippe« in den Aschenkasten geworfen. Nach dem Lüften des Zimmers und Abstäuben der Möbel wurde auf den rein gefegten Boden der blendend weiße Sand gestreut, der dem Zimmer ein freundliches Ansehen gab; wehe, wenn wir etwa in der eben fertig gestreuten Stube mit den Füßen rutschten und den Sand in seinen schönen Streufiguren verwischten – dann wurden wir »am Schlaffitch gekriggt« und mit einigen Klapsen an die Luft gesetzt.
Jeden Sonnabend wurden die Stubenböden gescheuert und mit »Riebesand« – zerkleinertem Sandstein – der in kleinen Säcken auch auf der Straße feilgeboten wurde – zur besseren Reinigung abgerieben. Etwaige Fettflecken, die auf dem hellen Holzfußboden besonders sichtbar waren, bestrich man mit steifer weißer Kollerfarbe (Schlemmkreide), wodurch die Fettflecken gelöst und aufgesogen wurden. So lange wie diese weißen Schmierpflaster auf dem Fußboden hafteten, durften die Stuben von uns Kindern nicht betreten werden. – Das sich stets wiederholende Abreiben mit Sand veranlaßte natürlich eine starke Abnutzung des Fußbodens, wodurch die härteren Äste in den Dielen allmählich in halbfingerhohen Buckeln aus dem Fußboden hervorragten, so daß es oft ein Kunststück war, Tische und Stühle – ohne daß sie »wuckelten« – festzustellen.
Die Beleuchtungsverhältnisse waren derzeit allereinfachster Art, man kannte nur ein Brennöl – das »Sparöl« – das in einfachsten Tischlampen mit grün angestrichenen Blechschirmen im Zimmer, oder in offenen »Hangelichtern« oder zinnernen Stehlichtern mit Glasbirnen als Ölbehälter in den Küchen das Licht unterhalten mußte. Naphta, Solaröl, Petroleum usw. mit allen den verbesserten Lampen gab es erst viele Jahre später. In der »guten Stube« oder bei Festlichkeiten [16] wurden Kerzen gebrannt; für den raschen, vorübergehenden Gebrauch verwendete man Talglichter, die auf einfache Leuchter aufgesteckt waren.
Ein unentbehrliches Hausgerät, mit dem sogar ein gewisser Luxus getrieben wurde, war die »Lichtputzschere«, womit man den »Schnuppen«, der sich in der Flamme durch Rußansetzen des Dochtes bildete, abschnitt, so daß sich der verbrannte Docht in einem Kästchen durch eine Klappe an der Schere zusammenpreßte; dies mußte aber mit Vorsicht geschehen, sonst knippte man die Flamme aus.
In unserer guten Stube stand auf der Kommode eine Zündmaschine, ein siphonartiger Glasbehälter zur Aufnahme der Säurenflüssigkeit, mit einem messingenen Deckelverschluß, an dem die Zündvorrichtung befestigt war. Durch Druck auf einen Hebel machte man ein Platinschwämmchen erglühen, an dem man sich die Zigarren oder Fidibusse anstecken konnte, was jedoch nur in den seltensten Fällen gelang.
Für den allgemeinen Gebrauch wurden Phosphorstreichhölzchen in großen runden Schachteln verwendet, auf deren Deckel eine rote Masse zum Anreiben der Hölzer aufgetragen war, die sich dann mit blauer, den Atem fortnehmender Schwefelflamme entzündeten.
In der Küche neben dem gemauerten »Sparherd« saßen die Mädchen des Abends beim trüben Schein eines Küchenlichtes, das, wenn es ausgehen wollte oder zu sehr qualmte, durch einen fingerlangen Draht, der an einem kleinen Kettchen mit dem Lichte verbunden war – »Stocheler« genannt – in Ordnung gebracht wurde, indem man damit den Docht weiter hervor »stochelte«. Nach der Hausarbeit strickten die Mädchen oder sie drehten das Spinnrad und spannen Garn für die Herrschaft zu Hausmacheleinen, dabei erzählten sie uns Kindern, die wir uns doch gern in der Küche aufhielten, Gespenstergeschichten oder umgekehrt wir ihnen.
[1.14 Umzug in die Mauerstraße]
So verlebte ich die Kinderjahre in der Müllergasse bis zum Eintritt in die Schule. Gegen Ende des Jahres 1847 [17] sah sich mein Vater genötigt, die Geschäftsräume im »Halben Mond« aufzugeben, einesteils weil sich der Umfang seines Geschäftes erheblich vergrößert hatte, so daß die Räume nicht mehr ausreichten, dann aber auch, weil mein Onkel August, der einzige Bruder meiner Mutter, aus Paris zurückkehrte, um sich im elterlichen Hause ein eigenes Geschäft als Kaufmann zu begründen, wozu er die Geschäftsräume meines Vaters benötigte.
Meinem Vater bot sich Gelegenheit, ein für seine Zwecke vorzüglich gelegenes Anwesen zu kaufen, in dem Hause des Lohnkutschers Mohr »hinter der Mauer« – so wurde die jetzige Mauerstraße damals genannt. Mein Vater hatte die Postarbeit, d.h. die Postwagen anzustreichen und zu lackieren, die, zur Thurn und Taxisschen Post gehörig, hellrote Farbe trugen; durch den Umstand, daß das Haus unmittelbar an das Postgebäude stieß, fielen die bisherigen, immerhin zeitraubenden Transporte der Fahrzeuge fort; das Geschäft lag also bequemer und vorteilhafter für meinen Vater. Dazu kam noch, daß ihm viel größere Werkstattsräume zu Gebote standen. Außerdem gehörte zum Hause ein großer, schöner Garten mit mächtigen Obstbäumen, wovon ich später noch erzählen werde.
Wir zogen also aus dem »Halben Mond« in das nunmehr zum Eigentum erworbene Haus »hinter der Mauer«; ich war bei diesem Umzug auch tätig, denn ich trug unseren Kanarienvogel in seinem Vogelbauer von der Müllergasse bis in unser neues Quartier.
Im »Halben Mond« traten nunmehr wesentliche Änderungen ein; die Ausspannwirtschaft wurde aufgegeben; mein Großvater, der inzwischen Witwer geworden war, nahm die jüngste unverheiratete Schwester meines Vaters – die Tante Minchen – zu sich zur Führung seines kleinen Hausstandes und behielt seine Wohnung in der kleineren Hälfte der ersten Etage. Die andere Hälfte und die gesamten Geschäftsräume bekam Onkel August zur Verfügung gestellt. Die Gaststube wurde zum Kaufmannsladen für ein Kolonialwarengeschäft [18] umgebaut und eingerichtet mit dem Eingang direkt von der Straße. – Für uns Jungen waren die Einrichtungen im Laden etwas neues; wir staunten u.a. die Messingwagen an, die über dem der Länge nach im Laden stehenden »Träsen« zum Auf- und Abziehen mittels polierten Messing-Gegengewichten hingen. Auf dem äußeren Ende des Träsens stand ein in Fächer abgeteilter, flacher Schaukasten, der, mit einem Glasfenster gedeckt, in abgeteilten Fächern Zigarren enthielt, die mit der Preisangabe von 2 bis 6 Hellern pro Stück in verschiedenen Qualitäten sortiert waren, wovon für die Müllergässer Kundschaft die billigeren 3–4 Heller-Zigarren die begehrtesten waren.
Zugleich mit dem Detailgeschäft verband mein Onkel ein Engros-Geschäft in Landesprodukten und Kolonialwaren, das sich später zu einem der größten Fruchtgeschäfte am Platze erweiterte. – In der früheren Remise meines Vaters waren die Kolonialwaren in Kisten, Fässern oder Säcken gelagert, und wir Jungen wußten immer mit besonderer Findigkeit die Säcke usw. aufzuspüren, die Zucker (Kochzucker) oder Mandeln, Rosinen und besonders Kakaobohnen enthielten. Wir benutzten oft die Gelegenheit, wenn das Lager nicht abgeschlossen war, uns in demselben etwas zu schaffen zu machen und uns aus den Säcken durch etwa vorhandene Löcher, die so viel erweitert wurden, daß man mit den Fingern etwas heraus »kriebelen« konnte, Rosinen, Kakaobohnen usw. verstohlen in die Taschen zu bugsieren. Diese Handlungsweise, dies »Schnucken«, wurde aber manchmal bitter bestraft, wir überluden uns den Magen und hatten dann den Jammer der Verzweiflung eines gewissen Dichters zu erleiden. Das geschah uns aber ganz recht – denn »Strafe muß sind!« Mit diesem Sündenbekenntnis, das noch zu meinen Erinnerungen aus der Müllergasse gehört, verlasse ich den Schauplatz meiner frühesten Jugendjahre und komme zu meinen Schuljungenerlebnissen »hinter der Mauer«.
[19] 2. Hinter der Mauer.
[2.1 Die nördliche Altstadt]
Hier klicken (→) für die Website des Geoportals der Stadt Kassel, auf der man historische Stadtpläne mit einem aktuellen Plan überblenden kann.
Ehe ich von meinen persönlichen Erlebnissen »Hinter der Mauer« erzähle, will ich versuchen, unsere Stadt zu schildern, wie sie damals aussah, und will diese Schilderung beginnen, ausgehend von unserer neu erworbenen Behausung. »Hinter der Mauer« hieß früher die jetzige Mauerstraße, weil die alte Stadtmauer von der Cölnischen Straße bis zur Hohentorstraße eine Seite der Straßen bildete, in die nur das Spritzenhaus und die Postscheune eingebaut war; die gegenüberliegende Seite vom alten Postgebäude, an das unser Haus stieß, bis zur Hohentorstraße – mit Ausnahme des neuerbauten Realschulgebäudes – bildeten einstöckige, gleichmäßige Mansardenhäuser, mit je einem, um einen Stock höher geführten Giebel in der Mitte. Eines von diesen Häusern war das unserige, das die Front der jetzigen Häuser Mauerstraße 2 und 4 einnahm. – Unserem Hause gegenüber lag die »Postmiste«, daneben der noch jetzt stehende Pferdestall. Aller Mist, den man aus den Pferde-Stallungen der Post täglich herausschaffte – ein größerer hatte seinen Ausgang direkt auf der Straße, gegenüber dem »Hotel zum König von Preußen« –, wurde auf der »Postmiste« gelagert und dampfte, je nach der Menge, die angehäuft war, jahraus, jahrein, seine duftenden Wolken in die Luft. Auch wir hatten besonders bei Westwind dies Parfüm in unseren Zimmern und mußten, wie auf einem Bauerngute – landlich, schändlich – diese Düfte aufriechen – ; es sollte ja auch sehr gesund sein, wie allgemein behauptet wurde – schön aber war es nicht.
[2.2 Militärfriedhof und Gardekaserne]
Die alte Stadtmauer, beginnend neben dem Eckhause an der Cölnischen Straße, und von dort weiter am alten Totenhof [20] entlang, bis zur Hohentorstraße führend, hatte aneinander gereihte, durch Pfeiler getrennte, überwölbte tiefe Nischen, die zu nächtlichen Stelldicheins und allerhand intimen Verrichtungen benutzt wurden, was gerade keine besondere Annehmlichkeit für unsere Straße war – – was könnten diese Nischen wohl alles erzählen, wenn sie noch vorhanden wären?! – An der Hohentorstraße endete die Straße, vor dem alten Militärfriedhof, von dort ging sie weiter um den alten Totenhof herum in den oberen und unteren grünen Weg, beide so genannt, weil sie zwischen mit Hecken eingefriedigten Gärten hindurch führten. Der alte Militärfriedhof lag unmittelbar hinter der Kaserne des Kurhessischen Garde-Regiments, an der Stelle, wo jetzt das Gebäudedreieck zwischen der Lutherstraße und Giesbergstaße sich befindet; es war ein wüster, wildbewachsener Friedhof mit nur einigen besser gepflegten Gräbern. Die meisten Grabdenkmäler, Kreuze usw. standen außer Lot und waren mit Moos bewachsen oder verrostet. Der gegenüber liegende große alte Totenhof, wo jetzt die von Professor Schneider erbaute Lutherkirche steht, befand sich in einer etwas besseren Verfassung; er war unser Tummelfeld, auf dem wir uns mit der Straßenjugend aus der Nachbarschaft zusammenfanden und recht oft die Heiligkeit der Stätte durch Spiel und wüsten Lärm störten, bis wir vom alten »Raubold« – so hieß der im Spritzenhaus wohnende Stadtbauaufseher – vertrieben wurden.
An der Hohentorstraße entlang stand ein Flügel der kurhessischen Gardekaserne; er bildete die westliche Seite des Gesamtkasernements, das an der unteren Königsstraße den großen quadratischen Exerzierplatz umrahmte (siehe erste Ansicht von »Cassel aus der Vogelperspektive«). In der Mittelaxe der parallel der Königsstraße den Exerzierplatz nach Norden abschließenden zweiten Gardekaserne stand das große Exerzierhaus, welches, mit einem runden, tonnenförmigen Dach abgedeckt, weit nach hinten in den alten Militärfriedhof hineinragte. Das Leibregiment lag in den Gebäuden südlich, [21] längs der Königsstraße von der Hohentorstraße bis zur »Faxalle«, so wurde die obere Bremerstraße genannt. – Die vierte, östliche Seite des Quadrats bildete die Jägerkaserne, die in der Flucht der jetzigen Jägerstraße stand; hinter dieser befand sich der Exerzierplatz für das Jäger-Bataillon, der sogenannte Jägergarten. Dieser war, mit mächtigen Akazien bäumen bestanden, an der Königsstraße mit einem weiß gestrichenen Holzgitter eingefriedigt. – Daß die Schützenkaserne sich am Wall befand, ist im ersten Kapitel berichtet.
[2.3 Die alte Stadtmauer]
Alte Bilder der Stadttore ((→) / Universitäts-Bibliothek Kassel)
• Das Holländische Tor (die im Buch abgebildete Zeichnung von P. Fasshauer, 1876)
• Das Weißensteiner Tor (Königstor, die im Buch abgebildete Zeichnung von P. Fasshauer, 1876)
• Das Weißensteiner Tor (Königstor, Foto von Carl Machmar)
((→) / Universitäts-Bibliothek Kassel)
• Die Frankfurter Straße hinter dem Frankfurter Tor, aufgenommen vom Weinberg um 1880.
Nicht nur an der Straße vor unserem Hause, sondern noch an vielen Stellen war die alte Stadtmauer erhalten, u.a. an der jetzigen Giesbergstraße, Wolfhagerstraße hinter dem Militärfriedhof; ferner am Leipziger-, Frankfurter- und alten Wilhelmshöher-Tore, anschließend an die damals noch bestehenden Stadttore (s. Abbild.).
[Zwischen den Seiten 22 und 23:]

Das holländische Tor mit dem Blick in die Stadt.
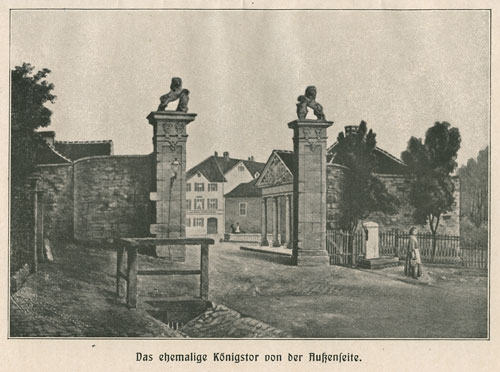
Das ehemalige Königstor von der Außenseite.
Vor jedem Tore stand ein massives Wachtgebäude, dort zogen täglich Militärwachen auf. Abends Schlag 10 Uhr wurden die Tore für Fuhrwerk geschlossen; nur Fußgänger konnten eine kleine Pforte im Tore passieren, durch welche man über einen etwa fußhoch über der Erde die Tür sperrenden Holzriegel schreiten mußte. Passanten wurden vom Posten mit der Frage: »Wer da?« barsch angerufen, worauf sie mit: »Gut Freund!« antwortend das Tor passieren konnten.
[2.4 Fabriken nördlich der Altstadt]
An der nördlichen Seite der Stadt, außerhalb des »Holländischen Tores«, befanden sich die einzigen größeren Fabriketablissements Cassels, die Waggonfabrik von Thielemann, Eggena u. Co. (später Wüstenfeld) und die Henschelsche Maschinenfabrik. Unser Kurfürst war nämlich kein Freund von Fabrikanlagen in seiner Residenz, die Entwickelung unserer Großindustrie wurde durch diese Marotte arg gehemmt und blieb gegen andere Städte sehr zurück.
Mit welchen erschwerenden Umständen diese beiden Fabriken zu kämpfen hatten, davon kann man sich heute kaum noch einen Begriff machen. Der Transport der Lokomotiven und Eisenbahnwaggons aus den Fabriken zum Bahnhof konnte [22] nur mitten durch die Stadt bewerkstelligt werden. Durch das enge Holländische Tor hindurch, die untere Königsstraße, am Königsplatz entlang und schließlich die sehr steile Cölnische Straße hinauf wurden diese auf sehr stark gebauten, schweren Rollwagen befördert, die je nach der Schwere der Lasten oft mit 60 bis 80 Pferden bespannt waren. Ein solcher Transport, besonders der einer Henschelschen Maschine, war stets ein besonderes Ereignis, an dem wir Jungen mit besonderem Interesse teilnahmen. Der Rollwagen mit seiner Riesenlast wurde fortgezogen vermittels einer starken eisernen Kette von oft mehr wie 100 Meter Länge, an der die Zugschwengel für die Pferde befestigt waren. Das laute Kommando zum Anziehen der gewaltigen Bespannung wurde jedesmal entweder vom Fuhrmann Volmar oder Fuhrmann Horchler gegeben, beides waren wohlhabende Fuhrherren, die aber nicht anders wie im blauen Mittel einhergingen. Sobald das Kommando erfolgt war, wurden die Pferde mit hundertstimmigem »Hühott«, in das wir Jungens mit einstimmten, und einem Peitschenkonzert von 20 bis 30 Peitschen angetrieben. So ging es in flottem Tempo zum Holländischen Tor, den Straßenecken am Königsplatz usw. An diesen Punkten stellten sich wegen der engen Passage oder der nötigen Drehungen meist größere Schwierigkeiten in den Weg, daß es oft – besonders bei Senkungen des Straßenpflasters – den ganzen Tag dauerte, bis diese überwunden waren und die Maschine endlich glücklich auf dem Bahngeleise des Bahnhofes stand. – Erst nach Anlage des Unterstadtbahnhofs 1871, mit welchem die Fabriken durch Schienenstrang in der Wolfhagerstraße verbunden waren, konnten die Maschinen auf bequeme Art zur Bahn befördert werden.
[2.5 Bebauung nördlich der Stadtmauern]
Außerhalb der Stadtmauern war die Bebauung eine sehr geringe, es befanden sich nur an den Hauptlandstraßen vereinzelte Wohnhäuser mit Gärten. Eine große Anzahl wohlhabender Bürger besaß eigene große Gärten in nächster Nähe der Stadt. Die Anlage dieser Gärten war fast überall gleichartig [23] – durch die Mitte führte ein schnurgerader Weg, auf dessen beiden Seiten mit Buxbaum eingefaßte Rabatten für den Blumenflor bestimmt waren; Centifolien und Moosrosen, awechselnd mit »Badunjen« (Petunien) oder Malven überragten reich blühende Levkojen, Reseda, Ästern, Balsaminen, Rittersborn u.a. oder Tulpen und »Studenten« (weiße Narzissen), die in buntem Gemisch die Rabatten ausfüllten. Hinter den Rabatten lagen die Gemüsebeete, umstanden mit Beerensträuchern und Obstbäumen und an der Grenze war das »Buschkett« mit »Zirehnen«-, »Schasmin«- und anderen Sträuchern. Am Garteneingang standen oftmals »Kerlebeer«-Bäume, deren kirschenähnliche Beeren eine Naschfrucht der Jugend waren. Tannen und Kiefern kamen seltener vor, andere Conferen überhaupt noch nicht. Im Mittelpunkt auf einem freieren Platze mit besserer Umgebung standen das Gartenhaus oder auch Lauben, und dort wurden im engeren Familien- und Freundeskreise mancherlei Festlichkeiten im Freien abgehalten. Außer diesen privaten Gärten fand die Bürgerschaft Gelegenheit zu geselliger Vereinigung, an denen auch die Damenwelt teilnehmen konnte, in der großen Anzahl der Wirtschaftsgärten, darunter die drei herrlich gelegenen »Felsenkeller« am Weinberg – jetzt Henschelsche Besitzung –, der »Kegelgarten«, »Schaumburgs«-, »Schmidts«-Garten usw., die sämtlich auf dem Gebiete lagen, das jetzt von der Weinberg- und Humboldtstraße sowie der Terrasse und oberen Sophienstraße durchschnitten ist. Ferner bestand noch das »Hangelicht« in der Cölnischen Allee, »Cimiotti« in der cölnische Straße. Ecke der Rosenstraße, dessen Biergarten wegen seiner bayerischen Biere in Flaschen und seiner vorzüglichen »Büffsteks« den besten Ruf hatte. An der Holländischen Straße, die vom Tore ab bis zum neuen Friedhofe eine Pappelallee mit alten hohen Bäumen bildete, war gleich vornan links die Östreichsche Gastwirtschaft, weiter hinaus dem Friedhofe gegenüber die Klaussche Wirtschaft, wo’s Äppelwein gab – am Möncheberg der »Bunte Bock«, der »Leimenkeller« und die [24] »Kaffeemühle«, jetzt Park des Landkrankenhauses. In dem Garten der »Kaffeemühle« befand sich ein Sommertheater, auf dem eine gute Truppe mimte, ich sah dort »Geck und Guste« und »Die Karlsschüler«. Außerdem exzellierten dort noch Seiltänzer wie Kolder, Weitzmann u.a. Auch den ersten Luftballon sah ich dort aufsteigen. – Für kleine Bürgersleute gab es Wirtschaftsgärten, denen im Volksmunde teils recht ominöse Namen beigelegt wurden, wie »zur geschwollenen Ratte«, dem »blutigen Knochen«, dem »letzten Heller« u.m.
[2.6 Wie man zur Wilhelmshöhe fuhr]
Der Besuch unserer Wilhelmshöhe war damals nur an Sonn- und Festtagen, besonders zu Himmelfahrt und Pfingsten, ein reger, an den Wochentagen war es oben still. Der Kurfürst residierte von Mitte Mai bis Ende September im Schloß, zu dem das Publikum keinen Zutritt hatte. Die Casseler Bevölkerung oder fremde Besucher pilgerten meist nur an den Wassertagen zu Fuß hinaus. Das Vehikel »die Droschke«, das jetzt jedem Fahrlustigen zu Diensten steht, war damals noch unentdeckt, den Luxus eigener Equipagen erlaubten sich aber die wohlhabendsten Bürger kaum, selbst wenn sie es konnten; unser Kurfürst war auch nicht dafür. Wer vom bürgerlichen Volk fahren wollte, mußte den Lohnkutscher in Nahrung setzen und sich mit einer Kalesche oder einem char à bancs (Kremser) begnügen; Landauer kannte man noch nicht.
Dagegen herrschte ein vornehmer Verkehr mit herrschaftlichen Equipagen des Hofes, der Gesandten und auch des hessischen Adels. Der Kurfürst fuhr stets sechsspännig, seine Gemahlin vierspännig täglich ein, auch zwei mal von Wilhelmshöhe nach Cassel. Das Leben und Treiben in der Stadt selbst war durch die starke Garnison und die prunkvolle Hofhaltung in vieler Beziehung ein interessanteres und angenehmeres wie heute, trotzdem Cassel nur 36.000 Einwohner zählte.
[2.7 Das verwahrloste Kassel]
Das Ansehen der Stadt dagegen machte einen verwahrlosten und verkommenen Eindruck. Gärtnerische Schmuckanlagen im Innern der Stadt, die heute, sorgsam unterhalten, unsere freien Plätze an vielen Stellen zieren, gab es nicht, ebensowenig [25] wohlgepflegte Wege und Rasenplätze, das Gras konnte überall ungehindert da wachsen, wo es nicht durch den Verkehr niedergetreten wurde. Für die Instandhaltung der öffentlichen Gebäude geschah nur das allernotwendigste; die Außenfronten waren verwittert, oft mit abgefallenem Putz usw. Unser schönes Orangerieschloß war in einer geradezu jammervollen baulichen Verfassung; die Außenarchitektur, soweit sie geputzt war, bestand nur aus Bruchstücken, aus denen man die Gliederungen und Skulpturen kaum noch erkennen konnte; fast alle Fensterscheiben waren zertrümmert, die völlig verrosteten Dachkandeln waren durchlöchert durch Bajonettstiche, von der Wachtposten in unbelauschten Stunden verübt. Im Innern war es ebenso, überall sah man das rohe Mauerwerk, der Fußboden bestand aus tief ausgelaufenen roten Backsteinplatten. – Und so stand es mit den meisten öffentlichen Bauten, die nicht zur Hofhaltung gehörten.
Unser Kurfürst hatte leider das Erbe seiner Väter nicht angetreten, er war nicht baulustig wie diese, denen wir Bauwerke von seltener Großartigkeit zu danken haben. Seine Königliche Hoheit sparte alles für seine Familie, deren Angehörige, weil aus morganatischer Ehe stammend, nach seinem Tode keine Apanagen vom Staate zu erwarten hatten.
Dem bösen Beispiel, das der Kurfürst durch seine Sparsamkeit in dieser Beziehung gab, folgten auch die Bürger; sie legten keinen Wert auf das äußere Ansehen ihrer Häuser; bei dem äußerst schlechten Geschäftsgang der damaligen Zeit waren allerdings auch die Mittel für äußere Instandhaltung der Häuser sehr knapp. Neubauten wurden überhaupt keine ausgeführt; erst mit der Erbauung des neuen Bahnhofs, Mitte der 50er Jahre, fing die Bautätigkeit an, sich zu regen, es entstanden die ersten Neubauten an der neu angelegten Bahnhofstraße, denen solche am Ständeplatz, an der Cölnischen Straße und in der Wilhelmshöher Allee folgten. Von diesen Neubauten wurden die nach den Plänen des jungen begabten Architekten Fritz Potente ausgeführten am meisten bewundert.
[2.8 Post und Verkehrsverhältnisse]
Das Foto des Postgebäudes der Abbildung im Buch stammt von Carl Machmar. Hier klicken (→) für einen Scan des Original-Fotos. (Universitäts-Bibliothek Kassel)
Zwei Links auf Fotos vom Hof des alten Postgebäudes am Königsplatz: • Hier klicken (→) für ein Foto von Georg W. Förster: Blick aus dem Seitenflügel an der Königsstraße zum Seitenflügel an der Poststraße (links hinten), mit dem schmalen gebogenen Hintergebäude an der Grundstücksgrenze. • Hier klicken (→) für ein Foto von Carl Machmar in der Gegenrichtung, man erkennt im Hintergrund den Druselturm und rechts das Hauptgebäude am Königsplatz, links wiederum das schmale Hintergebäude. (Universitäts-Bibliothek Kassel; für die Bild-Erklärungen Dank an Dr. Christian Presche)
[26] Am Königsplatz stand das alte Postgebäude, ein schmuckloser Fachwerksbau (s. Abbild.), von dessen dürftiger Einrichtung für die Verkehrsverhältnisse mit dem Publikum man sich heute keinen Begriff mehr machen kann. Der Postverkehr in der Stadt beschränkte sich auf die Brief- und Paketpost; Telegraph oder Fernsprecher waren Dinge, die man noch nicht ahnte, denn die Wunder der Elektrizität, die die Welt später in Staunen setzten, waren der Menschheit damals noch nicht offenbart.
[Zwischen den Seiten 26 und 27:]

Das ehemalige Postgebäude am Königsplatz.
Dagegen spielte die Personenbeförderung nach auswärts durch die Post in damaliger Zeit eine große Rolle. Vom Posthofe im Postgebäude fuhren zu bestimmten Stunden die Fahrpostwagen der Thurn und Taxisschen Post, die in einem großen Teile Deutschlands das Reichspostmonopol hatte, mit ihren hellrot angestrichenen Postwagen nach den benachbarten Städten ab. – Nach einem schmetternden Trompetensignal fuhr der Postwagen aus dem Fahrtor des Postgebäudes im Trabe heraus, besetzt in qualvoll fürchterlicher Enge mit Männlein und Weiblein, und oben auf dem Wagen und hinten drauf lagerte, wohlverschnürt, das Reisegepäck.
Das Abfahrts- und Ankunftssignal:

Abfahrtssignal. |
Ankunftssignal.
hörten wir als nächste Nachbarn der Post alltäglich, oft in virtuoser Weise von geübter Trompeterschnutte geblasen, dann aber auch wieder von anderen in entsetzlicher Weise mit überschnappenden falschen Tönen aus der Trompete herausgequält.
[2.9 Hallengebäude und »Kattenburg«]

»Ansichten von Cassel. Verlag von Gustav Liersch & Co., Berlin. Auethor«.*MA
Hier klicken (→), um zu einem Foto des Auetors zu kommen, aufgenommen vom Atelier Rothe »vor 1866«. (Universitäts-Bibliothek Kassel)
Dem Postgebäude gegenüber, an der Stelle, wo jetzt das Schollsche Kaufhaus steht, stand das sogenannte »Hallengebäude«, ein städtisches Gebäude, ebenfalls aus Fachwerk, [27] zweistöckig, ohne sichtbares Dach (s. Abbild. [Kapitel 3.7]). Der äußere Anblick übertraf an Verkommenheit alle übrigen Gebäude der Stadt, weil die Stadt für die Instandhaltung so gut wie gar nichts aufwendete. Hinter dem niedrigen Gebäude ragte der Turm der Garnisonkirche in die Höhe, sodaß die Uhr vom Königsplatz aus sichtbar war.
[Zwischen den Seiten 24 und 25:]

Das Auetor mit einem Blick auf die Kattenburg.
Auf dem Platz, den jetzt das Regierungsgebäude mit den davorliegenden Anlagen einnimmt, stand als kolossale Ruine die im Bau leider liegen gebliebene »Kattenburg«, in seiner geplanten Vollendung als Residenzschloß der hessischen Kurfürsten, ein Bau von so gewaltigen Dimensionen, wie sie kaum ein zweites Schloß im deutschen Reich aufweisen konnte. An dieser Stelle stand ehemals das alte hessische Fürstenschloß, welches unter der französischen Fremdherrschaft Jérôme Napoleons im Jahre 1811 abgebrannt war. Der mächtige Bau der Kattenburg war in seinen Mauern bis zur Kämpferhöhe der Fenster des hochliegenden Erdgeschosses, etwa 8–9 Meter, gleichmäßig hochgeführt, wurde aber nach dem Tode Kurfürst Wilhelms I. eingestellt, weil der Nachfolger, Wilhelm II., der von vornherein gegen diesen Bau gewesen war, ihn nicht weiterführen ließ. Die Außenfassaden hatten eine Verblendung von rotem Sandstein, ähnlich dem am »roten Palais«; das nach 1866 vom Abbruch der gewaltigen Ruine gewonnene Material wurde später zum Bau der neuen Gemälde-Galerie verwendet. Den Unterbau bildete ein Labyrinth von in mehreren Etagen übereinanderliegenden Gewölben, in der Tiefe herab bis zum Niveau des Fuldaspiegels. Unter den Gewölbeflächen hatten sich durch die ungehindert eindringenden Niederschläge wahre Stalaktiten von Salpeter gebildet; in den vielen Maueröffnungen nistete allerlei Gewürm, und die Fledermäuse hatten hier ihr Hauptquartier für die ganze Stadt eingerichtet. Heute sieht man kaum noch Fledermäuse, die damals im Dämmerlicht in unserer Stadt ungezählt herumflatterten und bei offenen Fenstern bis in die Zimmer sich verirrten.
Die unterirdischen Gewölbe der Kattenburg boten außerdem noch anderem lichtscheuen Gesindel sicheren Schlupfwinkel; [28] auch die unternehmungslustige Jugend der angrenzenden Stadtteile führte hier die verwegensten Streiche aus oder trieb allerhand Allotria, womit sie sich dann brüstete. Eine wahre Schauerromantik hatte sich in den Köpfen der Casseler Jungen herausgebildet über alles das, was es da unten fürchterliches gäbe. Die eiserne Jungfrau, die ihre Opfer in der Umarmung mit hundert Dolchen durchbohrte und dann in einem Schacht für immer verschwinden ließ, sollte ihr grausiges Gemach in dem runden Turm, der heute noch als Rest des alten Bauwerks an der Fulda besteht, gehabt haben.
[2.10 Exerzierplatz, Friedrichsplatz, Bellevue]

Der Friedrichsplatz, Blick nach Süden, ca. 1870. In der Häuserzeile links in der Mitte das Fridericianum. Rückseitendruck: »E. Stiegel. Cassel. Der Friedrichsplatz. Verlag u. Eigenthum v. A. Freÿschmidt, Cassel, Königsplatz 40.«*MA

Die Theaterstraße, im Hintergrund der Friedrichsplatz (aus einem Prospekt von 1908).*MA

Als man noch Autos in Fotos hinein- und noch nicht aus ihnen herausretuschierte: Ladengeschäft in der Theaterstraße (aus einem Prospekt von 1908).*MA
Vor der Kattenburg, nach dem Friedrichsplatz zu, jetzt zur Kriegsschule gehörend, war eine freie, mit Bäumen eingefaßte Hutefläche. Auf dieser hielt unsere Infanterie, besonders die Jäger, ihre Felddienst-Exerzitien ab, die der damaligen Zeit entsprechend keine so ungeheueren Flächen erforderten, wie heutzutage. Wir Jungen wohnten mit besonderem Interesse diesen Übungen bei, zumal wenn irgend ein Bekannter mitübte. An den Tagen, wo nicht geübt wurde, ließen wir kleineren Jungen die Drachen dort steigen.
[Zwischen den Seiten 28 und 29:]
Der Friedrichsplatz war bis in die neueste Zeit noch fast unverändert wie damals, nur an Stelle des Residenzcafés stand das Palais des Prinzen Georg von Hessen, später das von Dörrsche Haus. Inzwischen ist an Stelle des Auetors das neue Königliche Theater nach den Karstschen Plänen erbaut und an Stelle des alten Theaters (s. Abbild.) eine Verbindungsstraße zwischen Opernplatz und Wolfsschlucht angelegt. Dagegen hat die Bellevue, jetzt Schöne Aussicht, eine wesentliche Änderung erfahren. Der Name der Straße hatte nur seine Berechtigung für die Bewohner der oberen Geschosse der die eine Seite der Straße einnehmenden Häuser, denn diese konnten nur die Aussicht genießen. Von der Straße aus hatten die Spaziergänger keinen freien Ausblick wie jetzt in die schöne Umgebung, weil ein hohes, dichtes, eisernes Gitter auf die ganze Länge der Straße, vom Wachtgebäude bis an das Tempelchen, die Aussicht vollständig versperrte. Eine Verbindung [29] der Bellevue mit der Aue war auch nicht vorhanden. Hinter dem Gitter, in dem dichten Gebüsch des Abhanges, flöteten zahlreiche Nachtigallen ihr melancholisches Abendlied, sie wurden nicht gestört, denn dort verkehrte fast niemand, außer Liebespärchen. Die reizvolle Promenade mit dem erschlossenen wundervollen Blick, der sich heute dem Auge bietet, haben wir unserem Oberpräsidenten v. Möller zu verdanken, der während seiner Amtsperiode das Gitter von den jetzt noch stehenden Sockelmauern entfernen ließ. Das Bellevueschloß enthielt die wertvolle Gemäldequalerie, für die, ebenfalls auf Anregung unseres verdienstvollen Oberpräsidenten, der spätere Neubau errichtet wurde. Die Besichtigung dieser Galerie war damals dem großen Publikum versagt, nur durch Vermittelung des Kastellans und unter dessen Führung konnte man sich an den kostbaren Kunstschätzen erfreuen.
[2.11 Frankfurter Tor und Friedrichstraße]
Siehe die Abbildungen von Kasseler Stadttoren im Kapitel 2.3.

Die Obere Karlsstraße, beim heutigen Elisabeth-Krankenhaus (aus einem Prospekt von 1908).*MA
Den oberen Abschluß der Gebäudereihe der Bellevue bildete ein langer, massiver nüchterner Sandsteinbau, in dem das kurhessische Landgestüt sich befand. Die ausgedehnten Stallungen nahmen das ganze Erdgeschoß ein, darüber war nur ein Geschoß mit Wohnungen für die Beamten, von denen einer, der Sekretär des Landgestütes, mein Onkel Henkel war. Der Eingang zum Landgestüte war von der Frankfurter Straße, dicht neben dem Frankfurter Tor (s. Abbild.), die Friedrichstraße war noch nicht durchgeführt, sie endete an der Frankfurter Straße. Außer dem langen Hauptgebäude standen dort noch mehrere Fachwerkgebäude, worin die Marställer wohnten, und eine große Reitbahn auf dem mit einer Mauer umschlossenen Gebiet des Gestütes. Wir verkehrten hier viel mit unseren Vettern und lernten alle die berühmten Zuchthengste kennen, prachtvolle Tiere, die wir oft bewunderten.
[Zwischen den Seiten 30 und 31:]
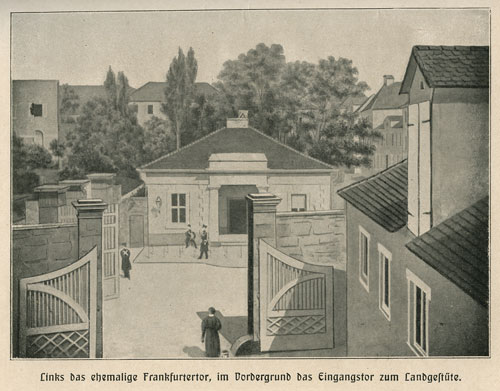
Links das ehemalige Frankfurtertor, im Vordergrund das Eingangstor zum Landgestüte.
In der Reitbahn konnte man unter Aufsicht des alten bärbeißigen, aber dabei doch gutmütigen Stallmeisters Credé das Reiten lernen, weil die vielen Pferde jeden Tag bewegt werden mußten; wir Jungen hatten unser Vergnügen beim Zusehen.
Die Friedrichstraße bildete den Abschluß des Stadtgebietes zwischen Frankfurter- und Königstor (altes Wilhelmshöhertor); [30] an deren westlicher Seite stand die alte kurfürstliche Akademie (später Furtmannsches Haus), daneben die Arnoldsche Tapetenfabrik, jenseits des Rondels das Palais der Prinzeß Caroline von Hessen, Schwester des Kurfürsten, das jetzige Oberpräsidium. Sonst schloß sich ein weites Gebiet eng zusammenliegender Gärten zwischen der Frankfurter Straße, der neuen und alten Wilhelmshöher Allee an, zwischen denen schmale Heckenwege hindurchführten. Einen besonderen Ruf genoß darunter der Schellhasesche Garten, später dem Fabrikant Hirsch gehörend, der einzige Garten in der Stadt, der für damalige Verhältnisse durch seine vorzügliche Kultur sich besonders auszeichnete und als Sehenswürdigkeit besucht wurde. Jetzt steht dort das Elisabethkloster und anstoßende Häuser in der Weinbergstraße.
[2.12 Wilhelmshöher Tor, Garde-du-Corps-Kaserne, Ständeplatz]
Zwischen dem alten Wilhelmshöhertor und der Garde du Corps-Kaserne, etwa auf dem Platz wo jetzt die Luther-Eiche steht, war ein umfriedigter Teich – der Pferdeteich – in den die Pferde der Garde du Corps zur Schwemme geführt wurden. Wir Jungens fingen aus diesem Teich Schwimmkäfer und Molche in unsere bescheidenen Aquarien, zu denen wir größere Medizinflaschen oder Einmachegläser verwendeten.
Hinter der Garde du Corps-Kaserne, außerhalb der Stadtmauern, auf dem später verlängerten Ständeplatz, war eine grüne Hutefläche mit einem kreisrund mit hohen Pappeln umpflanzten Platz; dort standen die Zirkusbuden der »englischen Bereiter« (so nannte man damals die Kunstreiter), wenn eine solche wandernde Truppe in Cassel Vorstellungen gab. Außerhalb dieses Platzes standen zur Meßzeit die übrigen Schaubuden, für die nötigenfalls noch der sogenannte Kadettenplatz, zwischen dem Zwehrener Turm und dem Kunstgewerbemuseum, eingeräumt wurde.
Das Terrain des jetzigen Hohenzollernviertels bestand ebenfalls aus großen an die Stadt angrenzenden Privatgärten, durchzogen von schmalen Wegen, dem oberen und unteren [31] Karthäuserweg. Einen großen Flächenraum zwischen diesen Gärten nahmen die Lacklederfabriken von Henkel und Brück ein. Die Lacklederfabrikation war eine bedeutende Spezialindustrie Cassels; außer den hier genannten Fabriken bestand noch die Stücksche auf dem Weinberg, deren Fabrikate auswärts sehr gut eingeführt waren. Diese damals so blühende Industrie ist leider hier eingegangen, allerdings zum Vorteil der reinen Luft, denn die Gerüche waren nicht immer schön.
Der alte Ständeplatz, zwischen der Wilhelms- und der Cölnischen Straße, hatte keine weiteren Straßenzugänge wie diese beiden. Am oberen Ende, wo jetzt das Lesemuseum sich befindet, stand die sogenannte »Engelsburg«, eine Villa, die dem Hofbaurat Engelhardt gehörte. An der Ecke der Wilhelmsstraße und Wolfsschlucht standen zwei alte Fachwerksbauten, das »Jacobs- und Süsterhaus«, vielleicht nach ihren Stiftern so benannt.
[2.13 Altstadt: Martinskirche, Straßenpflaster, Druselteich]
Hier klicken (→) für ein Foto der Martinskirche mit der barocken Turmhaube, vor dem Umbau »in gothischem Stile«. (Universitäts-Bibliothek Kassel)
Hier klicken (→) für ein Foto der Martinskirche während des Umbaus: Der Nordturm wird errichtet. (Universitäts-Bibliothek Kassel)

Stereofoto von 1906: Blick vom neugotischen Südturm der Martinskirche nach Norden.*MA
Martinskirche: Siehe auch das Kapitel »5.17 Bürger-Feuerwehr«.

»alter Brunnen am Brink, abgerissen 1906« Foto von Carl Machmar, 1894.*MA
Das Innere der Altstadt hat sich wenig verändert, mit Ausnahme des Straßendurchbruchs der Philippstraße, der Anlage des Philipp-Platzes und der Durchführung des Pferdemarktes bis zur Königsstraße, sind weitere Veränderungen neueren Datums. Erwähnt sei noch besonders der Umbau der Martinskirche, die zwei neue Türme in gothischem Stile erhielt, deren früherer Turm aber charakteristisch im Stadtbilde Cassels war. In der Wetterfahne war eine Glocke angebracht, die bei stürmischem Wetter erklang. Diese Glocke über dem Turm gehörte zu den Wahrzeichen der Stadt (s. Abbild. [Kapitel 5.17]). Außerdem ist der Brinkbrunnen, irrtümlich auch »Judenbrunnen« genannt, ein interessantes Merkmal der inneren Stadt, verschwunden (s. Abbild.).
[Zwischen den Seiten 32 und 33:]
Mit diesen Schilderungen unserer Stadt diesseits der Fulda abschließend, sei noch erwähnt, daß der Ruf Cassels mit Bezug auf das Straßenpflaster ein sehr zweifelhafter war, das Casseler Pflaster war geradezu sprichwörtlich berüchtigt. Fußsteige mit Plattenbelägen waren nirgends vorhanden, nur bestenfalls solche mit gepflasterten Reihensteinen, wie sie heute [32] noch an manchen Stellen bestehen. Die obere Königsstraße vom Königsplatz bis zum Rondel, hatte überdeckte Druseln, sogenannte »Strichkanäle«, zur Abdeckung waren eichene Bohlen in gefalzte Sandsteine gelegt, die jedesmal auf Bohlenlänge durch einen eisernen Querriegel gehalten wurden. Im Winter war dieser Bohlenbelag die schönste »Glietebahn«, die von Jung und Alt benutzt wurde.
Außer dem schon erwähnten Pferdeteich war in der Stadt noch ein zweiter Teich vorhanden, der »Druselteich«, der auf dem jetzigen Druselplatz sich befand. Ringsum mit eisernem Staket auf einer Sandsteinsockelmauer umgeben, nahm er bis auf schmale Fußwege vor den Häusern, fast den ganzen Platz ein; seine Oberfläche war dicht grün mit Wasserlinsen überzogen. Der Teich wurde von der Druselwasserleitung gespeist und diente als Reservoir zur Wasserversorgung bei ausbrechenden Bränden; jetzt ist er noch als unterirdisches Reservoir vorhanden.
[2.14 Unterneustadt]

Die Fuldabrücke mit Blick auf das »Dörfchen« (aus einem Prospekt von 1908).*MA
Cassel jenseits der Fulda, die Unterneustadt, wurde das »Dörfchen« genannt, eine Bezeichnung, die die alten Casselaner auch heute noch anwenden. Der Mittelpunkt war, wie noch heute, der Holzmarkt; mit dem Leipziger Tor, am Eingang der Leipziger Straße, war dieser Stadtteil abgeschlossen. Außerhalb des Tores war die Straße nach Bettenhausen wenig angebaut. Auf dem Weg zum Landkrankenhaus, jetzt Salzmannshof, kam man nur am »Siechenhof« vorbei, von dem der Volkswitz erzählt, daß dort die Kartoffelpfannkuchen nur auf einer Seite gebacken wurden – auf der anderen Seite standen nämlich keine Häuser. Derzeit bestand nur eine Verbindung zwischen Ober- und Unterstadt, die »alte Fuldabrücke« (s. Abbild.), die in ihrer malerischen Wirkung für das Stadtbild nicht ohne Reiz war.
[Zwischen den Seiten 34 und 35:]
So sah es in unserem lieben Cassel aus bis gegen Mitte der fünfziger Jahre, zu welcher Zeit mit dem Bau des für damalige Verhältnisse großartigen Bahnhofsgebäudes begonnen wurde; damit trat eine Wandlung zum Besseren ein, unsere Stadt ging endlich einer aufsteigenden Entwickelung entgegen.
[2.15 Bahnhof]
[33] Für die Anlage des Bahnhofs war der Wille unseres allerhöchsten Landesherrn entscheidend, aber leider zum Nachteil der Stadt. Anstatt mit Rücksicht auf die vom Fuldatal am Berge sich hinaufziehende Stadt den Bahnhof in der mittleren Höhenlage als Durchgangs-Bahnhof anzulegen, wurde er hoch über der Stadt am Kratzenberg als Sackbahnhof erbaut. Unser eigenwilliger Kurfürst hatte befohlen, daß das neue Bahnhofsgebäude in direkter Verbindung mit dem schönsten Stadtteil, am Friedrichsplatz, gebracht werden sollte; er bestimmte, daß die Mitte des Hauptportals in die verlängerte Achse der am Friedrichsplatz vorbeiführenden Straße, deren Durchbruch im Stadtplan aufgenommen war, liegen sollte; die neue Verbindungsstraße vom Bahnhof nach der Cölnischen Straße wurde infolge dieser Bestimmung nach der Flucht des Museums angelegt und erhielt den Namen »Museumsstraße« (jetzt Kurfürstenstraße), der ihr bis in die neueste Zeit verblieben ist.
Es ist nicht zu verkennen, daß dieser Plan von unserem Kurfürsten äußerst glücklich ersonnen und für das innere Bild unserer Stadt von eminenter Bedeutung war! Vom Austritt aus dem Bahnhof hätte man nach Vollendung der Straße sofort den herrlichen Blick auf den landschaftlich schönen Hintergrund, dem Söhrewald, gehabt. Die Straße hätte direkt in den schönsten und vornehmsten Teil unserer Stadt geführt, der jetzt nur erschwerend auf Umwegen aufzufinden ist. Daß dieser Plan nicht zur Ausführung kam, haben wir leider der Engherzigkeit und Kurzsichtigkeit unseres Magistrats zu danken; in den Analen unserer Stadt nimmt der verhängnisvolle, mit der Majorität von nur »einer Stimme« gefaßte Beschluß, die Durchführung der Museumsstraße abzulehnen, kein Ruhmesblatt ein. Gründe: die Kostspieligkeit und weil es in dieser Straße zu viel »Zug« gäbe!! Im Jahre 1867, während ich als Hochbau-Ingenieur bei der Bebra-Hanauer Eisenbahn in Stellung war, trat ich mit voller Ueberzeugung für die damals auf der Tagesordnung stehende Festlegung des Stadtplans zur [34] Durchführung der Museumsstraße ein; in einem längeren Artikel im Tageblatt (Juni 1867) appellierte ich an die Bürgerschaft und die Väter unserer Stadt, leider ohne Erfolg!
Weil sich aber nach der Anlage des Bahnhofes der große Übelstand einer fehlenden näheren Verbindung von diesem nach dem Friedrichsplatz sehr bemerkbar machte, erbettelte man beim Kurfürsten, daß er die Genehmigung zur Herstellung eines schmalen Verbindungsgäßchens vom Theaterplatz nach der Wolfsschlucht erteile. Das geschah, indem vom Garten der Kommandantur ein Streifen zur Anlage der schmalen Gasse hergegeben wurde, die den bezeichnenden Namen »Gnadengäßchen« erhielt.
[2.16 Druckereien]
Nach dieser kleinen Abschweifung in eine spätere Periode will ich meinen Rundgang durch »Alt-Cassel« beenden. Den Gartenpfad entlang, der hinter dem Cimiottischen Biergarten auf den »Weg hinter dem Totenhof« (jetzt Spohrstraße) führt, kehre ich durch das Korngiebelsche Grundstück (jetzt Schombardt) zu meinem Elternhause »Hinter der Mauer« zurück.
Wir bewohnten damals die größere Hälfte der ersten Etage, die bis auf ein gerades Zimmer, unsere »gute Stube«, nur Mansardenstuben hatte. Im Erdgeschoß befand sich die Buchdruckerei und lithographische Anstalt von Theodor Fischer, dem Begründer der später so bedeutenden Verlagsanstalt, ebenso die Wohnung der alten Fischers. An den Wänden des großen Hausflurs lagerten neben einer großen Holzpresse mit vier starken Pfosten aufeinandergeschichtete, mit starken Seilen verschnürte Papierballen. In der Druckerei waren mehrere Handpressen in Betrieb – Rotationsmaschinen schlummerten noch im Kopfe des Entdeckers –. Ich sah immer mit großem Interesse zu; vermittelst einer elastischen breiten Walze wurde die Druckerschwärze über den Schriftsatz gewalzt, darauf das Papier zum Druck aufgelegt. Über dies klappte sich ein Bügel mit Glanzpappe, der so abgedeckte Schriftsatz wurde vermittelst einer Handkurbel zwischen zwei Walzen hindurch und wieder zurückgedreht, damit war der Druck fertig und der Druckbogen [35] wurde mit der Hand abgezogen. Welchen ungeheuren Fortschritt haben uns gegen damals heutzutage die Rotations- und Satzmaschinen, Stereotypie pp. gebracht mit ihren unglaublichen schnellen Riesenleistungen, durch welche die Presse geradezu eine Großmacht von mächtigem Einfluß in der Welt geworden ist. Die öffentliche Presse der damaligen Zeit beschränkte sich auf das Regierungsblatt, die »Casseler Zeitung«, sowie das »Amtliche Wochenblatt«, das in der Waisenhausdruckerei gedruckt wurde, vom Volke das »Wurschteblättchen« genannt.
Nach den Tagen der März-Revolution 1848 erschien das politische Blatt »Neue hessische Zeitung« (spätere Morgenzeitung), herausgegeben von Fr. Oetker, der, ein liberaler Volksvertreter, für Aufrechterhaltung unserer Verfassung kräftig eintrat. Als demokratisches Witzblatt erschien zu gleicher Zeit die von Kellner und Heise herausgegebene »Hornisse«, welche mit ihren Stichen nichts verschonte. Näheres darüber folgt im nächsten Kapitel.
Anfangs der 50er Jahre erschien das Casseler Tageblatt bei Gebrüder Gotthelft, das über politische Ereignisse nur spärliches bringen konnte, der Telegraph stand der Presse nicht wie heute zur Verfügung, er diente wohl zunächst nur zur Sicherheit des Eisenbahnbetriebs; der Öffentlichkeit und zumal der Presse wurde er erst in späteren Jahren zugängig gemacht.
[36] 3. Aus der Zeit meiner ersten Schuljahre 1848–1851.
[3.1 Schulen in Kassel]
Im Jahre 1848 zu Ostern kam ich zur Schule; meine Mutter begleitete mich auf meinem ersten Schulgang in die Realschule, die unserem Hause sehr nahe an der Hedwigstraße sich heute noch befindet; in deren unterster, der neunten Klasse wurde ich aufgenommen. Die damaligen Schulverhältnisse waren der geringeren Einwohnerschaft entsprechend gegen die jetzigen wesentlich andere. Cassel besaß nur zwei staatliche Schulen, die höhere Gewerbeschule eine technische Hochschule von bedeutendem Rufe, die das jetzige Wendtsche Haus am Martinsplatze inne hatte – und ferner das Lyceum Fridericianum als einziges Gymnasium. Die Realschule, derzeit unter Gräfe, war die alleinige höhere städtische Lebranstalt; außerdem unterstanden noch eine Bürgerschule und die Freischulen, letztere für Knaben und Mädchen, der städtischen Verwaltung; weitere öffentliche Schulen gab es nicht, sondern nur Privatschulen; von diesen bereitete die Falckenheinersche Schule die Schüler zum Gymnasialbesuch vor.
Mit der Ausbildung der Töchter besserer Bürgerfamilien befaßte sich der Magistrat unserer guten Stadt damals noch nicht, das blieb den Privatschulen, der Sallmannschen, Jathoschen, Kösterschen und Halberstadtschen Schule, überlassen. Die Ansprüche an die wissenschaftliche Bildung, die heute gestellt und in höheren Töchterschulen gestillt werden, wurden damals nicht erhoben.
[3.2 Bildung für Jungen und Mädchen]
Unsere holde Weiblichkeit wurde einfacher erzogen; nur für den zukünftigen Wirkungskreis als dereinstige tüchtige Hausfrauen lernten sie und wirkten im Haushalte mit. Die [37] Frauenbewegung und mit ihr das Streben nach sozialer Gleichstellung der Frauen mit den Männern ist ein Produkt der neuen Zeit, hervorgegangen aus der machtvollen Entwicklung unserer Nation seit der Begründung des neuen Deutschen Reiches.
Damals schloß die allgemeine Schulbildung, auch die in der Realschule, mit der Konfirmation im 14. Lebensjahre ab, die Jungen kamen in die Lehre, die Mädchen lernten das Schneidern pp. Nur die Gymnasiasten, die studieren wollten, mußten, wie heute, bis zur Abiturientenprüfung die Schulbank drücken; wer seiner Tochter eine höhere Bildung angedeihen lassen wollte, schickte sie in eine Pension.
Früher war, mit Ausnahme der Studenten, in den meisten Fällen der Sohn mit 18 Jahren von der Tasche der Eltern, die Tochter zumeist in ähnlichem Alter schon verlobt oder gar verheiratet. Wer die Schulbank hinter sich hatte, mußte praktisch arbeiten lernen, ganz gleich in welchem Beruf; blasierte Prüderie, wie sie sich heute so vielfach bei unserer jungen Welt breit macht und sich scheut, von der Pike auf etwas gründlich zu erlernen, kam nicht vor, oder nur bei verzogenen Muttersöhnchen.
Oft sofort nach der Konfirmation, sicher aber sofert nach zurückgelegter Lehrzeit, gings hinaus in die weite Welt, wer ein Handwerk gelernt hatte, als Wanderbursch mit dem Stab in der Hand. Zum Flirten und Bummeln in den Straßen fand man keine Zeit; damit aber will ich unserer heutigen Jugend keinen Vorwurf machen, denn der Einjährigfreiwillige, den wir in Hessen noch nicht kannten, läßt es jetzt nicht zu, vor dem 20. Jahre sich von Mutters Schoß und von Vaters Tasche loszutrennen.
[3.3 Gesellschaftliches Leben der Jugend]
Auch unsere »Mäderchen« mußten damals mehr zugreifen wie die heutigen jungen Damen; in den meisten besseren Haushaltungen wurde nur ein Mädchen gehalten, mit dem sich die Töchter des Hauses in die Hausarbeit teilten. Die Lebensführung war selbst in den wohlhabendsten Kreisen unendlich viel bescheidener. Mit Ausnahme des Hoftheaters hatte [38] man keine Gelegenheit, öffentliche Veranstaltungen zu besuchen. Das Wort »Sport« existierte auch noch nicht, geschweige denn die Ausübung dieser und ähnlicher Zerstreuungen, für die jetzt unsere jeunesse dorée so viel Zeit verschwendet. Es gab auch noch keine Strick- und Nähmaschinen; die Strümpfe mußten mit den Händen gestrickt, die Hemden pp. mit der Hand genäht werden, und was sonst die Hausarbeit noch alles mit sich brachte. Dabei aber blieben kunstfertige Handarbeiten, Seiden- und Perlen-Stickerei pp. nicht ausgeschlossen; eine besondere Geschicklichkeit wurde in der Anfertigung von künstlichen Blumen betätigt.
Bei aller Bescheidenheit der Ansprüche aber war das gesellige Leben und Treiben gemütlicher und ungezwungener wie jetzt; es beschränkte sich mehr auf die Familie oder engere Bekanntenkreise. Der jetzt übliche Verkehr in öffentlichen Restaurants oder Vergnügungslokalen wurde mit den Damen nicht gepflogen; mit Ausnahme der Felsenkeller usw., wo Kaffee getrunken wurde, wagte sich keine Dame in eine Bier- oder Weinschenke; Restaurationen im heutigen Stile gab es noch nicht. Dagegen wurden Partien zu Fuß gemacht nach Wilhelmshöhe, nach der Neuen Mühle, Freienhagen, der Knallhütte, nach Crumbach oder ins Eichwäldchen; dort wurden heitere Gesellschaftsspiele im Freien gespielt, wie »Russisch Laufen, Tutut, wer hat gut Bier feil, Pot schimper Pot schamper, Plumpsack raus, Blindekuh, der Fuchs der kommt, alle Bäume wechseln sich« usw. usw.
Zum Osterfeste zog die ganze Familie hinaus in die Aue, um auf dem »Zirehnenberg« oder dem Theaterberg die Ostereier zu suchen.
[3.4 1848er Revolution]
Mein erstes Schuljahr, das Revolutionsjahr 1848, war durch seine politischen Kämpfe und Aufregungen besonders für Cassel sehr ereignisreich, so daß mir noch manche Episode aus damaliger Zeit genau im Gedächtnis geblieben ist.
Der Ausbruch der französischen Revolution und der Sturz des Bürgerkönigs Louis Philipp rief eine gewaltige Erregung [39] im deutschen Volke hervor, die Freiheitsbewegung war auch in Deutschland nicht mehr aufzuhalten. In Frankfurt a.M. trat die deutsche Nationalversammlung zusammen (das Frankfurt Parlament) und bildete den Mittelpunkt des damaligen gesamten politischen Lebens in Deutschland.
Um die langersehnte deutsche Einheit herzustellen und damit unserem großen Vaterlande, das seither bei seiner Zerrissenheit nur einen geographischen Begriff in der Welt bedeutete, seine gebührende Machtstellung unter den Nationen Europas zu verschaffen, beschloß das Parlament, dem König Friedrich Wilhelm IV. von Preußen die Kaiserkrone anzutragen; leider vergeblich, der König lehnte bekanntlich die Annahme der Kaiserkrone aus Volkeshand ab. Statt dessen wurde oder blieb der berufene Erzherzog Johann von Österreich der sogenannte Reichsverweser.
Die glühende Begeisterung für die Freiheits- und Einheitsbewegung im deutschen Volke fand in Liedern Ausdruck, die damals allgemein gesungen wurden, auch von uns Jungen in der Schule. Wo sich der Deutsche gesellig zusammenfand, erschallte das Arndtsche Lied: Was ist des Deutschen Vaterland. ist’s Preußenland, ist’s Schwabenland? usw. oder: Schleswig-Holstein*) meerumschlungen, und andere. [ *) Die Schleswig-Holsteiner, die sich von der dänischen Gewaltherrschaft befreien wollten, erhoben sich selbst zum Krieg gegen Dänemark, mußten aber der Übermacht weichen. Die deutschen Bundestruppen kamen ihnen zu Hilfe und schlugen die Dänen. Dennoch kam es nicht zur Befreiung; im Frieden von Olmütz wurden die Herzogtümer wieder an Dänemark durch die Uneinigkeit Preußens und Österreichs verraten. Der schmähliche Ausgang der schleswig-holsteinischen Erhebung erregte in Deutschland zugleich Erbitterung und Beschämung. Das unglückliche Schicksal Schleswig-Holsteins bildete einen Stachel, oder das deutsche Nationalbewußtsein weckte und reizte. – Unter den deutschen Stämmen waren es die Schleswig-Holsteiner und die Kurhessen, die unter Bedrückung durch die unkluge Politik ihrer Regierungen zu leiden hatten, daher die Lieder! ] Wir in [40] Kurhessen sangen bei der Unbeliebtheit unseres Kurfürsten das revolutionäre Lied:
Vivat die Republik,
Unsern Kurfürst haben wir dick,
Weil er sich hat schlecht betragen,
Wollen wir ihn zum Teufel jagen.
Im Volksmunde wurde auf gut Casselsch das Lied verballhornt, man sang die ersten Strophen:
Vivat die Republik,
Unsen Kurfirscht wumme nit usw.,
[3.5 Kassel in der Revolution]
Cassel blieb in der Volksbewegung gegen andere Städte nicht zurück, die ganze Bürgerschaft war von dem Freiheitsdrange mehr oder weniger ergriffen. – Die jahrelangen Verfassungskämpfe der hessischen Städte gegen die reaktionäre Regierung Hassenpflugs und seiner Gefolgschaft, die infolgedessen herrschende Mißwirtschaft hatte allgemeine Erbitterung hervorgerufen, die sich in Demonstrationen gegen unliebsame Staatsdiener, durch Katzenmusiken und Fenstereinwerfen und mancherlei Tumulte Luft machte.*) [ *) Dem Staatsrat Pfeiffer, der in unserem Hause wohnte, wollte man auch die Fenster einwerfen, was durch rechtzeitiges Intervenieren meines Vaters verhindert würde. Pfeiffer wurde später Minister. ] Solche Auftritte nahmen oft so große Dimensionen an, daß die Bürgergarde zur Aufrechterhaltung der öffentlichen Ordnung und zum Schutze des kurfürstlichen Palais aufgeboten werden mußte.
Der Kurfürst und seine Ratgeber vermieden es wohlweislich, um die herrschende Erbitterung nicht zu größeren Gewalttätigkeiten zu steigern, das Militär zum Einschreiten zu veranlassen; der Kurfürst zog es deshalb vor, sich dem Schutze der Bürgerwehr anzuvertrauen. Diese, die Bürgergarde genannt, war im Jahre 1832 ins Leben gerufen; sie diente nicht allein zur Aufrechterhaltung der öffentlichen Ruhe, sondern auch zum Schutze der Verfassung, die im selben [41] Jahre vom Kurfürsten dem hessischen Volke bewilligt wurde. Jeder selbständige waffenfähige Bürger war verpflichtet, in dieselbe einzutreten.
[3.6 Bürgergarde]
Die Unruhen des Jahres 1848 stellten an die Bürgergarde ganz besondere Anforderungen, sie leistete unter dem Oberkommando des Maurermeisters Heinrich Seidler, des Vaters meines Freundes Georg Seidler, hervorragendes im Dienste für die Aufrechterhaltung der öffentlichen Ruhe und Ordnung. Durch ein sicheres, überlegtes Eingreifen ist manche Kollision verhütet worden, die zwischen Militär und der aufgeregten Bevölkerung leicht hätte verhängnisvoll werden können.
Ich nehme an, daß es von Interesse für den Leser ist, näheres über die damalige Bürgergarde zu erfahren; was ich davon zu erzählen weiß, will ich hier mitteilen. Die Bürgerwehr bestand aus drei Bataillonen Bürgergarde zu Fuß und einer Schwadron reitender Bürgergarde. Eines dieser Bataillone, das Schützenbataillon, trug dunkelgrüne Uniformröcke, auf den Schultern mächtige Epaulettes mit dichten wollenen Fransen. Die Kopfbedeckung war ein schwarzlederner Tschako mit Lederschirm und breitem oberen Boden; er hatte die Form eines umgestülpten Eimers; die Kinn-Riemen hatten messingene Schuppen. Vorn, am oberen Boden, war mit einer eiförmigen blauweißen Kokarde der Haarbusch, ein dunkler, zylindrischer, steifer langer Borstenwedel, aufgesteckt, der uns später, nach Auflösung der Bürgergarde, zum Putzen der Lampen-Zylinder gute Dienste tat. Der Hirschfänger und die große Patronentasche wurden an schwarzledernen Bandelieren über Kreuz getragen. Als Gewehr trugen die Schützen eine Büchse mit Feuersteinschloß, vor der Brust ein Pulverhorn. Die beiden anderen Bataillone trugen blaue Waffenröcke, Säbel und Flinte mit Bajonett, Tschako usw. wie bei den Schützen. Die reitende Bürgergarde hatte ebenfalls blaue Waffenröcke, ein Käppi mit hängendem weißen Haarbusch, als Waffe Schleppsäbel. Die reitende Bürgergarde rekrutierte sich [42] aus Pferdebesitzern, deren Pferde nichts weniger wie Andalusier, meist derbe Gäule waren, die ihre Gangarten nicht nach dem Schenkeldruck, sondern nur unter Zerren am Zügel ausführten, sie waren mehr an die Peitsche gewöhnt. – Man kann sich denken, welchen komischen Eindruck diese Garde-Kavallerie unserer Bürgerschaft machte, ich weiß mich desselben noch genau zu entsinnen. Der Kommandeur oder einer der Offiziere war der Bierbrauereibesitzer H. Eissengarthen vom Pferdemarkt, ein wohlbeleibter Herr.
Als besonderes Abzeichen trug die Bürgerwehr um den linken Arm eine weiße Binde. Die militärische Ausbildung unserer Bürgerarmee war entsprechend unmilitärisch, denn zum Kriegführen wurden unsere Väter nicht gedrillt. – Der gewöhnliche Dienst beschränkte sich auf die Stellung der Wachtposten, ausnahmsweise auf Paradeübungen; er wurde nach Bedarf und Befehl vom Oberkommando auf gewisse Stunden oder Tage angeordnet, die der Bürger seiner geschäftlichen Tätigkeit entziehen mußte; bei dem schlechten Geschäftsgang konnte dies ohne großen Nachteil geschehen.
[3.7 Schutzwache]
Das Foto des Hallengebäudes stammt von Carl Machmar. Hier klicken (→), um zu einem Scan des Original-Fotos zu kommen. (Universitäts-Bibliothek Kassel)
Außer der militärisch gekleideten eigentlichen Bürgergarde bildete sich 1848 noch ein Freikorps, die sogenannte Schutzwache, die junge und alte Schutzwache. In ihre Reihen traten die wehrfähigen jungen und älteren Leute, die in der Bürgergarde nicht eingestellt waren, darunter waren besonders viele waschechte Demokraten und rote Republikaner. – Die Bekleidung war einfach, ein schwarzer Kittel von Callico mit Leibgurt von schwarzem Lederzeug für Säbel und Patronentasche, dazu ein Schießprügel mit Feuersteinschloß. Die Kopfbedeckung war ein breitkrämpiger schwarzer Filzhut, »Hecker«-Hut, nach dem Führer der Freischaren in Baden benannt, von dem eine Seite aufgekrempt war zur Befestigung einer schwarz-rot-goldenen deutschen Nationalkokarde, hinter der einige stolze Hahnenfedern befestigt waren.
Die Bürgergarde hatte ihre Hauptwache im alten Hallengebäude am Königsplatz, die Schutzwache im Gebäude der polytechnischen Schule am Martinsplatz.
[Zwischen den Seiten 42 und 43:]

Das alte Hallengebäude am Königsplatz.
[43] Mein Vater stand bei der dritten Kompagnie des Schützenbataillons als Sergeant. Sein Rangabzeichen war ein mondsichelförmiges Schild vor der Brust. Es gewährte uns Kindern immer eine besondere Freude, wenn wir den Vater mit seiner schlanken, stattlichen Figur in seiner Uniform bewundern konnten. – Wenn mein Vater Wachtdienst hatte, brachte ich ihm mehreremal das Frühstück von unserer naheliegenden Wohnung auf die Hauptwache im Hallengebäude.
Die Aufstellung zu Übungsmärschen oder Paraden fand auf dem Königsplatz statt; wir Jungen aus der Nachbarschaft hatten dann stets Gelegenheit, dies militärische Schauspiel mit anzusehen. Es kam beim Abmarschieren sehr oft vor, daß Jungen mit ihren Vätern im Glied eine Strecke zusammen marschierten; wir durften uns aber solche Freiheiten nie erlauben. Mir imponierte am meisten die Musik, besonders die Trommler, sie hatten faßgroße Trommeln, die einen dumpferen Klang abgaben, wie die jetzt gebräuchlichen.
[3.8 Garde-du-Corps-Übergriffe]
Meßplatz: Siehe Kapitel »4.16 Messen«.

Das Zeughaus und der Brunnen am Renthof (aus einem Prospekt von 1908).*MA

Die Kölnische Straße, Blick auf den Königsplatz (aus einem Prospekt von 1908).*MA
Der 9. April 1848 brachte Cassel eine zweite Garde du Corps-Nacht – die erste berüchtigten Angedenkens war im Dezember 1832 – in welcher die Garde du Corps wieder mal auf die Bürgerschaft einhaute. – Mir ist diese Nacht noch unvergeßlich. Am Abend vorher wurden wir Kinder von unserer Mutter gebadet; ich stand gerade im Badestunz – eine Badewanne kannten wir nicht – als auf der Straße großer Lärm entstand. Es wurde mit den Trommeln Alarm geschlagen, der aufgeregte Ruf »Bürger raus – Bürger raus« erschallte schauerlich durch die Straßen. – Meine Mutter war sehr erschrocken, wir Kinder waren sehr geängstigt und weinten. Gleich darauf kam mein Vater, der auf der Wache Dienst hatte, mit seiner Büchse in die Stube – ich sehe ihn noch, wie er sich beim Eintritt mit seinem langen Haarbusch unter der niederen Tür hindurch bücken mußte. Meine Mutter fragte erschrocken, was vorgefallen sei. Vater erzählte kurz, was er wußte über den Aufruhr und beruhigte meine Mutter, sagte ihr aber, daß, wenn er nicht nach Hause komme, sie sich nicht [44] ängstigen sollte. Wir Kinder konnten bei dem Lärm auf den Straßen vor Aufregung nicht schlafen, meine Mutter, die in den Kleidern blieb, hatte Mühe, uns zu beruhigen. – Ich lasse die Schilderung dieser Nacht folgen, wie sie Professor Fr. Müller in seinem Buch »Cassel seit 70 Jahren« niedergeschrieben hat:
»Schon mehrere Abende hindurch vor dem 9. April war wieder mit Katzenmusiken und Fenstereinwerfen demonstriert worden. Auch für diesen Abend erwartete man Ähnliches, aber auch zugleich eine Begrüßungsovation für den zurückgekehrten Minister Eberhard. Weil es gerade Meßzeit war und ein großer Andrang zu dem auf dem Ständeplatz befindlichen Renzschen Zirkus stattfand, waren die Straßen sehr belebt. Eine bedeutende Menge schloß sich dem nach der Eberhardschen Wohnung sich bewegenden Zuge an. Als dieser nun aus der Fünffensterstraße nach dem Meßplatze debouchierte, da sprangen hinter den Buden zwanzig bis dreißig Garde du Corps hervor und hieben auf die Menge mit Blanken Pallaschklingen ein. Auf das ausbrechende furchtbare Geschrei eilte eine Abteilung der auf dem nahen Rathause postierten Bürgergardenwache herbei; dieselbe wurde aber ebenso traktiert. Etwa zehn Personen erlitten schwere und leichte Verwundungen. Die mit Blitzesschnelle verbreitete Kunde von diesem brutalen Überfall rief eine unbeschreibliche Aufregung hervor. Alarmsignale ließen ihren schaurigen Zusammenruf in allen Straßen ertönen. Binnen kaum einer halben Stunde war die Bürgergarde auf dem Friedrichsplatze aufgestellt; die Garnison ohne Trommelschlag auf dem Kasernenplatze. An vielen Orten wurden Barrikaden aufgeworfen. Um der etwa zur Hülfe der in ihrer eigenen Kaserne bedrohten Garde du Corps vordringenden Infanterie ein ernstes Hindernis zu bereiten, hatte man die untere Königsstraße durch umgeworfene große Postchaisen gesperrt und eine formidabele Wagenburg errichtet. Keinerlei Befehl gelangte jedoch an die Truppen und wegen Mangels eines solchen ließ die Zeughauswache ruhig geschehen, [45] daß Volkshaufen in dasselbe drangen, sich mit Waffen aller Art versahen und noch viele mitschleppten, um sie an die übrige Bevölkerung zu verteilen. Nun strömten die bewaffneten Haufen nach der Garde du Corps-Kaserne und schossen in die Fenster derselben, ohne jedoch besonderen Schaden anzurichten, denn die Mannschaften hielten zu Pferde auf dem durch starke Tore geschlossenen Hofe. Als der Versuch, die Tore zu sprengen, nicht gelang, erscholl der Ruf, Feuer an die Kaserne zu legen, und als man bereits anfing, dasselbe ins Werk zu setzen, da erschien der Stadtkommandant mit dem Befehle des Kurfürsten, daß das Korps alsbald die Stadt zu verlassen und nach der Umgegend von Wilhelmshöhe abzurücken habe. Die Stunde der Mitternacht schlug gerade, als der Abzug durch das südliche Hoftor nach der alten Wilhelmshöher Allee angetreten wurde unter Abfeuern blinder Pistolenschüsse, die das erbitterte Volk in gleicher Weise erwiderte. Doch müssen auch wohl scharfe abgegeben sein, denn es fanden sich Blutspuren auf dem Wege, welchen die Schwadronen eingeschlagen hatten.« – In besonders fesselnder und anschaulicher Weise schildert der im Mittelpunkt der damaligen Bewegung stehende Kommandeur der Bürgergarde, Heinrich Seidler, die Vorgänge dieser Nacht, über die er als Augenzeuge der aufregenden Ereignisse handschriftliche Aufzeichnungen hinterlassen hat, die alsbald nachher von ihm niedergeschrieben worden sind. Was Müller in gedrängter Kürze über diese denkwürdige Nacht berichtet, schildert Seidler in seinen geschichtlich wertvollen Aufzeichnungen sehr eingehend. Eine Veröffentlichung derselben ist leider unterblieben, es ist mir aber gestattet worden, Einzelheiten daraus in meine Erinnerungsbilder aufzunehmen, und da möge ein Auszug aus der Episode hier Platz finden, in der Seidler über seine Zusammenkunft mit dem Kurfürsten in der Garde du Corps-Nacht ausführlicheres erzählt:
Um die ungeheuere Aufregung der Bürgerschaft zu beschwichtigen, begab sich S. noch während des Straßenkampfes ins Palais, um persönlich auf den Kurfürsten einzuwirken, der von dem Gewaltakt seiner Garde du Corps noch nichts erfahren [46] hatte. S. schreibt u.a. darüber: »Ich ging die Karlsstraße hinunter durch die aufgeregten Menschenmassen nach der Kölnischen Straße zum Kriegsminister Oberstlt. Weiß, den ich noch angekleidet fand. Er wußte noch nicht, was eigentlich geschehen war; ich teilte es ihm mit wenigen Worten mit. Dann sagte er mir: ›Eilen Sie sich, wir wollen zuerst zum Kurfürsten und beraten, was zu tun ist.‹ Währenddem wir die Treppe hinuntergingen, hörten wir schon in der Richtung nach der Garde du Corps-Kaserne schießen. Wir eilten nun nach dem Palais, W. kam aber von mir ab; ich wußte nicht, ob er ins Ministerium, oder in die Kommandantur gegangen war. Am Palais angekommen, riß ich am Schellenzug, es wurde mir auch sogleich geöffnet. Im unteren Wartezimmer rechts, waren schon die Herren Ober-Jägermeister v. Baumbach, General v. Lepel, v. Heeringen, Lt. v. Eschwege versammelt, auch fand ich den Kommandeur des 1. Bataillons der Bürger-Garde, Eggena, in voller Uniform dort. Ich bat Eggena, mir schnell seine Uniform zu geben; wir wechselten die Kleider, er zog meine Zivilkleider an, und ich ließ mich sofort bei Sr. Königl. Hoheit anmelden. Der Kammerdiener sagte, der Kurfürst, welcher schon zu Bett gegangen war, sei eben wieder aufgestanden, er wolle mich aber sogleich empfangen. Einige Augenblicke später – es war nun etwa 11 ½ Uhr – wurde ich gerufen. Der Kurfürst, noch beschäftigt, die Uniform zuzuknöpfen, kam mir bis an die Tür entgegen; er hatte noch mit niemand, vielleicht außer dem Kammerdiener, über den Vorgang gesprochen, und frug mich: ›Nun, was gibt’s denn eigentlich?‹ Ich entgegnete ihm: ›Kgl. Hoheit, das Entsetzlichste ist geschehen, die Garde du Corps haben auf wehrlose Bürger eingehauen.‹ Darauf erwiderte der Kurfürst: ›Werden Sie nur erst ruhiger – Sie sind sehr aufgeregt; – es kann ja vorkommen, daß eine Schlägerei zwischen Militär und Bürgern stattfindet – die Sache soll untersucht werden.‹ Ich sagte: ›Kgl. Hoheit, die Garde du Corps haben bei ihrer Kaserne vorübergehende Bürger von hinten überfallen, auch haben sie sich auf [47] dem Meßplatz zwischen den Boutiquen versteckt und von dort auf die Bürger eingehauen, eine Menge ist schwer verwundet; – eine Patrouille der Bürgergarde haben sie überfallen und sind sogar bis ins Rathaus eingedrungen, wo die Bürgergarde die Wache hatte.‹ Der Kurfürst, sehr verwundert, ersuchte mich, ich möchte mich doch beruhigen und auch beruhigend auf die erregte Bürgerschaft einwirken und ihr mitteilen, daß eine strenge Untersuchung eingeleitet werden solle. Ich stellte ihm vor, daß es ratsam sei, die Garde du Corps alsbald aus der Stadt zu verlegen und bei der ungeheuren Aufregung weiterem Unheil zu begegnen. Der Kurfürst entließ mich mit den Worten: ›Will überlegen‹ und befahl, den Stadtkommandanten v. Lepel einzulassen.
In dem unteren Zimmer waren inzwischen noch mehrere Herren hinzugekommen, darunter auch Minister Eberhard. Ich ging nun mit Eggena in seine Wohnung, ließ mir schleunigst meine große Uniform holen und eilte, nun vollständig uniformiert, die Königsstraße hinauf. An der Wilhelmstraße fand ich eine Menge Menschen beschäftigt, eine Barrikade zu bauen, wobei die Meßbuden mit herhalten mußten. Durch meinen Federhut erregte ich die Aufmerksamkeit einer Menge Bürgergardisten, die sich von allen Seiten an mich herandrängten und schrien: ›Die Räuberbande muß sterben – steckt die Kaserne in Brand.‹ Ich ging neben der Barrikade vorbei, die Wilhelmsstraße hinauf, die gedrängt voll Menschen war, zur Kaserne, gefolgt von Bürgergardisten. Aus den Fenstern der Kaserne fielen noch mehrere Schüsse von Garde du Corps, die man hinter den teils erleuchteten Fenstern herumlaufen sah – dann erloschen die Lichter. – Plötzlich öffnete sich das obere Tor des Kasernenhofes, aus dem die Truppe, die in größter Unordnung zu Pferde aufgesessen war, in flüchtender Eile herausreitend, durchs alte Wilhelmshöher Tor aus der Stadt trabte – vom Pferdeteich aus wurde auf sie geschossen. – Vor dem Königstor, bei dem Hause des Apothekers Braun, wurde Halt gemacht, teils, um sich erst eiligst fertig anzukleiden, das Sattelzeug zu [48] ordnen, – das alles bei der Flucht aus der Kaserne nur halb geschehen konnte, – und dann, um die zurückgebliebenen Kameraden abzuwarten, worauf die Truppe nach dem leise gegebenen Kommando des Rittmeisters v. Baumbach nach Wilhelmshöhe zu fortritt. In Wahlershausen wurde ein Wagen zu requirieren versucht, zur Fortschaffung der Verwundeten, aber niemand wollte sich dazu verstehen; den gleichen Versuch machte man auch in Kirchditmold, aber auch hier ohne Erfolg, und so wurden die Verwundeten auf den Pferden mitgenommen; auch die angeschossenen Pferde wurden an Hand geführt bis nach Hofgeismar, dem Endziel der Flüchtenden.«
Nach der Flucht der Garde du Corps mußte Seidler seine ganze Autorität aufbieten, um die Kaserne vor der Wut des empörten Volkes zu wahren, die man im Begriffe war, anzuzünden. Mit Mühe und Not gelang es noch drei zurückgebliebene Garde du Corps und einige kranke Insassen aus den gefährdeten Gebäude zu retten, an denen das Volk Lynchjustiz ausüben wollte. Die nunmehr unbesetzte Kaserne betrachtete man als eine Eroberung und bezeichnete sie durch Aufschrift als »Nationaleigentum«. In der ganzen Stadt herrschte eine furchtbare Erbitterung, der Ausbruch einer allgemeinen Revolution war zu gewärtigen. Das Volk verlangte nach Waffen, die es sich durch Erstürmung des Zeughauses zu verschaffen wußte – nun wollte man auch dem Kurfürsten zu Leibe und das Palais stürmen, das aber durch die Bürgergarde geschützt wurde; in der Umgebung desselben wurde fortwährend geschossen. Nur dem besonnenen Verhalten der Bürgergarde und dessen Kommandeurs war es zu danken, daß größeres Unheil verhütet wurde; die Wut des Volkes machte sich in den schrecklichsten Verwünschungen Luft. Seidler war sich darüber klar, daß sich die Erbitterung erst dann legen werde, wenn das verhaßte Korps aufgelöst würde; er wurde stürmisch aufgefordert, die Auflösung desselben beim Kurfürsten durchzusetzen. Inmitten einer dichtgedrängten Menschenmasse auf dem Königsplatze suchte Seidler auf die Menge einzureden; [49] er wurde plötzlich hochgehoben und kam so auf die Schultern seiner nächsten Umgebung zu stehen und rief von oben herab der aufgeregten Menge zu, daß man die Auflösung der Garde du Corps vom Kurfürsten fordern müsse. Diesen Worten folgte ein donnerndes Hurrah. Seidler erklärte sich bereit, sich sofort zum Kurfürsten ins Palais zu begeben und nicht erst zurückzukehren, bis er die Zusicherung zur Auflösung der Truppe erhalten habe. Er legte der Menge aber dringend an’s Herz, bis zu seiner Rückkehr die Ruhe und Ordnung aufrecht zu halten, und nach nochmaligem Hurrah begab er sich direkt ins Palais. Seidler berichtet über die nächsten Vorgänge hier das weitere:
»Als ich das Wartezimmer betrat, fand ich außer den bereits erwähnten Kavalieren noch mehrere andere, die nachdenkend oder halb schlafend auf den Stühlen saßen – es war gegen 3 Uhr morgens. Durch mein Eintreten ermuntert, wurde ich mit Fragen bestürmt, wie es draußen aussähe; mit wenig Worten und in größter Aufregung gab ich Antwort die Empörung der Bürgerschaft sei kaum noch in Schranken zu halten – es gäbe kein anderes Mittel zur Herstellung der Ruhe, als die Auflösung der Garde du Corps, und das müsse ich dem Kurfürsten vorstellen. Ich ließ mich melden und wurde auch sogleich vorgelassen. Vom Kurfürsten empfangen, frug er mich, wie es stände und was noch vorginge, es werde ja noch fortwährend geschossen. Ohne Zögern antwortete ich: ›Königliche Hoheit, es gibt nur ein Mittel, die Gemüter zu besänftigen, lassen Sie es mich aussprechen – die Auflösung der Garde du Corps!‹ Durch dies Ansinnen aufs höchste überrascht, sah mich der Kurfürst groß an und sagte: ›Werden Sie nur erst ruhig, Sie sind zu sehr angegriffen – das geht unmöglich – bedenken Sie doch, die hessischen Fürsten haben von jeher eine Leibgarde gehabt – und dann die schönen Uniformen und die Pferde – nein, das ist unmöglich.‹ Ich entgegnete, der Kurfürst möge um Himmelswillen ein größeres Unglück verhüten und von zwei Übeln das kleinste wählen – [50] er möge an die jüngsten Vorfälle in Berlin denken. Ich hätte dem Volke versprochen, die Auflösung bei Seiner Königlichen Hoheit zu bewirken – ich ginge nicht erst aus dem Palais, bis ich die Zusicherung erhalten – man würde mich in Stücke hauen, wenn ich eine abschlägige Antwort brächte. – Der Kurfürst ging unruhig im Zimmer hin und her, von der Straße schallte fortwährendes Schießen herauf; mit erregter Stimme sagte er dann zu mir: ›Wozu nun noch immer das Schießen – die Leute haben meine Wagen aus dem Marstall geholt und Barrikaden damit gemacht – sagen Sie den Leuten, die Schuldigen sollten bestraft werden.‹ Ich bat den Kurfürsten, sich auf die Straße bemühen zu wollen und einige beruhigende Worte zu dem Volke zu sprechen – ich könne ohne die Zusicherung der Auflösung nicht aus dem Palais treten. Ich war hierbei sehr lebhaft geworden, der Säbelriemen war mir auf gegangen, der Kurfürst trat zu mir heran und legte mit Hand an, um mir den Riemen festzuschnallen; wir waren allein. – Er drang nochmals in mich und forderte mich auf, das Volk zu beruhigen – er wolle mit sich zu Rate gehen, dann empfahl ich mich. Im Wartezimmer nahm ich nochmals Veranlassung, den Kriegsminister um seine Beihilfe zu bitten, den Kurfürsten zur erbetenen Auflösung zu bewegen. Der Minister hatte aber wenig Hoffnung – der Kurfürst gäbe damit ein Stück von seinem Leben, meinte er – er wolle jedoch das seinige versuchen. Hiernach verließ ich das Palais und trat unter die draußen harrende Menge, um dieser mitzuteilen, daß ich hoffte, die Auflösung durchzusetzen. Eine Beruhigung erreichte ich mit meinen Worten aber nicht, im Gegenteil, die Aufregung wurde immer größer, es wurden sogar Drohungen gegen die Bürgergarde ausgestoßen, welche das Palais besetzt hatte. Ich ging nun nochmals zurück, um den letzten Versuch zu machen. Im Palais herrschte große Aufregung, die Adjutanten liefen hin und her, der General v. Lepel und der Kriegsminister waren nacheinander beim Kurfürsten – ich ging ungerufen die Treppe hinauf und ließ mich durch den Adjutanten v. Eschwege [51] beim Kurfürsten wieder melden, der mich nach einigen Minuten hereinrufen ließ. Weiß stand neben der Tür, der Kurfürst kam mir gleich entgegen und frug mich sehr aufgeregt, warum noch immer geschossen würde. Ich konnte nichts darauf erwidern, wie die Wiederholung meiner Bitte, die ich zum letzten Male und mit Nachdruck in großer Bewegung aussprach, er möge sie um Gotteswillen erfüllen, weil sonst, wie sich erfahren, die Republik proklamiert werden sollte. Darauf erklärte der Kurfürst sich zögernd bereit, die erste Eskadron aufzulösen, wenn die Täter in ihr ermittelt werden sollten, die nach dem Gesetze bestraft werden würden. Ich bemerkte darauf, daß im Jahre 1830 bei dem ähnlichen Vorgang die Schuldigen auch bestraft werden sollten, ohne daß es zur Ausführung gekommen sei – das Volk sei deshalb mißtrauisch. Ich hielt aber den Kurfürsten beim Wort bezüglich der Auflösung der ersten Eskadron und bat dringend, auch die zweite Eskadron nicht auszuschließen, falls die Täter auch in dieser zu suchen waren. Der Kurfürst kämpfte mit sich, sah Weiß an und sagte dann kurz: ›Nun, meinetwegen.‹ Ich bat ihn, dem Volke selbst diese Mitteilung zu machen, er lehnte jedoch ab und meinte, das könne ich den Leuten besser sagen, wie er.
Ich empfahl mich und verließ eilig das Palais – es war heller Tag. Vor dem Museum stand eine Abteilung des Freikorps, geführt von Doktor Kellner, dem ich die erste Mitteilung von der vom Kurfürsten bewilligten Auflösung der Garde du Corps machte, was dann wie ein Lauffeuer in der Stadt weiter verbreitet wurde.« – – Seidler war nach all der Aufregung zum Umsinken erschöpft und erfrischte sich an der »Zaite – wie er schreibt – mit einem Schluck Wasser«. – –
Am Morgen des 10. April sah die Stadt aus, als hätte sie einen gewaltigen Kriegssturm erlebt. Die ungebetenen Besucher des Zeughauses stolzierten mit Pallaschen an der Seite und Pistolen im Gürtel, ja sogar nicht wenige mit Kürassen angetan, einher. Ich selbst sah am andern Morgen eine Anzahl besoffene Radaubrüder vor unserem Hause hinter der [52] Mauer vorüber taumeln, die unter Brüllen und wütenden Gesten mit den geraubten Waffen, Pallaschen, Pistolen und Seitengewehren in der Luft herumfuchtelten und mir Grauen einflößten.
Die alten Postwagen, die zum Aufbau der Barrikaden gebraucht wurden, holten die Aufrührer aus den uns gegenüber liegenden Postwagenremisen und verwendeten sie zur Absperrung der Straße zwischen der Post und dem Hotel König von Preußen. Eine andere Barrikade versperrte die Königsstraße bei Kaufmann Ritz (jetzt Chartier). Die Postwagenkasten dienten als Durchgang.
In einer kurfürstlichen Proklamation, die durch Maueranschlag bekanntgegeben wurde, wurden die Ausschreitungen der Garde du Corps »mit tiefem Schmerz« beklagt und die Auflösung der Garde du Corps angeordnet; die Gemüter beruhigten sich allmählich wieder und die gefahrdrohende Stimmung machte besonders unter der Einwirkung der Bürgergarde einer besseren Platz.
[3.9 Der Kurfürst bei Schutzwachen-Fahnenweihe und Volksfest]
Am 6. August 1848 fand die Einweihung einer von Casseler Damen für die jüngere Schutzwache gestifteten Fahne auf dem Bowlingreen statt, die sich zu einem Volksfeste gestaltete, wie es Cassel zum zweitenmale nicht erlebt hat. Unsere Familie, d.h. Vater, Mutter und wir drei Jungen, nahmen auch als Zuschauer an dem Feste teil. – Mein Großonkel, der Hofgärtner Schmidtmann in der Karlsaue, hatte uns geladen; wir Kinder mit der Mutter standen auf dem platten Kupferdach der Orangerie hinter der Ballustrade, von wo aus wir einen prachtvollen Überblick hatten und das unbeschreiblich lebendige und interessante Treiben des großen Volksfestes ungestört betrachten konnten. Unter uns vor dem Orangerieschloß war eine Tribüne errichtet, besetzt von reichem Damenflor. Auf ihr stand auch der Kurfürst, an dem die Bürgergarde und Schutzwache mit der geweihten Fahne vorbeidefilierten. Am Vormittag desselben Tages fand die Huldigung der Truppen für den Reichsverweser Erzherzog Johann auf dem großen [53] Forste vor dem Kurfürsten statt. – Fr. Müller berichtet über diese bedeutungsvollen Ereignisse näheres, was ich hier wiedergeben will:
»An einem heiteren Sonntagmorgen (6. August) rückte die Garnison zu der vom Reichsministerium in Frankfurt angeordneten, dem einstweiligen deutschen Oberhaupt zu leistenden Huldigung nach der weiten Forstebene. Die schwarz-rot-goldene Kokarde war der hessischen zugesellt und an den Fahnen flatterten seidene Schleifen von denselben Farben. Um 9 Uhr erschien der Kurfürst in Begleitung eines glänzenden Stabes. Die Truppen formierten ihm gegenüber ein offenes Viereck, in welchem der kommandierende Divisionär die Proklamation des Reichsverwesers verlas. Hierauf gab der Kurfürst mit aufgehobenem Degen Befehl zur Vollziehung der Huldigung. Der Divisionär machte mit weit vernehmbarer Stimme die Huldigungsformel bekannt und die Truppen stimmten durch ein dreimaliges Hurra und Hoch auf den Reichsverweser ein, worauf eine dreimalige Geschützsalve folgte. Mit nicht geringer Lebhaftigkeit wurde am Schluß des Aktes dem Kurfürsten zu Ehren ein mehrmaliges Hoch ausgebracht. Die Unterstellung des hessischen Heeres unter die Reichsgewalt und ihre Anerkennung von Seiten des Kurfürsten war also nunmehr eine vollendete Tatsache.
Dann begab sich der Kurfürst nach der Karlsaue, wo zwecks Einsegnung und Übernahme einer von Casseler Damen für die jüngere Schutzwehr gestickten Fahne feierlicher Gottesdienst im Freien stattfand. Die gesamte Bürgerwehr nahm an der Feier teil, desgleichen der Magistrat, alle oberen und unteren Behörden und beinahe die ganze Bevölkerung von Cassel. Das Arrangement war sinnig und geschmackvoll, und wurde noch besonders durch einen reichen Flor junger, weiß gekleideter und mit reichsfarbenen Schärpen geschmückter Damen hervorgehoben. Die Predigt hielt der unermüdliche lutherische Pfarrer Meyer in der ihm eigenen, schwungvollen Weise. Nach Vollendung der Einsegnung der Fahne und [54] deren Überreichung an das Korps wurde dem Reichsverweser ein Hoch ausgebracht, worauf alsdann die Bürgergarde und auch die übrige Schutzwehr im Parademarsch vor den Damen und dem Kurfürsten, welcher von einer für ihn auf der Orangerie-Terrasse besonders errichteten Tribüne dem Schauspiele zusah, vorbeidefilierte.
Auch die schärfste Beobachtung hätte in den Gesichtszügen des Kurfürsten nicht das geringste Merkmal einer Abneigung gegen die Feierlichkeiten dieses Morgens entdecken können. Seine heutige Selbstbeherrschung sollte aber am Nachmittag auf eine noch härtere Probe gestellt werden.
Ganz Cassel war an demselben von neuem in die Aue geströmt, zur Teilnahme an einem angesagten großen Volksfeste, bei welchem man ebenfalls auf die Anwesenheit des dazu eingeladenen Kurfürsten rechnete. – Auf dem Bowlingreen führten die Turner ein Schauturnen aus, an den Kletterbäumen versuchte sich die waghalsige Jugend; Sackhüpfen, Hahnenschlag, Schwebebaum zwischen Behältern mit schwarzem und weißem Mehlstaub und noch andere launige Spiele ergötzten das Publikum. Zu den Tanzbelustigungen, sowohl hier, wie bei dem Rondel, spielten die Musikchöre der Bürgergarde und der kurfürstlichen Leibgarde auf. Eine Polonaise von 400 Paaren durchwogte die große Allee und alle übrigen Hauptwege der Aue. Die aufgestellten Erfrischungszelte und Buden umlagerten viele Tausende, fröhlicher Becherklang ertönte überall. – Als das Fest seinen Höhepunkt erreicht, meldete plötzlich ein die ungeheure Menge durchzuckender Jubel die Ankunft des Kurfürsten. Alles strömte zum Rondel, wo er aus dem Wagen stieg. Daß man ihn zum ersten Mal im Frack und mit der deutschen Kokarde am Hut erblickte, machte einen begeisternden Eindruck. Als er den großen Tanzplatz betrat, um welchen die Damen mit ihren Herren sich in Spalier aufgestellt, wurde ihm durch den Volksmann, den Küfermeister Herhold, ein Ehrentrunk kredenzt, den er mit den Worten freundlichst annahm, daß er, obgleich der heutige Tag nur dem [55] großen deutschen Vaterland gewidmet sei, doch zu den vielen Hochs, die demselben bereits ausgebracht, auch ein solches auf das engere hessische Vaterland ausbringen wolle. Das rief unendlichen Jubel hervor, die Musik mußte ›Heil unserm Kurfürsten‹ aufspielen, und alles stimmte in den Gesang des Liedes ein. Hierauf begab sich der Kurfürst nach dem Bowlingren, wo unter Spohrs Leitung ein Riesenkonzert gegeben wurde, nach dessen Beendigung er sich unter noch vielfach ihm dargebrachten Freudenbezeugungen nach dem Hoflager zu Wilhelmshöhe zurückbegab. Bei einbrechender Dunkelheit schloß das Fest mit dem Abbrennen eines Brillant-Blaufeuers, welches das Mahnwort ›Einigkeit‹ umspielte.«
[3.10 Streit zwischen Fürst und Bürgern]
Wenn es auch den Anschein hatte, daß der Kurfürst der freiheitlichen Bewegung in Deutschland und insbesondere in Hessen Rechnung tragen und die dem Volke durch die Verfassung gewährleisteten Rechte respektieren würde, so hatte er doch offenbar nur mit Widerwillen sich gefügt; die liberalen Regungen schwanden sehr bald wieder; ein dauernder Frieden war nicht sicher hergestellt, der Streit zwischen der Regierung und den Ständen blieb unverändert nach wie vor. Die Stimmung im Volke war deshalb eine sehr gereizte, die republikanischen Ideen gewannen immer mehr Boden. In der »Hornisse« wurde mit der scharfen Geißel der Satyre gegen die reaktionären Bestrebungen der Regierung vorgegangen. Die Herausgeber derselben, die Juristen Dr. Kellner und Heise, ausgesprochene rote Republikaner, hielten große Volks-Versammlungen ab und traten als Volksredner auf. Eine dieser Versammlungen fand im Herbst 1849 vor dem Hotel »König von Preußen« statt, bei welcher Heise vom Balkon des Hotels herab auf die den halben Königsplatz einnehmende Menge einredete. – Ich war zur selben Zeit mit mehreren Spielgefährten auf dem Wege zum Schloßplatz vor der Kattenburg, um dort den Drachen steigen zu lassen. Wir mußten uns, weil wir nicht durch das Gedränge hindurch kommen konnten, um die Volksmenge herumdrücken, um nach der Karlsstraße zu [56] gelangen. Ich sah den Redner auf dem Balkon, von dem eine große schwarz-rot-goldene Fahne herabhing, mit lebhaften Gesten auf das Volk einreden, das öfters in laute Ausrufe ausbrach.
[Zwischen den Seiten 58 und 59:]

Kurfürst Friedrich Wilhelm I. von der Parade in der Carlsaue zurückkehrend.
Die scharfen satyrischen Angriffe in der »Hornisse« gegen die Regierung und selbst gegen den Kurfürsten brachten die Herausgeber auf die Anklagebank und speziell Heise vor das Schwurgericht wegen Hochverrats und Majestätsbeleidigung; die Herausgabe des Blattes wurde verboten. Die »Hornisse« wurde in der Etienne’schen Buchdruckerei, im Hause an der Hedwigsstraße, in dem jetzt der Verlag des »Casseler StadtAnzeiger« sich befindet, gedruckt. – Um das Erscheinen unmöglich zu machen, stand ununterbrochen ein sich ablösendes Pikett Soldaten im Druckereilokal.
Trotz alledem erschien die »Hornisse« weiter, der Druck wurde in einer anderen Offizin besorgt. Die in unserem Hause befindliche Fischer’sche Buchdruckerei war jedenfalls auch verdächtig; sie wurde infolgedessen auch mit sechs Mann Soldaten in voller Kriegsrüstung besetzt, die auf unserem Hausflur postiert waren, zwischen denen wir Jungens uns mit gewissem Respekt bewegten, so lange unser Vater nicht zu Hause war, dem diese Besatzung ein Greuel war.
[3.11 Deutschland in der Revolution]
Die revolutionäre Bewegung hatte in Deutschland einen immer größeren Umfang angenommen; in Frankfurt a.M. war nach einer stürmischen Sitzung in der Paulskirche das Parlament leider zusammengebrochen, das bald darauf als sogenanntes Rumpfparlament seinem traurigen Ende entgegenging.
Die politische Spannung und Erregung in Deutschland war eine hochgradige; Brandmanifeste, welche das deutsche Volk zur Rettung der Reichsverfassung und zur Verjagung der Fürsten zu den Waffen riefen, zündeten nicht bloß im Süden, sondern auch im Norden. In Baden sammelten sich die Freischaren unter Hecker und Struwe, dort kam es zu blutigen Kämpfen. Ein preußisches Korps unter Führung des [57] Prinzen von Preußen, unseres späteren, großen Kaisers, ging gegen die revolutionären Scharen in Baden vor und warf sie zu Boden. Auch Regimenter anderer Staaten, darunter ein kurhessisches, nahmen an den Kämpfen teil. – Ein Regiment der Casseler Garnison, das am Schleswig-Holsteinischen Feldzug teilnehmen sollte, rückte im Frühjahr 1849 ins Feld, kehrte aber, ohne zum Eingreifen in die Kämpfe der Schleswig-Holsteiner gegen die dänische Gewaltherrschaft gekommen zu sein, im Nachsommer desselben Jahres wieder zurück, von der Bevölkerung mit Jubel begrüßt. – Ich habe den Einzug des Regiments – ich glaube, es war das Garde-Regiment –, den ich in der unteren Königsstraße, am Coß’schen Hause stehend, mit ansah, noch in guter Erinnerung.
[3.12 Kassel unter Hassenpflug 1850]
Verhängnisvoll war das Jahr 1850 in mancherlei Beziehung, sowohl für Cassel, wie im besonderen für unsere Familie.
Die Zurückberufung des früheren Ministers Hassenpflug durch den Kurfürsten rief eine große Bestürzung hervor; man ahnte, daß von einem Ministerium Hassenpflug, sprichwörtlich mit »der Hessen Fluch« gekennzeichnet, nichts Gutes zu erwarten war, und daß die Kämpfe gegen das System Hassenpflug in unserem Ständehaus von neuem entbrennen würden. – Und so geschah es auch, das liberale Märzministerium mußte weichen; mit dem Wiedereintritt Hassenpflugs in die Regierung hatte die reaktionäre Strömung wieder Oberwasser. Die Stände waren sich des voll bewußt, daß bei dem von früher her bekannten rücksichtslosen Vorgehen Hassenpflugs die eben errungenen Volksrechte und die Verfassung in Gefahr waren. Es bildete sich sofort nach dem ersten Erscheinen des Ministers in der Ständeversammlung eine geschlossene Opposition, die mit einem Mißtrauensvotum dem verhaßten Minister entgegentrat.
Dem ständischen Mißtrauensvotum folgte anderen Tags eine dasselbe unterstützende städtische Demonstration. – Von dem Königsplatze aus bewegte sich ein nach Tausenden zählender [58] Zug, der sich dadurch besonders feierlich, beinahe wie ein Grabgeleite ausnahm, weil die Teilnehmer sämtlich schwarz gekleidet waren und trübe Gesichter machten, nach den Wohnungen der abgetretenen Minister. Nicht nur die Bürgerschaft, sondern auch die gesamte Staatsdienerschaft war vertreten. Aus der Mitte des Zuges statteten Deputationen den betreffenden Herren eine Dank- und Kondolenz-Visite ab, während die Menge an ihren Fenstern unter stürmisch ausgebrachten Hochs vorbeidefilierte. Selbst dem neuen Ministerium unterstellte Beamte ließen sich in dem Zug erblicken, ja sogar einige im Hofdienste stehende Personen. Irgend eine Einschüchterung von oben hatte also noch nicht Platz gegriffen. Im Stadtbau wurde dem scheidenden Märzministerium ein Ehrenbankett gegeben.
[3.13 Cholera-Epidemie und Tod der Mutter]
Bei allem Druck, der infolge der allgemeinen Mißstimmung auf den Gemütern lastete, ließ man es sich nicht nehmen, Feste im Freien zu feiern, an denen unsere Bürgergarde regen Anteil nahm, wobei auch mein Vater nicht fehlen durfte. – Im Nachsommer wurde Cassel durch eine furchtbare Cholera-Epidemie heimgesucht, die ihren verheerenden Zug über ganz Europa fortsetzte und viele Hunderte fortraffte. Unsere Straße blieb gottlob verschont, dagegen forderte die schreckliche Seuche in den engen Straßen der unteren Stadt sehr viele Opfer, darunter befanden sich die Schwiegereltern, erster Ehe, meines Onkels Hochapfel, die beide in einer Nacht starben und morgens tot vor dem Bette liegend (?) gefunden wurden. Wenn wir auch in unserer Familie von der Seuche verschont blieben, so stellte sich eine Krankheit bei meiner Mutter ein, an der sie qualvoll hinsiechen mußte und im November desselben Jahres starb, meinen Vater mit uns fünf Kindern zurücklassend. Die Erinnerung an die schwere Leidenszeit meiner Mutter hat sich meinem Gedächtnis eingeprägt; wir Kinder suchten unsere im Bett liegende kranke Mutter aufzuheitern; bei der Aufführung einer Theatervorstellung mit einem Kindertheater erfreuten wir sie, die gerührt unserem Theaterstück »Der arme Poet« [59] vom Bette aus zusah; es war die letzte Erinnerung, die mir von meiner Mutter geblieben ist, bald darauf, im November, starb sie.
Unser Hausarzt, Dr. Matsko, ein guter Freund meines Vaters, konnte bei aller treuen ärztlichen Fürsorge nicht helfen. Leider folgte er einige Jahre darauf meiner Mutter; der große, stattliche Mann mit seinem frohgemuten Wesen wurde auch das Opfer einer Typhusepidemie, die, schon im Abnehmen begriffen, sich dieses tüchtigen, uns so lieben Hausarztes bemächtigte.
[3.14 Konflikt zwischen Hassenpflug und den Ständen]
Den trüben Tagen, die über uns in der Familie hereingebrochen waren, folgten solche der inneren politischen Wirren unseres Kurstaates. Das Mißtrauensvotum, das die Stände in einer Adresse an den Kurfürsten gegen das Ministerium Hassenpflug gerichtet hatten, führte keinen Wandel zum Besseren zwischen Ständen und der Regierung herbei, im Gegenteil, das Verhältnis zwischen beiden wurde ein immer gespannteres.
Mit der von den Ständen verlangten und erwarteten Vorlage des Budgets zur Festlegung des Finanzhaushaltes blieb die Regierung, der Verfassung zuwider, unter allerlei Einwendungen im Rückstande. Die Stände verweigerten unter den obwaltenden Umständen die Verwilligung der nötigen Mittel zur Deckung des Staatsbedarfs. In den Ständeversammlungen kam es zu stürmischen Auftritten; es wurde mit einer Majorität der demokratischen Partei beschlossen, die Zahlung der direkten Steuern zu verweigern. Die Ständeversammlung wurde durch diesen äußersten Schritt gegen die Regierung des Verfassungsbruchs und des ersten Schrittes zur offenen Rebellion beschuldigt. Dem gegenüber ließ der permanente Ausschuß eine Erklärung an das Land ergehen, welche die Stände gegen eine so schwere Anschuldigung verteidigte und namentlich den Vorwurf des Verfassungsbruchs dem Ministerium zurückgab. – Das Volk wurde in dieser Erklärung aufgefordert, fest zu den Beschlüssen der Stände zu stehen; [60] alle Steuererheber wurden verwarnt, keinerlei Steuern und Abgaben einzusenden, die nicht auf einem Ausschreiben beruhten, bei dem die landständische Verwilligung ausdrücklich erwähnt sei, widrigenfalls der Ausschuß gegen jeden derartigen Erheber mit gerichtlicher Anklage vorgehen werde. An dem Widerstande im Volke war nunmehr nicht mehr zu zweifeln, auch nicht an der Renitenz der mit dem Volke haltenden Beamten.
[3.15 Kriegszustand in Kurhessen]
Die Staatsregierung selbst glaubte daran. Daß sie mit dem Entschlusse zu extremen Maßregeln sich trug, konnte man an der Aufstellung von Schilderhäusern vor den Wohnungen der Minister merken, denn auf bloße Ehrenposten war es gewiß damit nicht abgesehen. Und so erschien denn auch schon anderen Tags eine landesherrliche Verkündigung, wodurch über das ganze Land der Kriegszustand verhängt, dessen Handhabung dem Generalleutnant Baur als militärischem Oberbefehlshaber übertragen, und diesem außer der gesamten Militärmacht alle Bürgergarden und Zivilbehörden, mit Ausnahme der Gerichte, unterstellt wurden.
Der erste Eindruck, den die Verkündigung des Belagerungszustandes hervorbrachte, war in der Tat ein verblüffender. In voller feldmäßiger Ausrüstung und verdoppelter Stärke bezogen die Truppen die Wache. Man begnügte sich nicht mit den bislang für ausreichend befundenen, der Garnison zustehenden Wachtlokalen, sondern nahm auch Privathäuser dazu in Beschlag. Beim Aufführen der vermehrten Einzelposten mußten diese vor den Augen des Publikums ihre Gewehre scharf laden. Sobald die Nacht anbrach, begann ein fortwährendes Patrouillieren durch die Stadtteile, wie denn überhaupt an der Entfaltung des ganzen kriegerischen Apparates nichts fehlte.
Bei alledem gewann man aber die Überzeugung, daß es mehr auf die Einschüchterung wie auf ein ernsthaftes Vorgehen abgesehen sei, und so erwachte der Mut zum Widerstand. Der Casseler Stadtrat wagte es, in einer öffentlichen Bekanntmachung [61] den verhängten Kriegszustand für gesetz- und verfassungswidrig zu erklären, und dagegen beim Gesamt-Staatsministerium feierlich zu protestieren, während der Kommandeur der Bürgergarde derselben durch einen dienstlichen Erlaß mitteilte, daß er die Kriegszustands-Verordnung als durchaus unverbindlich für die dienstliche Stellung der Bürgergarde ansehe.
In der Presse wurde gegen die Regierung scharf zu Felde gegangen und die Renitenz kräftig geschürt. Die Folge davon war, daß die Schließung der Druckereien der »Neuhessischen Zeitung« und, wie schon erwähnt, auch der »Hornisse« von der Militärdiktatur befohlen und zur Beschlagnahme der Pressen ein Kommando Soldaten aufgeboten wurde. Der Befehl wurde aber alsbald wieder zurückgezogen, nachdem General Baur vom obersten Militärgerichtshof ein Gutachten eingefordert hatte, welches für sein militärisches Einschreiten gegen die Presse sehr ungünstig ausgefallen war. Die Maßregel erschien nur als eine überflüssige militärische Spielerei, die vom Publikum bespöttelt wurde. Dadurch, daß das militärische Einschreiten durch mehrfache Gerichtserkenntnisse zum Zurückweichen gezwungen wurden, war es zu einem völligen Umtausch der Rollen gekommen; nicht die Renitenz, sondern das dagegen aufgebotene Militär fand sich jetzt bedrängt und am meisten sein Oberbefehlshaber.
[3.16 Verlegung der Regierung nach Hanau]
Unsere Gerichte, obenan das Oberlandesgericht, standen in der Wahrung der verfassungsmäßigen Rechte der Regierung gegenüber; die verhängnisvolle Berufung Hassenpflugs ins Ministerium trug ihre Früchte, die Autorität des Landesfürsten war, statt durch ihn gefestigt zu werden, stark erschüttert. – Der Kurfürst fühlte sich nach allen den Vorgängen in seiner Residenz nicht mehr behaglich, und da er auch für seine Sicherheit bangte, geschah das Unerwartete, er verließ bei Nacht und Nebel am 13. September, früh morgens um 2 Uhr, seine Residenz mitsamt seinen Ministern. Der Oberbefehlshaber machte bekannt, daß der Kurfürst den Regierungssitz [62] in die Provinz Hanau verlegt hatte. Nach diesem unerwarteten Ereignis hatte die Physiognomie der Casseler Bevölkerung wieder so etwas wie in den Märztagen von 1848 angenommen. Das Militär kam kaum in Betracht, dagegen war die Bürgergarde wieder oben auf; bei alledem aber kam es nirgends zu einer Störung der öffentlichen Ruhe.
Der Kurfürst hatte die Regierung in dem hessischen Badeort Wilhelmsbad bei Hanau etabliert und erließ von dort eine landesherrliche Verordnung, in deren Einleitung es hieß: »Daß es mit der Würde der Regierung nicht länger vereinbar gewesen, daß dieselbe mit untergeordneten, widerstrebenden Behörden an einem und demselben Orte verweile, so lange diese nicht zu ihrer Pflicht zurückgekehrt seien. Die zur Handhabung der Gesetze und insbesondere der Ordnung des Staatsdienstes erforderlichen Maßregeln würden ohne Verzug ergriffen werden.«
Gegen die ergriffenen Maßregeln legten aber die oberen Verwaltungs- und Finanzbehörden Protest ein und erklärten die von dem Ministerium dem Regenten angeratenen Anordnungen für verfassungswidrig, deren Befolgung ihnen der auf die Verfassung geleistete Eid verbiete.
Auch der Stadtrat blieb nicht zurück, er richtete eine Adresse an den Kurfürsten, welche mit der Bitte schloß, der Kurfürst möge die Regierung wieder in die Hauptstadt zurückverlegen und seine pflichtwidrigen Minister entlassen.
[3.17 Anrufung des Bundestags, Militärdiktatur]
Der »Bundestag«, nach dem Scheitern der nationalen Bewegung wieder als zentrale Vertretung der deutschen Bundesstaaten in Frankfurt tagend, mußte dem Ministerium Hassenpflug aus der Klemme helfen; der Kurfürst verlangte die Intervention gegen seine renitenten steuerverweigernden Untertanen. – Die Bundesversammlung erließ am 21. September eine verwarnende Bekanntmachung, durch die sich aber die Bevölkerung nicht einschüchtern ließ. Man wußte, daß Preußen im Bundestag keine Einmischung in die kurhessische Angelegenheit dulden wollte, und Preußen hat sich damals [63] schon die Sympathie der Hessen erworben. – Der Kurfürst, dessen Sympathie für Österreich offenkundig war, hatte aber im Bundestag einen Rückhalt gewonnen, der ihn veranlaßte, nunmehr mit Schärfe gegen seine unbotmäßigen Untertanen vorzugehen.
Das Oberkommando über die Truppen wurde dem General v. Haynau, einem Bruder des österreichischen Feldzeugmeisters, der »Hyäne von Brescia«, übertragen; von nun an herrschte die Militärdiktatur. Unter Trommelschlag ließ er auf allen öffentlichen Plätzen durch einen Unteroffizier, unter Deckung eines Kommandos Soldaten, eine Proklamation verlesen, wobei sich aber alle älteren Personen fern hielten, nur die liebe Straßenjugend bildete die Zuhörerschaft, die unter fortwährendem Johlen dem Ernste der Feierlichkeit erheblichen Abbruch tat.
Das Auftreten Haynaus hatte den Erfolg, daß die allgemeine Erbitterung sich nicht legte, sondern im Gegenteil immer mehr zunahm. Es gelang ihm nicht, für seine Zwecke willfährige Werkzeuge unter den Staatsdienern weder in Cassel, noch in der Provinz zu gewinnen. – Auch die Bürgergarde machte Front gegen die verschärfte Militärdiktatur; der Oberkommandeur Seidler sowie alle übrigen Offiziere der Bürgergarde weigerten sich dem Befehle Haynaus, vor ihm zu erscheinen, Folge zu leisten, und erklärte schriftlich, daß sie irgend einem von ihm ausgehenden Befehl nicht nachkommen würden. Der General ließ diese prägnante Renitenz auf sich beruhen; er wollte, bevor er dagegen vorging, zeigen, welche Macht ihm zu Gebote stehe; das sollte durch eine große Heerschau geschehen.
Am Vormittag des 4. Oktober nahm die ganze Garnison von Cassel und Umgebung auf dem Friedrichsplatze Aufstellung. Gerüchte über einen nach der Parade folgenden großen Schlag waren überall im Gange und fanden um so mehr Glauben, als der Diktator gleich nach seinem Erscheinen das Offizierkorps einen Kreis um sich schließen ließ und demselben [64] eine Standrede ernster Natur hielt. – Es schien, als ob die Würfel schwerer Entscheidung gefallen wären. Schon nach wenigen Stunden erfuhr die ganze Stadt, was der alte General in seiner Ansprache an die Offiziere gesagt hatte: »Es müsse sich zeigen, ob in Deutschland die Fürsten oder konstitutionelle Rotten künftig herrschen sollten. Wer mit diesen Rotten sympathisiere und nicht den Befehlen seines Kriegsherrn unbedingt Folge leisten wolle, solle sein Ehrenkleid ablegen und es mit der Bluse vertauschen.« – Dem militärischen Schauspiel folgte alsbald der Befehl zur Auflösung der Bürgergarde, diesem kam nur etwa ein Dutzend Bürgergardisten nach, die ihre Waffen ablieferten.
Am selben Tage wurde ein neuer Feldzug gegen die Presse eröffnet. – Kommandos von Kurfürst-Husaren mit geladenen Pistolen drangen in die Druckereien und versiegelten die Pressen. – Friedrich Oetker wurde verhaftet und nach dem Kastell abgeführt, trotzdem erschienen die »Neuhessische Zeitung« und »Hornisse« immer wieder.
[3.18 Protest des Offizierskorps]
Auch der Prokurator Henkel, der sich als liberaler Volksvertreter sehr populär gemacht hatte, sollte verhaftet werden, es gelang aber noch nicht. In den Nächten zogen Husarenpatrouillen durch die Straßen. Mit dem gewaltsamen Vorgehen Haynaus gegen das seine verfassungsmäßigen Rechte zäh verteidigende Volk hatte er beim Offizierkorps kein Glück. Gegen die Verkehrtheit und Verfassungswidrigkeit seiner Maßregeln sprach sich auch der Generalauditorat aus, und so kam es dazu, daß die Offiziere unter seinem Oberbefehl nicht weiter dienen wollten, und nach einem erneuten scharfen Erlaß forderten beinah sämtliche Offiziere der Casseler Garnison ihren Abschied, denen die Offiziere anderwärts liegender Truppen sich anschlossen; 241 Offiziere vom General abwärts waren es im ganzen.
Ganz Cassel war in Jubel über den Schritt des Offizierkorps; es wurde ein Fonds gegründet, der den Verabschiedeten zinsfreie Darlehen zur Verfügung stellte. Nachdem das Militär [65] versagt hatte, für die Herstellung der Autorität der Regierung einzutreten, wurde der Bundestag in Frankfurt um Hilfe angerufen, und am 25. Oktober verhängte der Bundestag zur Wiederherstellung der gesetzmäßigen Ordnung die Exekution über Kurhessen.
In Cassel wurde der Beschluß des Bundestags nicht ernst genommen, man betrachtete ihn nur als erneuten Einschüchterungsversuch, bis am 1. November der Telegraph berichtete, daß ein bayerisches Korps und ein österreichisches Jägerbataillon bei Hanau die Grenze überschritten hätten. In Cassel war nur das Schützenbataillon zurückgeblieben, die übrigen Truppen waren nach Hanau abmarschiert. Die Nachricht vom Heranrücken der Bayern und Österreicher rief eine gewaltige Aufregung hervor, man war mehr oder weniger entmutigt. Aber wie aus dem Norden die Nachricht kam, daß von Paderborn her auch preußische Truppen heranrückten, schwanden die Befürchtungen; wußte man doch, daß Preußen nichts gegen das Volk unternehmen würde.
[3.19 Preußische, bayerische, österreichische Truppen in Kassel]
Die zuerst in Cassel einrückenden preußischen Truppen wurden deshalb von der Bevölkerung mit großem Jubel empfangen, und wir Jungen freuten uns gewaltig, als wir die ersten preußischen Pickelhauben mit dem fliegenden Adler erblickten; unsere Truppen trugen bekanntlich den Löwen am Helm. – Vor dem Einzug der Preußen war auch das letzte Bataillon der hessischen Truppen mit der Main-Weserbahn abgedampft.
Mit der Entfernung der hessischen Truppen hatte der Belagerungszustand sein tatsächliches Ende gefunden, und Friedrich Oetker wurde wieder freigelassen.
Die Hoffnung der Casselaner, daß durch den Einmarsch der Preußen die Besetzung unserer Stadt durch die Exekutionstruppen unterbleiben würde, erfüllte sich nicht. Allerdings waren die Preußen den Invasionstruppen entgegen gerückt und hatten bei Bronzell eine »Schlacht« geliefert, in der ein Schimmel gefallen sein sollte. Aber damit war es vorbei. [66] Preußen hatte sich mit Österreich in der Ollmützer Konferenz verständigt und seine schützende Hand zurückgezogen; nur ein preußisches Bataillon verblieb in Cassel zur Aufrechthaltung der Ruhe und Ordnung. Das Vorrücken der Exekutionstruppen konnte nun ungehindert geschehen; der Versuch, den Einmarsch der Truppen in die Stadt Cassel abzuwenden durch Verhandlungen preußischer Emissäre mit dem Stadtrat, um diesen zu einlenkenden Schritten zu bewegen, scheiterte, man wollte sich zu keinerlei Nachgeben verstehen.
Am 16. Dezember erschien in Cassel der österreichische Feldmarschall Graf Leiningen, dem bald darauf die bayerischen und österreichischen Truppen folgten und die Stadt Cassel in ein Heerlager verwandelten. Daß diese Gewaltmaßregel, an die man nicht recht glauben wollte, dennoch zur Ausführung kam, rief eine arge Erbitterung bei der Einwohnerschaft hervor, die wir Jungen aber nicht teilten, denn wir fühlten uns sehr wohl in dem Verkehr mit der Soldateska. Auch die weibliche Bevölkerung, die ihre Schätze aus den militärischen Kreisen – wie auch heute noch – besonders bevorzugte, fand eine große Auswahl schmucker, feuriger Liebhaber bei den liebenswürdigen, ihnen geschmeidigen Österreichern, die gegen unsere derben Bauernjungen sehr vorteilhaft abstachen.
[67] 4. Aus meinen letzten Schuljahren 1851–1856.
[4.1 Einquartierungen an Weihnachten]
Es war am Weihnachtsabend 1850 – unser Vater wollte sich mit uns Kindern, die wir kurz vorher unsere Mutter verloren hatten, zur Weihnachtsbescherung in der Müllergasse zum Großvater begeben – als wir, aus dem Hause tretend, zu unserer großen Überraschung die ersten bayerischen Soldaten, feldmarschmäßig ausgerüstet, vorbeimarschieren sahen; ohne Sang und Klang, bei starkem Schneefall rückte das bayerische Militär in die Stadt ein und nahm Aufstellung auf dem Königsplatz. – In der Dunkelheit der nur spärlich mit einer Laterne beleuchteten Straße machten die in ihre großen Mäntel eingehüllten Krieger mit ihren, uns völlig fremden Raupenhelmen einen unheimlichen Eindruck, der noch erhöht wurde durch die großen blechernen Feldkessel hinten auf dem Tornister vieler Soldaten. – Ein Gerücht, welches den Bayern vorausgehend unter uns Kindern verbreitet war, flößte uns Angst und Furcht ein; es wurde nämlich erzählt, daß die Bayern furchtbar viel essen könnten, ja, es seien die reinen Menschenfresser, dazu wären die großen Kessel da, so hieß es.
Mit der Weihnachtsbescherung war es für meinen Vater vorbei, wir Kinder gingen allein mit unserer Karoline, so hieß unser Mädchen, zum Großvater – er aber blieb zu Hause und erwartete sorgenschwer die alsbald eintreffende Einquartierung, für deren Unterkunft zwei Zimmer im ersten Stock, nach hinten liegend, bereitgehalten waren. – Als wir Kinder zurückkamen, fanden wir vier Bayern in unserer Wohnstube, die mit ihren Kommißgerüchen zur Verbesserung der Luft nicht beitrugen und außerdem noch die Stube vollspuckten. – Was [68] für schwere Stunden mag mein armer Vater mit Gefühlen tiefster Erregung durchlebt haben, in dieser Zeit, wo ihm, der mit seinen fünf Kindern alleinstand, die Frau und treue Helferin fehlte!
Mit den Bayern rückte zugleich ein österreichisches Jägerbataillon in die Stadt ein, schmucke Leute, die mit ihren graugrünen Uniformen und Federhüten sich sofort die Gunst der Casselaner erwarben. – Wegen der Hahnenfedern auf den Hüten bekamen sie den Namen »Kikeriki«. Diesen Truppen folgten dann österreichische Infanteriekolonnen mit weißen Waffenröcken und enganschließenden blauen Trikothosen, und bald darauf österreichische Artillerie in braunen Uniformen.
[4.2 Alltag mit den Einquartierungen]
Die Österreicher mußten jeden Morgen auf dem Friedrichsplatz zum Appell antreten, der mit einem Gebet eingeleitet wurde, wobei die Kopfbedeckungen abgenommen wurden.
Wir Jungen hatten oft Gelegenheit, diesem in unserer Nähe stattfindenden Schauspiel andächtig beizuwohnen, zumal unsere Schulferien erheblich verlängert wurden, weil die Schulen, besonders unsere Realschule, bei den großen Truppenmassen zur Unterbringung derselben die Räume hergeben mußte.
Daher konnten wir jeden Morgen einige Kompagnien österreichischer Jäger vor unserem Hause vorbei nach dem Friedrichsplatz marschieren sehen, mit Hornisten an der Spitze, die das mir noch erinnerliche Signal zum Marschantritt bliesen:
Außer den Bayern und Österreichern wurden vorübergehend noch preußische Truppen, ein Schützenbataillon und 32er Infanterie, einquartiert, so daß wir fast zu gleicher Zeit [69] Bayern, Preußen und Österreicher im Quartier hatten. In einer Nacht, die mir noch erinnerlich ist, hatten wir 10 Mann zu gleicher Zeit im Quartier, wovon einige, bei unseren beschränkten Wohnungsverhältnissen mit uns Jungen zusammen schlafen mußten, weil sie nicht anders untergebracht werden konnten; ich hatte in meinem Bette einen Bayern zum Schlafkameraden. Die Österreicher und Preußen waren anständig und manierlich in ihrem Benehmen, unser Vater nahm sie deshalb mehrfach mit auf die Felsenkeller und traktierte sie dort, wofür sie sich sehr dankbar erzeigten. Die Bayern dagegen waren vielfach rohe und brutale Menschen, die meinem Vater oftmals das Blut in Wallung brachten. – Unter anderm warf ein bayerischer Unteroffizier vor meinen Augen meinem Vater, der auf dem Hofe vor der Werkstätte an seiner Arbeit saß, ein Stück Blutwurst, das ihm zum Frühstück vorgesetzt war, aus dem Fenster herab vor die Füße mit lautem Schimpfen: »Er verlange besseres Frühstück.«
Mein Vater war außer sich über dies brutale Benehmen, sprang sofort zornig auf, zog sich an und eilte zu dem bayerischen Oberkommandeur mit der ihm zugeworfenen Wurst, um diesem Anzeige von der Flegelei des Unteroffiziers zu machen, was zur Folge hatte, daß dieser sofort unser Quartier verlassen mußte.
Gleich darauf trat eine günstige Wendung für uns ein; wir bekamen statt der wechselnden Truppen die Dienerschaft des Grafen Leiningen, des Oberkommandeurs der Okkupationstruppen, der im Hotel König von Preußen wohnte und dessen Pferde in dem uns gegenüberliegenden Poststall untergebracht waren; für diese Dienerschaft wurde Quartier und Verpflegung voll bezahlt. Es waren zwei Diener in Livree und ein bayerischer Chevauxleger als Ordonnanz, mit dem ich mich bald angefreundet hatte. – Für die Ordonnanz wurde das Essen in einem unserer Zimmer besonders angerichtet, was aber recht lästig war, denn der Kavallerist brachte mit seinen schweren Reiterstiefeln den Stallgeruch mit in die Stube, der [70] sich dort förmlich festsetzte. Durch den täglichen Verkehr in unserer Wohnung erlaubte sich Joseph, so wurde die Ordonnanz gerufen, sehr viel Freiheiten, und da er ein strammer, hübscher Kerl war, versuchte er sich oft in recht stürmischen Liebkosungen mit unserer Karoline; diese wehrte aber seine Angriffe resolut ab und sträubte sich kräftig, so lange wir Jungen in der Nähe waren, was bei unseren engen Wohnverhältnissen nicht zu vermeiden war. – Abends im Dunkeln aber schien sie sich mit Joseph sehr gut zu verstehen; in unserem Garten hinter dem Hause fanden beide die beste Gelegenheit zu intimer Annäherung, die ich durch Hereinrufen unserer Karoline ins Haus oft neckisch zu stören suchte, was mir hin und wieder einen »Pletsch« eintrug.
[4.3 Rückkehr des Kurfürsten]
Nach dem Einrücken der Exekutionstruppen mußte die Bürgergarde ihre Waffen abliefern, sie schied von der Bildfläche, und damit war der wieder beginnenden Reaktion der Weg geebnet. – Unser Kurfürst kehrte wenige Tage darauf aus Hanau in seine Residenz zurück mit seinen Regimentern, die seither die Casseler Garnison bildeten, deren Einrücken von der Bevölkerung mit lebhaftem Jubel begrüßt wurde.
Durch das Zusammentreffen der verschiedenen deutschen Truppenkontingente in unserer Stadt gab es vielfache Reibereien, woraus sich oftmals blutige Schlägereien entwickelten, wobei unsere Hessen mit den Preußen gegen die Bayern und Österreicher zusammenstanden.
Die Exekutionstruppen blieben bis Mitte des Jahres 1851 in Cassel und rückten erst ab, als die hessischen Truppen neu vereidigt waren, d.h. ihres Eides auf die Verfassung entbunden waren.
Im Sommer fand zum ersten Male wieder eine große Parade auf dem Bowlingreen in der Aue statt, die der Kurfürst mit einer glänzenden Suite abhielt – ein Schauspiel, das für die Casselaner und besonders für uns Jungen die größte Anziehungskraft ausübte, umsomehr, weil diesmal die Hessen wieder »ganz unter sich« waren.
[4.4 Hofleben in Kassel]
[71] In Cassel spielte damals bei den stagnierenden gewerblichen Verhältnissen der kurfürstliche Hof und das Militär die größte Rolle, um die sich das ganze öffentliche Leben drehte, das ich nach dieser Richtung hin näher zu schildern versuchen will.
Die Hofhaltung unseres Kurfürsten war nach außen hin gegenüber derjenigen anderer Landesfürsten sehr prunkvoll und mit fürstlichem Glanze ausgestattet. Der Verkehr der Gesandtschaften, Minister und hohen Militärs mit dem Hofe belebte die Stadt in vornehmster, heute völlig unbekannter Weise; die Straßen der Oberneustadt waren belebt durch glänzende Equipagen mit edlen Pferden, die besonders beim Hoftheater vor dem Beginn der Vorstellung nacheinander vorfuhren und am Schluß der Vorstellung die Herrschaften wieder abholten. Der Glanzpunkt war natürlich die Vorfahrt des Kurfürsten, seiner Gemahlin und Kinder, soweit sie volljährig waren. Trotz der Nähe des Palais fuhr der Kurfürst und seine Umgebung stets zum Theater, das er fast täglich besuchte.
[4.5 Das Hoftheater]
Im Theater selbst saß das Fürstenpaar in der Proszeniumsloge. Der Kurfürst, der nur in abgebrochenen Sätzen mit kurz herausgestoßenen Worten sich unterhalten konnte, störte durch laute Unterhaltung mit seinem Trudchen, so wurde die Fürstin, die Gertrud hieß, im Volke genannt, die Vorstellung. Die Casselaner mußten sich mit solchen Störungen abfinden, fremde Besucher empfanden diese aber sehr unangenehm und suchten sie durch »Pst«-Zischen zu hindern, doch meist ohne Erfolg.
Unser Hoftheater war damals auf der Höhe, wie kaum ein zweites im deutschen Lande; besonders die Oper unter Spohrs später Reiß’ Leitung war vortrefflich. Unter anderm war das Ensemble der Sänger Rübsam, Wachtel und Hochheimer, der Sängerinnen Masius, Seelig und Veith stimmlich wohl mit das beste, was jemals am Hoftheater aufgetreten war. – Auch das Schauspiel, Lustspiel und Ballett war auf der Höhe, letzteres unter dem berühmten Ballettmeister Ambrosio. Im [72] Lustspiel wie in der Posse war der Komiker Birnbaum ebenfalls ein Vertreter seines Faches, der seinesgleichen suchte. Er durfte sich in seinen Couplets manches herausnehmen, selbst wenn es bis zur allerhöchsten Person hinanstreifte; schließlich aber wurde ihm angedeutet, daß er in seinen Extravaganzen sich nicht zu viel erlauben dürfe. Trotzdem aber ließ er seinen Witzen ungeachtet des Verbots die Zügel schießen. – So hatte er u.a. in einer Posse einen lebenden Esel auf der Bühne zu reiten, der etwas viel Grünfutter gefressen hatte. Bei den Sprüngen auf der Bühne passierte dem Esel etwas »menschliches«, wie man sich im gewöhnlichen Leben verblümt auszudrücken pflegt, was Heiterkeit im Publikum hervorrief, die aber noch stürmischer wurde, als Birnbaum dem Esel einige feste Hiebe hinten aufzog mit dem Rufe: »Extravaganzen sind verboten«, worüber der anwesende Kurfürst selbst herzlich mitlachen mußte. – In einem anderen Stück hat er einen Kavalier, der einen Degen trug, darauf aufmerksam zu machen, daß der Degen ihn nicht im Gehen hindere; er verwechselte aber die beiden letzten Worte, so daß das Publikum in eine Lachsalve ausbrach; solche Scherze wurden noch vielfach erzählt.
Birnbaum hatte eine sehr schöne Tochter, in die sich der älteste Sohn unseres Kurfürsten, Prinz Friedrich, sterblich verliebte, und die er nachher auch heiratete. – Der mit dieser Liaison verbundene Hofskandal führte zur Entlassung Birnbaums, der in Stuttgart ein gutes Engagement fand, in dem er bis zu seinem Ende wirkte. – Die Ehe des Prinzen Friedrich mit Fräulein Birnbaum wurde bald wieder gelöst, der Prinz durfte aber nicht wieder nach Cassel kommen, er bekam Fulda zum Wohnsitz angewiesen.
[4.6 Fürstin und Prinzenerziehung]
Unser Kurfürst war bekanntlich selbst morganatisch verheiratet mit der geschiedenen Frau eines preußischen Offiziers namens Lehmann, einer geborenen Gertrud Falkenstein, die nach der Verheiratung mit dem damaligen Kurprinzen zur Gräfin Schaumburg und später zur Fürstin von Hanau erhoben wurde. – Die Fürstin war von Figur eine kleine Dame, [73] aber sie war eine Schönheit mit blühendem, feinem Gesicht, das gehoben wurde durch wundervolles, gewelltes Haar. Sie hatte auf ihren Gemahl einen großen Einfluß und unterstützte ihn in seinen autokratischen Neigungen, mit denen er, in fortwährendem Streite mit der Volksvertretung, seine Regierung unrühmlich auszeichnete. Das eheliche Verhältnis aber war, abgesehen von Zwistigkeiten, die erzählt wurden, sonst ein mustergiltiges, abweichend von dem seines Vaters und Großvaters, die sich neben ihren rechtmäßigen Frauen bekanntlich Favoriten an die linke Hand trauen ließen. – Sechs Söhne und drei Töchter waren diesem Ehebunde entsprossen, die den Titel Prinzen und Prinzessinnen von Hanau führten, aber als nicht ebenbürtige Kinder waren sie von der Thronfolge ausgeschlossen, welche nach dem Tode des Kurfürsten an die Rumpenheimer Linie übergegangen wäre.
Die Erziehung der Prinzen war eine strenge, von der übrigen Welt möglichst abgeschiedene; erst zu der Zeit, wo sie volljährig waren und in die hessische Armee eintraten, suchten sie Fühlung mit den besseren Kreisen Cassels zu gewinnen. – Der Älteste, Prinz Friedrich, war, wie gesagt, im Exil in Fulda; auf ihn folgten Prinz Moritz, der zu dieser Zeit bei der Garde du Corps als Major im Dienst stand, Prinz Wilhelm als Hauptmann beim Leibgarde-Regiment und Prinz Karl bei der Artillerie als Leutnant; die Jüngsten, Prinz Heinrich und Prinz Philipp, standen später auch bei der Leibgarde.
Von den Prinzessinnen war die älteste an den Prinzen Hohenlohe-Oehringen, die zweite an den Fürsten Ysenburg-Büdingen und die dritte an den Prinzen von Hessen-Philippsthal-Barchfeld verheiratet; letztere wurde später geschieden und lebt jetzt als Gräfin Ardeck. Der Kurfürst (s. Abbild. [zwischen den Seiten VIII und 1]), von Figur mittelgroß, etwas nach vorn gebeugt gehend, trug stets Uniform, fast ausschließlich die seines Leibgarde-Regiments. Er liebte es nicht, in der Stadt zu Fuß zu promenieren, dagegen fuhr er fast täglich, wenn er in Cassel residierte, nach Wilhelmshöhe oder umgekehrt von dort nach Cassel, stets sechsspännig mit Spitzenreitern, die Fürstin vierspännig.
[4.7 Fürstliche Fahrten zur Wilhelmshöhe]
[74] Bei besonderen Gelegenheiten oder an Festtagen wurden die berühmten Isabellen dazu ausersehen, die hohen Herrschaften zu fahren. Es war ein prachtvoller Anblick, wenn die völlig gleichmäßig gefärbten Isabellenhengste mit ihren langen Mähnen und bis zur Erde reichenden Schwänzen in reicher Aufschirrung mit dem fürstlichen Galawagen aus dem Torweg des Schlosses am Friedrichsplatz herausfuhren. In dieser Beziehung machte kein deutscher Bundesfürst einen größeren Aufwand wie unser Kurfürst. Es ist bekannt, daß er bei dem Fürstenkongreß, der 1861 in Frankfurt a.M. stattfand, mit seinen Prachtgespannen allen anderen Fürsten voraus war. Auf Wilhelmshöhe promenierte der Kurfürst in den Anlagen, die damals besonders gut gepflegt waren (besser wie jetzt); sie wurden nicht soviel vom Casseler Publikum besucht wie heutzutage. Cassel hatte etwa den vierten Teil der Bevölkerung, es gab auch weder Eisenbahn- noch Straßenbahnverbindung, durch die jetzt viele tausende Besucher so bequem hinauf befördert werden.
Die Casselaner hatten auf Wilhelmshöhe vielfach Gelegenheit, dem Kurfürsten mit seiner Frau zu begegnen, sie zogen es aber vor, dem Kurfürst auszuweichen, um nicht grüßen zu müssen, weil er sich nicht beliebt zu machen verstand. So machte es auch mein Vater, obgleich er als Hofwagenlackierer mit dem Hof in geschäftlicher Beziehung stand. Wenn wir Jungen allein ihm begegneten, wurde vorher verabredet, ob wir »betzeln«, d.h. die »Betzel« (Mütze) abziehen wollten oder nicht; in letzterem Falle schwenkten wir in einen Seitenweg ein, um eine Begegnung zu vermeiden.
Man sieht daraus, wie nachteilig die andauernden politischen Verfassungskämpfe zwischen Fürst und Volk in Kurhessen selbst auf die heranwachsenden Untertanen einwirkten; der Respekt vor unserem Landesfürsten kam derzeit nicht so zum Ausdruck, wie er jetzt zur Gewohnheit geworden ist, wo fast bei jeder Begegnung mit dem Landesfürsten kräftig »Hurra« geschrieen wird, sobald mehrere Personen zusammenstehen.
[4.8 Ausflüge der Fürstin]
[75] Die Fürstin machte ihre Spaziergänge vielfach allein oder mit ihrer jüngsten Tochter, der bildschönen Prinzeß Marie. Sie trug, der damaligen Mode entsprechend, einen Reifrock (Krinoline) von mächtigem Umfang, sodaß die kleine Dame fast so breit wie hoch war. In ihrer Begleitung waren, außer dem in respektvoller Entfernung stets einen Regenschirm tragenden Hoflakai, mehrere kleine Seidenpudel, für die sie besondere Liebhaberei hegte.
Ich entsinne mich eines Vorfalls, der die Fürstin durch diese Liebhaberei in eine fatale Situation brachte, und dessen Augenzeuge ich war. In der Wilhelmshöher Allee, in »Schmidts Garten« (später Höhmannsches Grundstück), auf dem jetzt die Realschule erbaut ist, verkehrte ich mit meinen Freunden, während ich zur Tanzstunde ging. Eines Tages promenierte die Fürstin mit ihren Schoßhündchen, gefolgt von einem Kammerlakai, in der Wilhelmshöher Allee. Von den Hündchen mußte eines weiblichen Geschlechts gewesen sein. Der große braune Hühnerhund des Restaurateurs Schmidt, der vor dem Hause lag, suchte nämlich sofort eine zärtliche Liebeswerbung anzuknüpfen, indem er das ängstliche kleine Tier verfolgte. Das Hündchen wehrte sich nach Kräften, war aber dem täppischen Hühnerhund nicht gewachsen und flüchtete sich mit verkniffenem Schwanze unter die Krinoline der Fürstin. Es war für uns Zuschauer hinter dem Fenster eines Restaurationszimmers ein Gaudium, mit anzusehen, wie die Fürstin mit ihrem Reifrock – den der Hühnerhund in respektwidrigster Weise mit dem Kopf in die Höhe hob, um mit der Nase an das Hündchen heranzukommen – sich drehte und wendete, außer sich vor Ärger und Verlegenheit. Der Hoflakai versuchte mit seinem Regenschirm den Hund zu vertreiben, indem er nach ihm stieß, auch wenn er halb unter der Krinoline der Fürstin war. Aber der lüsterne Köter ließ erst dann von dem Hündchen ab, als sein Herr mit einem Knüppel kam und auf ihn einschlug; der Lakai hob dann den Hund der Fürstin auf und nahm ihn auf den Arm, der schleunigst voller Zorn den Rückweg antretenden Fürstin folgend.
[76] Am andern Tag kam ein Leibjäger mit dem Befehl des Kurfürsten, den Hund totzuschießen; es gelang ihm aber nicht, den Befehl auszuführen, weil Schmidt den Hund aufs Land geschafft hatte und Protest gegen die offenbare Rechtsverletzung erhob.
[4.9 Fürstlicher Jähzorn]
Die Beamten des Hofes hatten bei dem reizbaren Temperament unseres Kurfürsten, das sich oft bis zum Jähzorn steigerte, keinen leichten Stand. – In Zornesausbrüchen vergaß sich der Kurfürst oft und regalierte seine Dienerschaft mit den Fäusten, oder er trat mit den Füßen nach ihnen. Bei einem erregten Auftritt mit seinem Kammerdiener Hartdegen, der im Palais der Fürstin von Hanau, das ich später kaufte, stattfand, trat der Kurfürst nach ihm; Hartdegen aber fing den Fußtritt mit der Hand auf und brachte Se. Königliche Hoheit zu Falle, so daß er, wie man erzählte, in einen Spiegel fiel und sich verletzte. Der »Fall« wurde für den Kammerdiener aber ein kritischer, weil er sofort ohne Pension entlassen wurde.
Der Vorgang wurde alsbald stadtbekannt, Hartdegen erlangte eine gewisse Volkstümlichkeit bis über die Grenzen unseres Kurstaates durch die Presse, in der die Mißregierung des Kurfürsten einen stehenden Artikel bildete. Ein Kapital, das durch freiwillige Spenden aufgebracht wurde, setzte den entlassenen Diener in den Stand, seinen Lebensunterhalt auf einem anderen Gebiete zu suchen, er wurde Gastwirt und übernahm ein Hotel in Koburg.
Später, nachdem unser Kurstaat von Preußen annektiert war, kam H. wieder nach Cassel und wurde Pächter der »Stadt Stockholm«. Die Bezeichnung »der verfehlte Fuß(?)tritt« aber blieb lange Zeit mit seiner Person verknüpft.
[4.10 Eigenheiten des Fürsten]
Ein Auftritt, den ich später selbst mit erlebt habe, kennzeichnet die Eigenart des hohen Herrn und mag, obgleich ich ihn meinen Angehörigen öfters erzählt habe, auch hier nicht unerwähnt bleiben.
Im Jahre 1861 kam ich nach längerer Abwesenheit auf einige Tage von Hannover nach Cassel. Bei einem Spaziergang [77] nach Wilhelmshöhe besuchten wir unsern Onkel Sennholz, den dermaligen Hofgartendirektor, welcher mit uns einen Spaziergang durch die Parkanlagen machte, um uns u.a. auch Neuheiten in Beetpflanzungen zu zeigen. Mit besonderem Stolze zeigte er uns das große Beet, das bis vor kurzem noch mit hochstämmigen und niedrigen Fuchsien bepflanzt, an dem breiten Wege vom Treibhaus nach der großen Fontäne zu liegt. Das Beet war damals dicht bepflanzt mit 1 – 1 ½ Meter hohen Malven (Stockrosen), die fackelförmig, kerzengerade in die Höhe ragend, ringsum mit Blüten in den verschiedensten Farben besetzt waren.
Während wir vor dem Beete standen und dasselbe bewunderten, kam der Kurfürst mit der Fürstin von der Fontäne hergegangen, mit der er, von einer Reise zurückgekehrt, seinen ersten Rundgang durch den Park machte. Sennholz konnte nicht mehr ausweichen und erwartete den Kurfürst mit der Dienstmütze in der Hand; wir verschwanden indessen hinter dem nächsten dichten Blutnußstrauch, konnten aber alles sehen und hören, was vorging. Der Kurfürst besah das ihm noch neue Beet, das aber seinen Beifall nicht fand, und redete Sennholz in der ihm eigenen abgebrochenen Weise an: »Äh – Gartendirektor – ist das? Nit gefallen will – scheußlich – was anderes hinpflanzen – !« Sennholz drehte erregt seine Mütze zusammen, die er mit den Händen hinter sich hielt und entgegnete dem Fürsten mit fester Stimme, daß diese Bepflanzung jetzt modern sei und in allen herrschaftlichen Parks zu Beetpflanzungen benutzt werde. Der Kurfürst unterbrach ihn kurz mit den Worten: »Nix davon wissen will – scheußlich – wegmachen« und ging weiter, nachdem Sennholz gesagt hatte: »Zu Befehl, königliche Hoheit!«
Der Gartendirektor wendete sich mit vor Erregung gerötetem Gesicht wieder zu uns, voller Entrüstung über den Kurfürsten, dem er Mangel an Verständnis nachsagte. Gleich darauf kam der das Fürstenpaar begleitende Lakai eilenden Schrittes zurück und rief Sennholz zum Kurfürsten, der [78] entgegenkommend ihm zurief: »Gartendirektor gesagt haben – andere fürstliche Parks auch solche Beete haben – scheußlich – aber dann doch stehen lassen – nix wegnehmen – !«
[4.11 Militärparaden]
Bei gutem Wetter fanden in Cassel Sonntags zwei militärische Paraden statt, die der Kurfürst persönlich abnahm; um 11 Uhr die erste, die Kirchenparade, nach Schluß des Gottesdienstes in der Garnisonkirche, und eine halbe Stunde später die außerdem alltäglich stattfindende Wachtparade. – In regelmäßiger Abwechselung mußten jedesmal verschiedene Truppenteile Infanterie und Kavallerie oder Infanterie und Artillerie den Gottesdienst besuchen. Vorher wurden die Fahnen aus dem Palais abgeholt, dann trat die Infanterie auf dem Königsplatz aus dem Gewehr; nachdem diese in Reihen je zu drei oder vieren zusammengestellt und an der Spitze die Trommeln, Schellenbaum und Instrumente regelrecht aufgebaut waren, zogen die Truppen zur Kirche. Am Schluß des Gottesdienstes traten die Truppen auf dem Königsplatz wieder unters Gewehr und zogen mit Musik und Trommelschlag, die Fahnen vor den Zügen, durch die untere Karlsstraße nach dem Palais, vor dem Aufstellung genommen wurde. Alsdann kam der Kurfürst mit seinen Adjutanten und dem Gefolge aus dem Palais, die Truppen präsentierten, die Fahnenträger defilierten mit den Fahnen, begleitet von Fahnenoffizieren, vor dem Kurfürst vorüber ins Palais, und nachdem sie zurückgekehrt, wieder in Reihe und Glied standen, marschierten die Truppen im Paradeschritt am Kurfürst vorbei die Königsstraße hinunter in ihre Kasernen.
Beim Anmarschieren der Truppen wurde, sobald die Truppe aus der Karlsstraße nach dem Palais umschwenkte, stets der hessische Fahnenmarsch gespielt, den ich hier unten wiederzugeben versuchen will:
[79] Bis zum Kommando »Parade Halt« wurde der Marsch immer wiederholt und dann abgebrochen.
Alsbald nach der Kirchenparade zog die tägliche Wachtparade auf, von der Infanterie-Kaserne über den Königsplatz zum Friedrichsplatz, etwa zwei Kompagnien stark, die sich am oberen Ende des Friedrichsplatzes vor den Lindenbäumen, fast die ganze Breite des Platzes einnehmend, aufstellte. Gegenüber, etwa in der halben Entfernung bis zum Denkmal Landgraf Friedrichs, stand das Offizierkorps, von dem eine Anzahl Offiziere jedesmal während der Parade zusammentrat und die Parole in Empfang nahm. Die Parade wurde geführt durch einen Regiments- oder Bataillons-Kommandeur zu Pferde, der beim Einschwenken der Züge von der Königsstraße in kurzem Trab bis mitten vor das Offizierkorps auf den Platz ritt, dort Aufstellung nahm und die Parade kommandierte; unter diesen ist der »dicke v. Heimrod« als »gewichtige« Person gewiß noch manchem in Erinnerung.
Bald nach vollzogener Aufstellung kam Sonntags der Kurfürst mit seiner Suite zu Fuß aus dem Palais, die breite Gasse durchschreitend, die das von Gardegendarmen zurückgehaltene Publikum bildete. Die Truppen präsentierten beim Betreten des Paradeplatzes unter den Klängen des Parademarsches, der dem preußischen ähnlich war. Auf den Kommandeur zuschreitend, begrüßte der Landesherr diesen und die Offiziere und schritt darauf die Front der in Parade stehenden [80] präsentierenden Truppen ab; darauf wurde »Parade in Zügen links schwenkt – marsch« kommandiert und im Parademarsch mit »Augen rechts« vor dem allerhöchsten Kriegsherrn vorüber marschiert. Beim Verlassen des Friedrichsplatzes verteilten sich sofort die verschiedenen Wachen nach den einzelnen Toren usw.; das Musikkorps zog mit der Hauptwache zum Auetor, an dem jeden Tag nach der Parade vier Nummern gespielt wurden; ein Genuß, der uns jetzt leider nur am Sonntag geboten ist.
Die Regimentsmusiken kannten damals noch keine eisernen Notenständer, die Noten wurden gehalten, entweder von Soldaten oder auch von Casseler Jungen, die sich gern zu dieser Dienstleistung herandrängten. Das hervorragendste Musikkorps war die Regimentskapelle des Leibgarde-Regimentes, deren Musiker alle Künstler und meist Mitglieder des Hoftheaterorchesters waren. Die Leistungen dieses sehr starken Elitemusikkorps unter seinem vorzüglichen Kapellmeister, dem »alten Bochmann«, waren in ganz Deutschland berühmt, kein Staat konnte damals ein besseres Musikkorps ausweisen, wie das unseres Leibgarde-Regiments.
Wir Casselaner waren auch besonders stolz darauf; wenn das Leibgarde-Regiment zur Parade zog, war allemal der Platz vor dem Auetor gedrängt voll andächtig der herrlichen Musik lauschender Menschen; ich habe mit Hochgenuß, so oft ich konnte, zugehört und noch manches aus der damaligen Zeit im Gedächtnis behalten. Der präsumtive Thronerbe von Kurhessen, Landgraf Friedrich, hatte der Gardekapelle echt silberne Instrumente und der Garde du Corpsmusik silberne Kesselpauken gestiftet, wodurch er beide Korps besonders auszeichnete.
Durch unsere nahe dem Königsplatz hinter der Post gelegene Wohnung hörten wir jeden Tag die Musik der aufziehenden Wachtparade; die verschiedenen Märsche, darunter der Preciosa-Marsch an erster Stelle, sind unvergessen bei mir geblieben.
[4.12 Zapfenstreich, Fürstengeburtstag]
[81] Jeden Abend um 9 Uhr schallte bis zu unserem Hause der Zapfenstreich vom Kasernenplatz herüber, der von Trommlern und Pfeifern bei langsamem Schritt über den Kasernenhof nach einer Melodie gespielt wurde, die untenstehend abgedruckt ist.
Der Geburtstag des Landesfürsten und allerhöchsten Kriegsherrn wurde von der Bevölkerung nicht gefeiert, dagegen wurde dafür gesorgt, daß dieser Tag vom Militär festlich begangen wurde. Die sämtlichen Kasernen wurden mit Eichen-Girlanden bekränzt; auf dem Kasernenhof wurde ein ebenfalls bekränztes Podium für die Musik aufgeschlagen und Abends schwelgten die Soldaten mit ihren Schätzen beim Tanz [82] um dies Podium. Ringsum strahlten die Fenster der Kasernen, durch kleine Lichtchen illuminiert. Die Soldaten wurden mit Braten, Salat und Bier in die richtige Feststimmung gebracht, die sich auch auf uns Jungens, aber besonders auf das weibliche Gesinde übertrug, das an diesem Abend nicht im Hause zu halten war.
In der Nähe unseres Hauses, hinter der Mauer, auf den Totenhöfen und im grünen Weg wurden Liebesschwüre erneuert oder nur vorübergehend ausgetauscht; für uns Jungen war es ein Gaudium, wenn wir die Paare in ihren zärtlichen Umarmungen stören konnten.
Die Vorliebe des Kurfürsten für seine Soldaten fand durch solche feierliche Veranstaltungen wieder Gegenliebe bei den Truppen, die sich in soldatischen Gesängen kund gab; wir konnten diese oft hören, wenn die Gardisten hinter der Kaserne beim Kartoffelschälen sangen, darunter das beifolgende beliebte Lied:
[4.13 Wiederverheiratung des Vaters]
Im Jahre 1852 verheiratete sich mein Vater in zweiter Ehe mit unserer Tante Elise Scheurmann, der Schwester seines Schwagers, des Kaufmanns Heinrich Scheurmann. Tante Elise war eine treue Freundin unserer seligen Mutter; die Kinder in der ganzen Familie waren ihr wegen ihres freundlichen, seelensguten Wesens zugetan, wir verwaisten Kinder ganz besonders.
Im Sommer 1852 waren wir Kinder mit unserem Vater, seiner Schwester, Tante Minchen, und unsern Verwandten Scheurmanns und Henkels in Schaumburgs Garten, einem damals sehr beliebten Sommerlokal am Weinberg. In dem [83] ausgedehnten Garten lagen die Sitzplätze zerstreut zwischen den dichten Gebüschen, wovon einer von unserer vereinten Familie eingenommen wurde zum gemeinschaftlichen Nachmittagskaffee. Wir Kinder spielten mit unseren Vettern auf den großen Wiesenflächen; als wir vom Spielen zurückkamen, trat uns der Vater mit Tante Elise am Arm entgegen, die uns Kinder herzte und küßte, und mit glückstrahlendem Gesicht unter Freudentränen uns sagte, daß sie unsere Mutter werden sollte, ob wir sie auch lieb haben wollten.
Unser Vater, der uns Kindern zu sehr Respektsperson war, bestätigte uns, daß wir von nun ab wieder eine Mutter haben würden, der wir rechte Freude machen sollten. Der Jubel bei uns Kindern war natürlich groß darüber, daß Tante Elise nun uns gehörte und nicht mehr Scheurmanns, bei denen sie seither gelebt hatte.
Mit unsern Vettern Scheurmann, die immer behaupteten, größere Rechte an Tante Elise zu haben, kamen wir oft in Streit hierüber, der am Tage der Hochzeit in der Wohnung unseres Großonkels, des Hofgärtners Schmidtmann in der Karlsaue, dem größere Räume zu Gebote standen – sogar in eine regelrechte Rauferei unter uns Vettern ausartete.
Unsere neue Mutter verstand es, durch treue Sorge und liebevolles Wesen unsere Herzen immer mehr zu gewinnen, so daß wir niemals andere Gefühle für sie wie die für unsere richtige Mutter empfunden haben. Mein Vater konnte keine glücklichere Wahl treffen in seiner zweiten Frau, unserer Mutter, deren Charaktereigenschaften ihm lange bekannt waren. Klein von Figur, aber dabei rüstig und gesund, besaß unsere Mutter bei regem Geist eine Unverdrossenheit in der vielen Arbeit des großen Haushaltes, eine Pflichttreue und Herzensgüte gegen alle, die ihr nahestanden, dabei eine Anspruchslosigkeit, gepaart mit heiterem Sinn und stets gleichem Wesen, so daß ihr alle zugetan waren, die sie kannten. – Im Gegensatz zu meinem Vater, der streng und ernst in seiner Lebensauffassung, Schmidtmannsches Blut in seinen Adern [84] hatte, das bei allem, was ihm nicht recht erschien, leicht in Wallung geriet, bewahrte meine Mutter stets ihre Ruhe und Gelassenheit; sie wußte jeder unangenehmen Sache die bessere Seite im versöhnlichen Sinne abzugewinnen und suchte sich in alle Lagen des Lebens zu schicken. Sie war deshalb aber auch keine strenge Erzieherin; die Erziehung ruhte in den Händen unseres Vaters, der sie konsequent bis zur Konfirmation durchführte und besonders uns drei ältesten Jungen streng in seiner Zucht hielt. Wir fürchteten seine Strenge, die uns hart, oft recht hart erschien, wenn wir (besonders ich) mit einer Tracht Prügel traktiert wurden, über Streiche, die uns gar nicht so strafwürdig erschienen. Aber unser Vater verstand es auf der anderen Seite wieder, freudige Empfindungen in uns wach zu rufen, er nahm uns an arbeitsfreien Sonntagen – nicht jeder Sonntag war arbeitsfrei – mit hinaus in die schöne Umgebung unserer Stadt, machte weite Spaziergänge in unsere herrlichen Wälder und suchte uns auf alles in der Natur aufmerksam zu machen, um unseren Sinn für Naturschönheiten zu wecken. In den Sommerferien 1854 machte mein Vater mit seinen zwei Schwägern Scheurmann und Henkel, jeder mit drei Söhnen, eine mehrtägige Reise nach Thüringen über Eisenach, Friedrichroda, das damals noch ein armseliges Dorf war, nach dem Inselsberg usw. In Friedrichroda wohnten wir im Gasthaus »Zur goldenen Henne«. Wie wir dort nach strapaziösem Marsch unsern Durst löschen wollten, sollte sich unser Führer – er hieß Jacob Frank – erkundigen, was es zu trinken gebe, worauf er trocken erwiderte: »Säh bruchet sich nit ze scheniere, ich trinke ’n Schnäpschen«, eine drollige Antwort, die uns später noch oft amüsierte; wir bekamen Bier in Kruken, das uns, wenigstens mir, schließlich schlecht bekam, denn beim letzten Glas aus einer solchen Kruke kam eine mächtige Kreuzspinne zum Vorschein, die bei mir unangenehme Folgen hervorrief.
[4.14 Väterliche Arbeit und Autorität]
Vater war von früh morgens bis zum Abend in seinem Geschäft tätig, er arbeitete zumeist in den Werkstätten zwischen [85] seinen Leuten. Zum Frühstück, Mittagessen und Nachmittagskaffee kam er in die Wohnung zu kurzer Erholung. Nur wenn er für den Hof oder Kavaliere die Wappen an die Wagentüren der kurfürstlichen oder herrschaftlichen Equipagen zu malen hatte, saß er im Zimmer vor der Staffelei. In seinen Mußestunden, wenn ihm die Arbeit freie Zeit ließ, saß der Vater im Sopha und las Bücher, die er aus der Meßnerschen Leihbibliothek am Martinsplatz im Abonnement sich holen ließ, die wir Jungen ihm stets dort umtauschen mußten.
Solange unser Vater im Zimmer war, mußten wir Kinder uns absolut ruhig verhalten und durften nicht laut werden; wir unterhielten uns nur flüsternd, gingen auf den Fußspitzen, um nicht zu hart aufzutreten und den Vater zu stören. Bei Tische ging es lautlos zu, weil Vater keine Unterhaltung liebte; wenn wir uns einmal vergaßen und eine Unterhaltung anfangen wollten, hieß es »tropft die Mäuler«, dann durfte kein Wort mehr gesprochen werden. – Diese strenge Ordnung war damals in den bürgerlichen Familien nichts außergewöhnliches, wo auf Zucht und Sitte gehalten wurde.
Der Respekt vor der väterlichen Autorität war bei Kindererziehung ein strenges Gebot, das sich von selbst verstand. In vielen Familien ging es so weit, daß die Eltern, besonders aber der Vater, von den Kindern mit »Sie« angeredet wurde. Zwischen Schwiegereltern und Schwiegerkindern war dies allgemein Sitte. Wir Kinder redeten unsere Großeltern mit »Du« an, aber der Schwiegersohn, unser Vater, redete den Schwiegervater »Herr Vater« und umgekehrt der Großvater den Vater mit »Herr Sohn« an.
[4.15 Alltagsvergnügungen]
Die ganze Lebensführung der damaligen Zeit war in allen Kreisen, im Vergleich zur heutigen, so äußerst bescheiden und anspruchslos, wie sie heute vielleicht kaum noch in kleinen Landstädtchen besteht. Bei alledem fühlte man sich glücklicher und zufriedener; die Menschheit war nicht so verwöhnt wie heute, wo Genußsucht und Verschwendung vorherrschen. Es [86] gab, wie bereits erwähnt, weder feine Restaurants, in denen man in materiellen Genüssen schwelgen konnte, noch gab es die vielen Theater, Variétés und sportlichen Veranstaltungen, die jetzt kaum mehr entbehrt werden können, wenn man den Anforderungen des modernen Lebens gerecht werden will. Mit Ausnahme des Hoftheaters und einzelner Sonntagskonzerte auf dem Felsenkeller fand man nur während der Messe Gelegenheit, zur Abwechselung Unterhaltungen in mannigfachen Schaubuden zu genießen, zu denen auch wir Kinder von unserem Vater bei besonderen Vergünstigungen mitgenommen wurden.
Dagegen fehlte es nicht an öffentlichen Veranstaltungen auf den Straßen, die jetzt als Belästigung des Publikums oder als Verkehrsstörung gelten und deshalb gänzlich untersagt sind. – Tanzbären, Kamele mit Affen, Straßenmusikanten, Dublinsackpfeifer, Savoyarden mit Drehorgeln mit und ohne bewegliche Figuren durchzogen die Straßen und gaben ihre Vorstellungen. Während der Messe standen an mehreren Straßenecken am Wall große Bilder mit schauerlichen Darstellungen von Mordgeschichten, die mit Orgelbegleitung in entsetzlichen Versen mit noch ertsetzlicheren Stimmen besungen wurden. Das Hauptvergnügen aber bereitete das Kasperletheater, an dem nicht allein die Jugend, sondern auch das Alter sich ergötzte. Der Kaspar, der Teufel und seine Großmutter, das Ungeheuer mit seinem großen roten Rachen, der Henker mit dem Galgen waren typische Figuren, die in jeder Vorstellung die Hauptrolle spielten. Mit einer verstimmten Trompete wurde das Signal zum Anfang der Vorstellung gegeben, zu der der Ausrufer mit heiserer Stimme das Publikum heranrief. Das alles waren die bescheidenen Genüsse, an denen man sich erfreute, die aber auch nicht mit schwerem Gelde ausgewogen wurden, einige Heller genügten, wer nichts geben wollte, hatte den Genuß umsonst.
[4.16 Messen]
Abb. rechts: Das Meßhaus stand an der Oberen Königsstraße, Ecke Wilhelmstraße (hinten); auf der Abbildung ist ganz rechts der damalige Meßplatz zu sehen, der bis zur Fünffensterstraße reichte. Heute steht auf dieser ganzen Fläche das Rathaus. Hier klicken (→) für eine Website des »Geoportals« der Stadt Kassel, auf der man historische Pläne mit einem aktuellen Stadtplan überblenden kann.
Drei Fotos aus einem Prospekt von 1908:

Die Obere Königsstraße mit Blick in die Wilhelmsstraße auf die Karlskirche. Das Rathaus ist ganz rechts zu erahnen. Das auf dem Bild so prominente Eckhaus ist in der Text-Abbildung des ehemaligen Meßhauses ganz links zu sehen.*MA

Die Obere Königsstraße, links hinten das Rathaus.*MA

Die Wilhelmsstraße von der Oberen Königsstraße aus.*MA
[Zwischen den Seiten 88 und 89:]

Das ehemalige Meßhaus an der Königsstraße.
Derartige Belustigungen und Schaustellungen waren in der Regel, wie auch heute noch, mit der Messe verbunden. Die [87] Messen von damals waren in handelswirtschaftlicher Beziehung von großer Bedeutung. Auch für unsere Stadt war die Messe, deren Beginn und Schluß durch Glockengeläute vor der Martinskirche ein- und ausgeläutet wurde, geradezu unentbehrlich; die kleinen Geschäfte sowohl, wie die Bevölkerung im allgemeinen machten ihre Einkäufe bei den namhaften auswärtigen Firmen, welche alljährlich mit ihren reichhaltigen Wanderlagern die Casseler Messe beschickten. In der oberen Carlsstraße und am Meßplatz und obere Königsstraße waren in fast allen Häusern die Wohnungen des Erdgeschosses während der Messe als Lager- und Verkaufsräume an solche Geschäfte vermietet, die außerdem noch im Meßhause (s. Abbild.) Unterkunft finden konnten. Auch meine Eltern kauften auf der Messe ein, und ich entsinne mich dabei einer Firma »Helft« aus Braunschweig, deren Reisender – ein sehr fideler Herr namens Hanke – in unserm Hause verkehrte. Eine typische Persönlichkeit, die zu jeder Messe auf der Bildfläche erschien, war »der Schlawitzer« – ein jüdischer Händler mit rötlichem Haar, der, in seiner Art ein Original, als lebendiges Magazin in den Bürgerhäusern hausieren ging. Was in seinen Kleidungsstücken nur irgendwie unterzubringen war, führte er an allerlei Waren mit sich, u.a. silberne Löffel, Messer, Gabeln, Hosenträger, Operngläser, Uhren, Unterzeuge, Schmucksachen, Kurzwaren und Gott weiß, was alles. Aus den Stiefelschäften, aus allen Taschen von Hose, Rock und Weste, ja selbst aus der Mütze kramte er seine Artikel hervor; über einer Schulter hängend, trug er einen vollgepfropften Tornister von braunem Kalbfell, den er in schiefer Haltung stets mit sich schleppte. Seine Kundschaft war in der ganzen Stadt verbreitet, die er mit seinen Artikeln versorgte; er konnte mit allem dienen, – was er nicht bei sich hatte, brachte er das nächste mal mit. Keiner verstand besser sein Geschäft zu machen, wie der Schlawitzer; erst forderte er hohe Preise, seine Ware mit großer Zungenfertigkeit anpreisend; wollte das Geschäft so nicht gelingen, dann bot er sich selbst immer mehr [88] herunter, bis er den angebotenen Gegenstand, halb verschenkt, an den Mann gebracht hatte mit den Worten: »Fort mit Schaden!« Der Schlawitzer wohnte meist im Gasthaus »Zum Hessischen Hof« am Martinsplatz und hatte dort sein Lager. Wenn Käufer sich ihre Einkäufe vom Lager aussuchen wollten, gab er diesen vorher in jede Hand eine brennende Kerze, um dadurch zu verhüten, daß hinter seinem Rücken gemaust wurde. Heute noch ist die Bezeichnung »Schlawitzer« mitunter im Gebrauch bei solchen Personen, die auf ähnliche Weise ihr Geschäft zu machen suchen – gewiß mancher meiner Leser wird nicht gewußt haben, woher dieser Beinamen stammt – – –
[4.17 Spiele der Jugend]
Der Jugend von damals gehörte die Straße mehr wie heute, ihre Spiele wurden weder durch den Verkehr gestört, noch durch die Polizei, deren Macht repräsentiert war durch wenige Polizeidiener, die sich im Stadtgebiet verteilten, und einen Polizei-Kommissar. Der letzten einer aus der hessischen Zeit war Kommissar Eiffert, der sich, seiner Stellung selbst bewußt und dabei von stattlicher Figur, später der besonderen Gunst des ersten preußischen Polizeidirektors Albrecht zu erfreuen hatte.
Hinter der Mauer, auf der Straße vor unserem Hause, fanden wir Kinder uns mit denen unserer Hausgenossen, Schads, Nagels u.a., nachdem wir die Schularbeiten gemacht hatten, zusammen zu gemeinschaftlichen Spielen, die je nach der Jahreszeit wechselten. Im trockenen Sommer spielten wir mit »Wackeln« (kleinen polierten Steinkugeln) in verschiedenen Spielarten: »Anwerfen, Knipsen, Schuckeln und Schmacken«, wobei versucht werden mußte, daß der eine Spieler seine Wackeln so anwarf, knipste oder schuckelte, daß er diejenigen des andern berührte, die dann für diesen verloren waren. Ferner spielte man »Dullern«, d.i. den »Dullertopp« schlagen, ein Spiel, das heute noch von den Jungen auf den glatten Trottoiren geübt wird. Laufspiele waren »Ballschlagen«, »Freigeck raus«, »Zischen« und vor allem »Räuber und Gendarmen«. Auch Klapperhölzer, an den Spitzen angebrannte, [89] dünne Brettchen, die man zwischen die Mittelfinger der rechten Hand nahm und durch Hin- und Herschleudern der Hand ein klapperndes Zusammenschlagen hervorrief, ferner Stelzen u.A. waren Spielgeräte, die man heute hier kaum noch kennt.
Der alte Totenhof mit seinen Denkmälern, Grüften und vielen Verstecken war das Gebiet, auf dem wir ungestört Allotria treiben konnten; es gab dort keinen Baum, der nicht erklettert, kein Denkstein, der nicht bestiegen wäre, selbst vor Grüften schreckten wir nicht zurück, wenn es galt, Blindschleichen oder Eidechsen zu fangen, oder gruselige Spiele zu treiben.
Auf der großen Freitreppe des Realschulgebäudes spielten wie »Burgerobern«, wobei zwei Parteien gegeneinander stritten, von denen eine die andere von der oberen Plattform die Treppe herunter zu ringen suchte. In den stockfinsteren Gängen des Schulgebäudes während der Ferien spielten wir »Gespenster«. Hierbei wurden andere Kinder in die Gänge gelockt, in denen sich vorher einer von uns in den Türnischen versteckte, der sich mit Phosphor von Zündhölzern die Hände und das Gesicht eingerieben hatte, die dann in der Dunkelheit unheimlich leuchteten und durch Hin- und Herbewegen erschreckten.
Daß es bei diesen Spielen oft Beulen oder blutige Köpfe oder Löcher in die Hose und andere Kleidungsstücke gab, war nicht zu verwundern; ich habe mir manche »Sieben« ins Zeug gerissen. Unser Vater durfte aber nichts gewahr werden, sonst setzte es noch Prügel obendrein.
Einen sehr schönen Spielplatz hatten wir auch im Herbst, nachdem unsere mächtigen Obstbäume abgeerntet waren, in unserem Garten, der hinter dem Hause lag. Wenn das Laub von den Bäumen gefallen war, wurde dies auf einen großen Haufen zusammengerecht und über mit alten Tüchern usw. behangene Stangen aufgehäuft, so daß eine Höhle gebildet wurde. In diesen Schlupfwinkeln kauerten wir Kinder zusammengedrängt [90] und spielten Indianer in ihrem Wigwam. Dabei wurde dann auch die Friedenspfeife angezündet und herumgereicht, die aber oftmals sehr schlecht bekam. In Ermangelung echten Tabaks behalfen wir uns mit Tabak (?) aus der Affenallee oder der Cölnischen Allee; wer am meisten Züge tun konnte, ohne elend zu werden, war natürlich ein Held; ich selbst habe es aber nie zu einem solchen gebracht, denn bei meinen ersten Rauchversuchen, die ich an einer »Zigarre«, aus spanischem Rohr bestehend, machte, wurde mir so schlecht, daß ich mich zu weiteren Versuchen mit diesen Surrogaten nicht herbeiließ.
Selbstverständlich konnten wir derartige unerlaubte Jungenstreiche nur in Abwesenheit unseres Vaters wagen, der uns nicht dabei erwischen durfte. Wehe, wenn dies mal der Fall war, dann wurde uns die Lust zu solchen Missetaten gründlich ausgetrieben; wir mußten dann zur Strafe tagelang nach der Schule im Zimmer bleiben und jedesmal, wenn wir nach Hause kamen, die Stiefeln ausziehen, um das Hinauslaufen unmöglich zu machen.
[4.18 Schule]
Die häuslichen Arbeiten für die Realschule gingen natürlich allem voraus; diese mußten erst erledigt sein, ehe wir zu unseren Gespielen durften. Wir mußten uns stets selber helfen, nur selten half uns der Vater, Nachhilfestunden bekamen wir auch nicht. – Mir fiel das Lernen nicht schwer, meine Fähigkeitsnummern in den Zeugnissen waren meist gute, zuweilen recht gute, aber in Aufmerksamkeit und Betragen konnten die Nummern schon besser sein – sonderbar, da habe ich nur selten eine gute Nummer, geschweige denn eine Auszeichnung errungen. Ich war darum auch das enfant terrible unter meinen Geschwistern. Meine beiden Brüder Konrad und August hatten fast immer das Glück, die höchste Staffel auf der Schulbank zu erringen, sie waren vielfach Klassenoberste. – Ich aber hatte darin rechtes Pech, es gelang mir nie, eine solche Höhe zu erklimmen oder selbst nur bis auf die erste Bank zu gelangen. Es war nun einmal mein Geschick, [91] daß ich meist auf den untersten Bänken saß, aber ich wußte mich damit abzufinden, denn ich hätte so wie so nur dort sitzen können, weil ich wegen meiner Kurzsichtigkeit der Tafel näher sein mußte. Es kann ja sein, daß mir dadurch der Trieb fehlte, höher hinauf zu streben und es meinen Brüdern gleich zu tun. Ich war aber schon glücklich, wenn ich stets mit der Klasse aufrückte und keinmal sitzen blieb, das hätte mich dann allerdings ganz um das bißchen Vertrauen gebracht, das ich bei meinem Vater oder meinen Brüdern noch glaubte zu besitzen.
Weil mir das Lernen leicht fiel, ließ ich mich oft ablenken durch Dinge, die nicht zum Unterricht gehörten; wenn irgend ein Ulk oder scherzhafter Streich geplant wurde, dann durfte der Henner Schmidtmann nicht dabei fehlen; oft übernahm ich dann selbst die Exekutive – eine Eigentümlichkeit, die mir im späteren Leben treu geblieben ist, aber damals nicht am Platze war, und mir manche Tracht Prügel eintrug. Meinem Vater habe ich leider vielfach recht schwere Stunden dadurch bereitet.
Es würde zu weit führen und meine väterliche Reputation schädigen, wenn ich mich in Einzelheiten verlieren wollte; ich will aber nicht verschweigen, daß ich im Nachsitzen ein ganzes Abonnement hatte, ja lange Karzerstrafen haben mir meine Dummheiten zweimal eingetragen, die ich natürlich heute aufs tiefste bedauere, allerdings damals auch, denn ich wurde mörderlich verhauen, und das mit Recht. Ich hatte bei meinem Vater alles Vertrauen eingebüßt, er glaubte nicht, daß aus mir etwas werden würde, an mir sei Hopfen und Malz verloren. Daß mein Bruder Konrad, der als Erstgeborener die Sorgen des Vaters teilend, sich über mich, seinen ungeratenen Bruder, oft aufregte, mir kein gutes Prognostikon für die Zukunft stellte, berührte mich weniger empfindlich. Bei meiner Mutter aber fand ich gütige Nachsicht, sie ließ es nicht an Ermahnungen fehlen; ihrer Fürsorge hatte ich es meist zu verdanken, daß mir mein Vater verzieh, wenn ich gefehlt hatte – doch genug davon.
[4.19 Neue Geschwister, Beginn der Lehrzeit]
[92] In der Familie entwickelte sich nach der zweiten Verheiratung meines Vaters ein weiterer Kindersegen; im Jahre 1853 wurde ein Brüderchen geboren, das den Namen meines Vaters, Louis, erhielt, aber nach 1 ½ Jahren am Scharlachfieber starb. 1854 wurde meine Schwester Sophie geboren, der nach einem Jahre ein weiteres Mädchen, meine Schwester Minna, folgte. – Bei deren Taufe frug der damalige Pfarrer Jatho, was ich, dessen Konfirmation bevorstand, werden wollte. Mein Vater antwortete, daß ich als Maurer und Steinhauer lernen solle; er hielt diesen Beruf für geeignet, weil er beim Aufzimmern von Lauben usw. Verständnis und Liebhaberei für das Bauwesen bei mir beobachtet habe. Ich war glücklich über die Bestimmung, diesen Beruf zu ergreifen, zu dem ich allerdings große Neigung hatte.
Ich trat darauf Ostern 1855, mit Rücksicht auf meine zukünftige Tätigkeit, in die technische Abteilung der ersten Klasse der Realschule über, die ich dann mit der Konfirmation zu Ostern 1856 absolvierte.
[4.20 Liebe zur Musik]
Die Schilderungen aus meiner Schulzeit will ich nicht abschließen, ohne darüber zu berichten, wodurch meine Liebe zur Musik hervorgerufen wurde und wie ich zur Erlernung des Klavierspielens kam. In der ersten Etage unseres Hauses wohnte der Lehrer der katholischen Schule, an welche eine Hälfte des Erdgeschosses vermietet war, Philipp Schad, der mit meinem Vater sehr befreundet war, wie wir mit seinen Söhnen. Er war zugleich Organist an der katholischen Kirche und gab Klavierunterricht nebenher.
Außerdem wohnte in derselben Etage, in zwei Zimmern, die noch zu unserer Wohnung gehörten, und so lange wie wir Jungen noch zur Schule gingen, möbliert vermietet wurden, ein junger Musiker aus Marburg, mit dessen Eltern meine Mutter bekannt war, mit Namen Fritz Dietz. Er war, ein Schüler Spohrs, in der kurfürstlichen Hofkapelle als erster Geiger angestellt, dabei ein tüchtiger Klavierspieler und musikalisch sehr veranlagt. Dietz verkehrte in unserer Familie wie [93] einer unserer Angehörigen, und wir Jungen waren ihm besonders zugetan. Wenn er auf seinem Zimmer musizierte und ich freie Zeit hatte, war es für mich ein Hochgenuß, ihm zuzuhören. Im engen Verkehr mit hervorragenden Musikern stehend, spielte er mit diesen Trios oder Streichquartette; meine Eltern hatten den Vorzug, daß er auf deren Wunsch Quartettabende mehrfach bei uns abhielt, auf die wir nicht wenig stolz waren.
Es konnte unter diesen Umständen nicht ausbleiben, daß bei meinem Interesse für die Musik der Wunsch sich in mir regte, Klavierspielen zu lernen. Wir hatten einen alten, ausgespielten Klimperkasten, so eine Art Spinett, das mein Vater vom Onkel Sennholz geschenkt bekommen oder billig gekauft hatte. – In früheren Jahren hatte es schon unserer Einquartierung zu musikalischen Übungen gedient. – Auf diesem Instrument machte ich meine ersten Versuche mit einem Finger. Mein Wunsch, Klavierspielen zu lernen, sollte sich bald erfüllen; mein Vater fand Gelegenheit, ein noch gutes tafelförmiges Klavier sehr preiswert zu erwerben vom Instrumentenmacher Schmidt, gegen den alten Klapperkasten und 40 Taler bar. – Darauf ließ er mich und meinen Bruder Konrad durch seinen Freund, den Lehrer Schad, gegen geringes Entgelt in den Anfangsgründen unterrichten, die wir beide in gemeinsamer Stunde genossen.
Der Umstand, daß ich leichter lernte, wie mein Bruder, erschwerte den gemeinschaftlichen Unterricht, so daß mein Bruder infolge dessen die Lust am Klavierspielen verlor; er ließ es deshalb ganz liegen. Bei dem alleinigen Unterricht von nun ab machte ich rasche Fortschritte und spielte bald Ouverturen und Mozartsche Sonaten, Opernmelodien u.m.
Leider war mein Unterricht nur ein gelegentlicher, mehr ein Freundschaftsdienst meinem Vater gegenüber, der dann auch ganz eingestellt wurde, als ich zur Konfirmation kam. – Nach Ansicht meines Lehrers konnte ich mir nur allein weiterhelfen, und so kam es auch; mir fehlte allerdings jede gründliche [94] musikalische Vorbildung, systematischen Unterricht konnte mir Schad nicht erteilen, mehr wie das erste Heft der Czernischen Fingerübungen wurde nicht durchgenommen.
Schad, ein sehr stark beleibter, gemütlicher Herr, bekam fast regelmäßig eine Kruke Füllbier, die er während der Stunde unter starkem Rülpsen austrank. Das obergährige Bier war nämlich allgemeines Hausgetränk und sehr kohlensäurehaltig. Wenn mein Vater dabei im Zimmer war, unterhielt er sich mehr mit diesem und ließ mich allein gewähren. Mir fehlten infolge des kurzen, an Gründlichkeit mangelnden Unterrichts leider alle theoretischen Kenntnisse in der Musik, und mit dem Fingersatz stehe ich heute immer noch auf dem Kriegsfuß; ich muß mich deshalb besonders auf mein Gehör und mein Gedächtnis verlassen, das hat mir allein fortgeholfen. Aber dankbar bin ich meinem Vater, daß er, so weit es seine Verhältnisse zuließen, die Erlernung des Klavierspielens veranlaßte, denn diesem verdanke ich manche frohe Stunde für mich und andere. Meinem Vater konnte ich neben den schweren Sorgen, die ich ihm oftmals bereitet hatte, auch wieder manche Freude machen, wenn ich ihm etwas vorspielte.
[95] 5. Meine Lehrjahre.
[5.1 Konfirmation]
Zu Ostern 1856 wurde ich in der lutherischen Kirche konfirmiert; die kirchliche Handlung vollzogen die beiden Pfarrer Habicht und Jatho. Die Zahl der Konfirmanden war derzeit eine erheblich geringere wie heute; die Konfirmation der männlichen und weiblichen Jugend war deshalb auch keine getrennte, sondern gemeinschaftlich. Der Konfirmandenunterricht war allerdings getrennt, aber er folgte bei den jungen Mädchen unmittelbar auf den unsrigen. Die Konfirmanden lernten sich dadurch untereinander besser kennen, und manche Bekanntschaft für das Leben wurde damals schon angeknüpft, denn die meisten hatten ihre Flamme, die sie besonders auszeichneten.
Die besser situierten Eltern unserer Mitkonfirmandinnen veranstalteten auch Konfirmandenkränzchen, für welche Einladungen an bevorzugte Konfirmanden ergingen, zu denen zu zählen auch ich das besondere Glück hatte. Das letzte dieser Kränzchen fand am 3. Ostertag statt, in der Familie des Kaufmanns Emil Herzog, dessen Tochter Ottilie, jetzt Frau Bankier André, eine Mitkonfirmandin von mir war. Das war auch der Schluß meiner goldenen Jugendjahre, eine weitere Zeit zum Verbummeln hielt mein Vater für mich Luftikus nicht zulässig.
[5.2 Beginn der Lehrzeit]
Am andern Tag, punkt 6 Uhr, trat ich meine Lehrzeit an. Angetan mit einer blaugrauen gestrickten wollenen Jacke und einer langen blauen leinenen Schürze, dem »Jammerlappen«, wie er zünftig genannt wurde, begab ich mich auf den Werkplatz des Maurer- und Steinhauermeisters Georg Löser an der Holländischen Straße, meines nunmehrigen Lehrmeisters.
[96] Die übliche Lehrzeit, der auch ich mich unterwerfen mußte, war 4 Jahre, d.h. eigentlich 4 Sommerhalbjahre, je vom 1. April bis 1. Oktober, an denen ich praktisch arbeitete. Im Winterhalbjahr besuchte ich die Bauhandwerkschule und die Kurfürstliche Akademie. Dies war in der Regel der Bildungsgang, den die Söhne besserer bürgerlicher Familien durchzumachen hatten, wenn sie in der ehrbaren Maurer- und Steinhauerzunft als Lehrlinge aufgenommen und eingeschrieben waren.
Tatsächlich aber lernte man zumeist nur als Steinhauer, denn zu einer praktischen Ausbildung als Maurer fehlte jede Gelegenheit. Bürgerliche Wohngebäude wurden nur sehr vereinzelt gebaut; mein Lehrmeister hatte während meiner Lehrzeit gar keins auszuführen. Das Empfangsgebäude des Bahnhofs war der einzige Massivbau, an dessen Ausführung Meister Löser, ebenso wie alle Casseler Meister, mitbeteiligt war. Die ständigen Maurerarbeiten, die im Geschäft vorkamen, beschränkten sich auf gemauerte Sparherde, Waschkessel – eiserne Herde und Waschkessel kannte man noch nicht – Schornsteine, Gefachausmauerung oder kleinere Reparaturen.
Mit diesen minderwertigen Arbeiten wurden wir Stadtlehrlinge nicht behelligt, dazu wurden die Dorfjungen herangebildet. Wir fühlten uns als Steinhauerlehrlinge deshalb auch hoch erhaben über die Dorflehrlinge und standen bei diesen in besonderem Respekt.
Auf dem Werkplatz bezw. Steinhauerplatz meines Lehrmeisters waren, als ich meine Lehre antrat, einige Gesellen tätig und 2 Lehrlinge, deren einer aus der Stadt, Sohn des Riemermeisters Eißenbach war. Ich wurde diesem als neugebackener Lehrling von meinem Lehrmeister vorgestellt und mit einigen Worten ermahnt, stets pünktlich, fleißig und ordnungsliebend meinen Vorgängern nachzustreben. Als ein Vertrauensposten wurde mir die Aufsicht über die Geschirrkammer übertragen, die der jüngste Lehrling immer unter Verschluß zu halten hatte; mein Meister ließ sich von Eißenbach [97] den Schlüssel geben und überreichte ihn mir mit feierlichem Ernst, mich mahnend, daß ich alles, was aus der Geschirrkammer herauszugeben war, gewissenhaft anschreiben und auf prompte Ablieferung bedacht sein müsse. Ich war mir der verantwortungsvollen Schwere wohl bewußt und gelobte mit Handschlag treue Pflichterfüllung. Den Schlüssel zur Geschirrkammer mußte ich jeden Abend im Wohnhause meines Meisters an einen bestimmten Platz hängen und ihn dort morgens um 6 Uhr wieder abnehmen. Wohnhaus und Garten stießen unmittelbar an unseren Werkplatz.
Meine Ausbildung in der Steinhauerkunst aber lag lediglich in der Hand meines schon geübten Lehrkollegen oder der Gesellen, diese kamen meinem Arbeitsdrange entgegen und halfen mir eine Steinplatte aufbänken (d.h. arbeitsgerecht auf 2 Böcke legen), unterrichteten mich über die verschiedenen Arten, sowie Handhabung der Steinhauergeschirre und ließen mich nun drauflos murksen. Was ich lernen wollte, mußte ich zum größten Teil von andern absehen; zur Übung wurden mir Sandsteinbrocken oder Platten überlassen, die ich nach Herzenslust verhaute, bis ich die Führung von Knüppel (der runde halbkugelige Schlägel) und Eisen einigermaßen verstand. Die ungewohnte Arbeit strengte meine Arme sehr an, ich mußte oft absetzen, um zu ruhen, aber allmählich stärkten sich meine Armmuskeln, und es ging immer besser.
[5.3 Versehentliche Spargelmißhandlung]
Der rechte Ernst zum Lernen aber wollte sich noch nicht einstellen; ich hatte immer noch sehr viel Sinn für andere Dinge und fand mancherlei Ablenkung, die mich dann von der Arbeit abhielt. Ich suchte mich bald mit den Söhnen meines Lehrmeisters, von denen einige mit mir annähernd gleichen Alters waren, und mit dessen einziger Tochter, einer netten, liebenswürdigen jungen Dame von 16 Jahren, anzufreunden. Durch mein Klavierspiel, das ich gelegentlich abends nach Feierabend, wenn die Eltern nicht zu Hause waren, zum besten gab, hatte ich bald einen Stein im Brett bei den Kindern; [98] ich war der erste musikalische Lehrling im Geschäft, dieser Vorzug verschaffte mir die Zuneigung derselben und führte zu einem freundschaftlichen Verkehr zwischen mir und ihnen.
Fräulein M... aber hatte auf mein leicht empfängliches Gemüt einen besonderen Eindruck gemacht; ich suchte, wo sich mir Gelegenheit dazu bot, höfliche Aufmerksamkeiten zu erweisen und den angenehmen Schwerenöter zu spielen. Wenn aber mein Lehrmeister mich dabei überraschte, daß ich, statt zu arbeiten, in dem an den Werkplatz anstoßenden Garten mit seinen Kindern spielte oder mich neckte, wies er mich aus dem Garten und mahnte mich an die Arbeit, die Zeit zum Spielen sei vorbei. – Diese Mahnung wirkte wohl einige Tage, in denen ich sie ernst nahm, aber der Jugendübermut brach doch immer wieder durch, ich ließ mich noch oft von der Arbeit ablenken bis zu einem Vorfall, der beinahe zu einer Katastrophe für mich führte, mit dem aber ein Wendepunkt für mein Leben eintrat – ein »Spargelstich« wäre beinahe verhängnisvoll für mich geworden, wie und wodurch, will ich hier erzählen.
Spargel war damals ein selteneres Genußmittel wie heutzutage; als Handelsartikel in größeren Mengen wurde er nicht geführt, es gab noch keine großen Spargelplantagen. Nur in Gärtnereien und ausnahmsweise in Privatgärten zog man Spargel in schmalen Beeten. Auch im Garten meines Lehrmeisters befanden sich einige solcher Spargelbeete – für mich etwas noch ganz neues, denn ich hatte vorher noch keine Gelegenheit gehabt, Spargeln wachsen zu sehen.
Den Genuß des heute so beliebten Pflanzenstengels lernten wir zu Hause nur an Sonn- und Feiertagen in der Suppe kennen und würdigen – Stangenspargel waren, wenigstens bei uns, noch nicht in der Mode.
Beim Herannahen der Spargelzeit wurden die Spargel im Garten meines Lehrmeisters sehnsüchtig erwartet; jeden Morgen wurde nachgesehen, ob noch kein Köpfchen sich aus dem Schoß der Erde hervorwagte. Die erste Ernte war, wie alljährlich, auch diesmal dazu bestimmt, einem befreundeten [99] Baumeister eine Aufmerksamkeit damit zu erweisen. Mich interessierte es auch sehr, das Herauswachsen der Spargel aus der Erde zu beobachten, und ich tat dies dann ganz besonders gern, wenn mein Meistertöchterlein in den Beeten nach den zu erwartenden Spargeln suchte.
Endlich, nach einem warmen Regen, zeigten sich die ersten rot angehauchten Köpfchen zugleich in größerer Zahl, so daß sie gestochen werden mußten, damit sie nicht erst blau wurden. Fräulein M..., die mit diesem Geschäft schon vertraut war, holte auch alsbald Messer und Körbchen aus der Küche, und ich stellte mich diensteifrig hilfeleistend zur Verfügung. Ehe sie aber zum Ausstechen der Spargel kam, wurde sie noch mal angerufen, um sich eine Schürze zu holen zum Schonen der Kleider. Sie gab mir Körbchen und Messer zum Aufbewahren, ich wartete aber ihre Rückkunft nicht ab und glaubte mir die Sporen damit zu verdienen, wenn ich ihr einen Teil der Arbeit abnahm, und fing flugs an, die Spargel abzustechen in einer Länge, wie ich sie in der Suppe zu essen bekam.
Während ich noch am Boden kauernd einen Kopf nach dem andern abstach und mich freute, das Körbchen immer mehr zu füllen – da – auf einmal hörte ich über mir laut aufschreiend die zornerregte Stimme meines Lehrmeisters, der, durch den Garten gehend, mich bei meiner unerlaubten Arbeit ertappte. Mit einem Griff packte er mich an meiner wollenen Jacke und riß mich in die Höhe, mit zorngerötetem Gesicht mich andonnernd, was mir Lausejungen einfiele. Er zauste mich hin und her, warf mich aus den Beeten heraus und drohte mir mit seinem starken Rohrstock, mit dessen Elfenbeinkugelgriff er mir immer vor den Augen herumfuchtelte, so daß ich jeden Augenblick einen Schlag erwartend, mich immer ängstlich duckte.
Ich muß bei meinem furchtbaren Schrecken ein Bild des Jammers abgegeben haben, denn zum Schlagen kam mein sonst so gutherziger Meister nicht, er machte seinem Zorn und [100] Ärger nur Luft in Worten, die er keuchend vor innerer Erregung herauspolterte. Sein Töchterlein und ihre Mutter kamen zitternd herbeigelaufen und sahen, was ich für ein Unheil angerichtet hatte, da war es um mich geschehen. Auch meine Meisterin stimmte mit ein, sie meinte, ich sei ein unnützer Bengel, der nichts als dumme Streiche im Kopfe habe, es sei mit mir doch nichts anzufangen, mein Meister solle mich fortschicken und aus der Lehre jagen.
Als ich dies hörte, bat ich händeringend unter Tränen, mir meine Unbesonnenheit, bei der ich mir nichts Böses gedacht hätte, zu verzeihen und mich nicht aus der Lehre zu jagen, ich dürfte sonst meinem Vater nicht wieder unter die Augen kommen. Ich versprach, von nun an stets meine Pflicht zu tun und mich niemals wieder von meiner Arbeit ablenken zu lassen. Mit Rücksicht auf meinen Vater, und um diesem den großen Ärger und die Sorge um mich zu ersparen, erklärte denn auch mein Lehrherr, mich noch nicht fortzujagen, aber Vertrauen zu mir könne er nicht mehr haben. – Ich mußte sofort den Schlüssel zur Geschirrkammer wieder abliefern, mit einem Wort, ich wurde wie ein Soldat nach einem Kapitalverbrechen völlig degradiert! Den Kindern, besonders der Tochter des Hauses, wurde es streng verboten, sich mit mir ferner einzulassen – so kehrte ich wie ein Geächteter, mit dem Gefühl meiner Nichtswürdigkeit beladen, auf den Werkplatz zurück an meine Arbeit und fing an, unter Tränen meinen Stein zu bearbeiten, ohne mich umzusehen.
[5.4 Tätige Reue]
In den Augen der Gesellen und Lehrlinge war der Vorzug, den ich als Stadtlehrling zu haben glaubte, mit diesem Vorfall geschwunden; ich mußte mir manches bieten lassen und allerhand liebenswürdige Redensarten anhören, die ich zähneknirschend hinnehmen mußte. Ich fand nur Teilnahme bei meinem Lehrkollegen aus der Stadt, mit dem ich mich angefreundet hatte, an dem ich, wenn es zu toll wurde, eine Unterstützung fand. Ferdinand E.... war schon zwei Jahre in der Lehre; fleißig und strebsam, hatte er als Steinhauer [101] schon eine gewisse Geschicklichkeit erlangt und sich dadurch die besondere Zufriedenheit unseres Meisters erworben. Er machte mir Mut, ich möge mich tüchtig zusammennehmen und fleißig an der Arbeit bleiben, dann würde ich bald meinen Meister wieder aussöhnen.
Ich faßte dann auch den Entschluß, nach besten Kräften alles zu tun, um den Vorfall vergessen zu machen und mir Vertrauen zu erringen. Jeden Morgen um ¾6 Uhr stand ich schon bei der Arbeit, die ich nur in den Frühstücks- und Mittagspausen verließ; unter der Anleitung meines Freundes Ferdinand hatte ich denn auch nach sechs Wochen gute Fortschritte in den Anfängen der Steinhauerkunst gemacht. Während dieser Zeit hatte mein Meister kein Wort mit mir gewechselt, auch nur kurz meinen Gruß erwidert. Eines späteren Tages rief mein Meister aus seinem Geschäftszimmer herunter auf den Werkplatz, ich solle sofort zu ihm heraufkommen. Hochklopfenden Herzens ging ich mit eilenden Schritten hinauf zum Hause und stand vor meinem gestrengen Herrn und Meister. Als ich in sein Zimmer trat, kam er mir mit der ausgestreckten Hand entgegen, die meine verlangend. Mit ernsten Worten kam er auf den Vorfall zurück, durch den ich ihm großen Ärger bereitet und seine ganze Strenge herausgefordert hätte. Er sähe aber jetzt mit Befriedigung, damit erreicht zu haben, daß ich mich geändert hätte und mich bemühe, meine Pflicht zu tun. Er hoffe, daß ich ferner von unüberlegten Jugendstreichen ablasse, und schenke mir wieder sein Vertrauen, erwarte aber auch von mir, daß ich von nun an ihm nur Freude machen würde. Ich versprach ihm in die Hand, stets meine Schuldigkeit zu tun, und dankte für seine Güte und Nachsicht. Darauf überreichte er mir den Schlüssel zur Geschirrkammer, die von nun an wieder meiner Aufsicht unterstellt war; ich konnte nun wieder frei aufatmen.
Mein Vater hatte glücklicherweise von diesem Vorfall gar nichts erfahren; aber meiner Mutter hatte ich mein Herz ausgeschüttet, die, erschrocken über die mir drohende Gefahr, aus [102] der Lehre gejagt zu werden, mich jeden Tag von neuem ermahnte, endlich vernünftig zu werden und nur an meine Pflicht zu denken. Sie sorgte dafür, daß ich stets frühzeitig aus dem Hause kam, um immer vor dem Beginn der Arbeitszeit auf dem Platze zu sein.
Der feste Vorsatz, mich von jetzt ab des mir wieder geschenkten Vertrauens wert zu machen, verhalf mir dazu, immer freudiger an die Arbeit zu gehen. Die Lust und Liebe zu meinem Beruf wurde gehoben, ich lernte schaffen und vorwärts streben. So wurde der unglückselige Spargelstich mit seinen für mich beinahe verhängnisvollen Folgen zu einem Glücksumstand, denn ihm verdankte ich eine Wandlung in meinem Wesen; damit schlossen meine Flegeljahre ab – wer weiß, wie lange sie noch angehalten hätten, ohne diesen Spargelstich?
[5.5 Die erste Probearbeit]
Mit dem Erlernen der Steinhauerei machte ich jetzt bessere Fortschritte, nach einigen Monaten konnte ich schon eine Probearbeit liefern, die ein jeder Stadtlehrling nach altem Geschäftsbrauch im ersten Lehrjahr zu machen hatte. Es war eine sauber bearbeitete Sandsteinplatte, in die das große und kleine lateinische Alphabet in Keilschrift eingehauen war.
Ich durfte das Machwerk mit Genehmigung meines Meisters, der seine Zufriedenheit darüber aussprach, mit nach Hause nehmen. Ich schleppte die schwere Platte, eingewickelt in meine blaue Schürze, auf der Schulter abends mit in unsere Wohnung, um sie meinem Vater zu zeigen, der gerade im Sofa bei seiner Lektüre saß. Ich stellte meine Last vor ihm auf den Tisch, er besah meine Arbeit, ohne ein Wort dabei zu reden, und sagte dann, ich solle sie auf den Hof stellen. Ein Wort des Lobes oder der Anerkennung wurde mir nicht zuteil, mein Vater vermied dies grundsätzlich; wir waren aber schon glücklich, wenn er nichts auszusetzen hatte, sein Stillschweigen nahmen wir als Anerkennung hin – der Mutter gegenüber sprach sich der Vater mitunter aus, wenn er mit uns zufrieden war; durch diese erfuhr ich denn auch, daß ihm meine Arbeit Freude gemacht hätte.
[5.6 Lehr-Alltag]
[103] Im Geschäft genoß ich als Stadtlehrling den Dorflehrlingen gegenüber, die Wochenlohn erhielten, nur den Vorzug, daß ich an bessere Arbeiten herankam. Im übrigen aber mußte ich, wie jeder Dorfjunge, alles tun, was verlangt wurde, ausgenommen etwaige Hausarbeiten. – Wenn kein jüngerer Dorfjunge auf dem Platze war, hatte ich zum Frühstück oder Vesper das »Zugebröde« aus der Stadt zu holen, Wurst, Gehacktes, Heringe oder Käse usw., an Getränken besonders Schnaps, seltener Bier. Oft schwer beladen, rannte ich vor dem Frühstück vom Metzger zum Kaufmann, oder in die Wirtschaften, um nur rechtzeitig wieder auf dem Platze zu sein, und wehe mir, wenn meine Einkäufe nicht nach Wunsch ausgefallen waren – die Blumenlese von Titulaturen wiederzugeben will ich lieber unterlassen. Zum Glück wurden diese Dienstleistungen nur im ersten Sommer von mir verlangt, später wehrte ich mich energisch dagegen; ich ließ mir auch keine Komplimente mehr machen, ohne sie mindestens zurückzugeben.
Die Sandsteinarbeiten, die ich im ersten Lehrjahre auszuführen hatte, waren naturgemäß einfacher Art, wie Schornsteingevierte mit »Stoppen« (an deren Stelle jetzt eiserne Schieber verwendet werden), Schornsteindeckplatten, Gossensteine, Treppenstufen, Ofensteine usw., von diesen mußte immer ein gewisser Vorrat auf dem Platze lagern. – Feinere Steinhauerarbeiten, Gesimse, Grabsteine u.a., bekam ich noch nicht unter die Hände, dazu war meine Ausbildung noch nicht ausreichend.
Am 1. Oktober stellte ich meine praktischen Arbeiten ein und verabschiedete mich für die Wintermonate von meinem Lehrmeister, der mir kurz seine Anerkennung über meine Leistungen zollte und mich zu weiterem Streben anspornte.
Die regelmäßige, oft recht anstrengende Arbeit war für meine körperliche Entwickelung sehr vorteilhaft. – Durch die stete Arbeit in freier Luft, von der Sonne tief gebräunt, wuchs ich heran; meine Hände waren hart und voller Schwielen; das [104] Klavierspiel mußte ich selbstverständlich vernachlässigen, denn abends war ich oft todmüde von der Arbeit; ich kam meist nur Sonntags dazu, meinem Vater etwas vorzuspielen.
[5.7 Winterunterricht in Bauhandwerkschule und Akademie]
Im Wechsel aber liegt der Reiz; dies empfand auch ich neugebackener Lehrling, als ich das erste Sommerhalbjahr hinter mir hatte und der Winterunterricht begann. Welche Wohltat war es für mich, daß ich nun nicht mehr jeden Wochentag schon früh um 5 Uhr aus dem Bett mußte; ich konnte wieder regelmäßig ausschlafen, körperliche Anstrengungen gab es auch nicht mehr.
Mit dem 1. Oktober fing der Winterkursus sowohl in der Bauhandwerkschule wie in der kurfürstlichen Akademie der bildenden Künste an. Als Lehrling im Baufach mußte ich diese Bildungsanstalten besuchen, um mir die erforderlichen wissenschaftlichen und technischen Kenntnisse zu erwerben, die zur Erreichung meines Zieles als dereinstiger zünftiger Maurer- und Steinhauermeister erforderlich waren. Der Unterricht in beiden Lehranstalten entsprach aber auch ganz meinen Neigungen; jetzt erst wurde bei mir der Ehrgeiz rege, dessen ich mich früher in meiner Schulzeit nicht rühmen konnte. Es bedurfte keiner Mahnung mehr, meinen Eifer zum Lernen anzuspornen; ich arbeitete mit Lust und Liebe, und versuchte in allen Fächern möglichst voranzukommen. Ob mir später nach meiner Lehrzeit die Gelegenheit geboten worden wäre, mich noch weiter wissenschaftlich oder technisch für das Baufach auszubilden, war sehr fraglich, denn mein Vater war nicht in der Lage, bei seiner großen Familie mir die Mittel zu gewähren, um eine technische Hochschule besuchen zu können.
Mit meinen Leistungen im Freihand- und Architekturzeichnen, Modellieren nach Ornamenten usw., erwarb ich mir die Zufriedenheit meiner Lehrer, der Professoren Brauer, Wolff und des Bildhauers Müller. Wenn ich auch nicht zu den hervorragenden Talenten gehörte, so suchte ich doch meine Arbeiten möglichst sauber auszuführen und sammelte sie, um für spätere Zeiten einen Ausweis über meine Fähigkeiten in den [105] Händen zu haben. In der Baukonstruktionslehre und dem Steinfugenschnitt hatte ich an dem Baumeister Wilhelm Koch, dem späteren Majorkommandanten der städtischen Feuerwehr, einen vorzüglichen Lehrer, dem ich sehr viel zu verdanken habe. Er nahm sich meiner besonders an; ich durfte in den folgenden Wintern in seinem Hause unter seiner Leitung arbeiten, ohne daß er Entgelt dafür nahm; er war mir ein wohlwollender Lehrer, mit dem ich auch in meinem späteren Leben in stets freundschaftlichem Verhältnis geblieben bin.
[5.8 Tanzstunden]
Was der Winter in Rücksicht auf meine berufliche Ausbildung brachte, habe ich kurz geschildert; in gesellschaftlicher Beziehung aber kam ich auch nicht zu kurz, denn an Vergnügungen und Zerstreuungen fehlte es mir nicht. – Der Himmel hing mir damals noch voller Baßgeigen, – ich kam in die Tanzstunde, und was das für einen jungen Menschen zu bedeuten hat – na, wer jung war, weiß es ja selbst am besten zu würdigen.
Mit der Tanzstunde macht man den ersten Pas in die heranreifende Männlichkeit, das Selbstbewußtsein schwellt die Brust – man hört sich zuerst »Herr« nennen, unwillkürlich fängt man an mit dem Daumen und Zeigefinger unter der Nase nachzuspüren, ob sich noch kein Flaum auf der Oberlippe zeigt und übt sich im Spitzendrehen, selbst wenn noch keine Haare da sind.
Mit diesem Hochgefühl in der Brust trat ich in Gemeinschaft mit meinem Bruder Konrad in die Tanzstunde beim Hoftanzlehrer Labassée, dem Vorgänger Riebelings ein. Der Labasséesche Saal, in dem die Tanzstunden abgehalten wurden, befand sich in dem Hause hinter der Martinskirche, der jetzigen »Herberge zur Heimat«. Die ersten Tanzstunden hatten wir »Herren« noch allein; wir mußten erst lernen, uns auf dem glatten, gewächsten Parkettboden, der mir noch etwas völlig neues war, zu bewegen. Labassée, ein beleibter, aber dabei sehr beweglicher Herr, machte uns die ersten Pas vor, die wir, dabei zählend oder eine französische Tanzformel rhythmisch [106] hersagend, ihm nachmachen mußten. – Welche Bocksprünge dabei gemacht wurden, kann man sich denken. Mancher lernts bekanntlich nie, wieder andere spielend; zu letztern gehörte ich, wahrscheinlich, weil ich durch mein Klavierspiel soviel Tanzmusik im Kopfe hatte. Vor der ersten gemeinschaftlichen Stunde mit den Damen wurden die Kompliments eingeübt; man mußte sich dabei an der einen Saalwand aufstellen und auf das Kommando »Meine Herren, engagieren« auf die gegenüberliegende Wand, vor der man sich die Damen zu denken hatte, loschassieren. Endlich kam die ersehnte Stunde, die mit der holden Jugend reizender Damen gemeinschaftlich stattfand, in der wir gegenseitig vorgestellt wurden. Unter den Damen waren uns einige schon bekannt, zwei Fräulein Hopffs, – Milchschwestern meines Bruders Konrad (sie hatten mit diesem zusammen eine Amme), Fräulein Riemanns u.a. – Ich erkor mir »d’s Lenchen Hopff« zu meiner Tanzstundenflamme, stürmte beim ersten Kommando »zum Engagieren« auf sie zu, machte möglichst ungeschickt mein Kompliment, das sie errötend erwiderte und stolperte mit ihr durch den Saal. Allein glaubte ich schon tanzen zu können, aber zu zweien, zumal mit der Schüchternheit der ersten Umarmung klappte es noch nicht so recht – doch es ging immer besser!
Den Höhepunkt unserer Tanzstundenfreuden bildeten, wie auch heute noch die Tanzstundenkränzchen, in denen unsern eingeladenen Angehörigen die Fortschritte vor die Augen geführt wurden, die Labassée in der Kunst Terpsichores uns beigebracht hatte. Diese Kränzchen besuchten wechselseitig Herren aus anderen Ständen als Hospitanten, mit denen wir bekannt wurden. Ein reger geselliger Verkehr führte uns immer näher zusammen; es bildeten sich Freundeskreise, die freundschaftliche Beziehungen auf Jahre hinaus, ja für das Leben unterhielten.
[5.9 Freundschaftsbund, Eisvergnügungen]
Einem solchen Freundeskreis aus der Tanzstundenzeit hatten wir zwei Brüder uns angeschlossen, mit dem wir treu zusammenhielten bis zu der Zeit, wo wir das Elternhaus verließen, um in die Fremde zu ziehen. – Unser Freundschaftsbund [107] hatte sich den schlichten Namen »Krug« beigelegt, der auf einen großen irdenen Krug zurückzuführen war, welcher bei unsern geselligen Abenden, die auf den Buden verschiedener Mitglieder abgehalten wurden, stets mit Bier gefüllt auf dem Tische stehen mußte. Später wurde bei der »Tante Zucker« in der Mittelgasse, damals eins der bessern Restaurationslokale, das Hauptquartier aufgeschlagen. – Jedes Mitglied hatte einen Beinamen, mit dem man sich in spätern Jahren immer noch anredete, wenn man sich mal wieder traf; u.a. hieß mein Bruder Konrad »Lore«, ich wurde »Salto« genannt, meine Vettern Louis Hochapfel »Jule« und Heinrich Scheurmann »Sekretar«, Karl Zucker, mein späterer Schwager, »Vetter«.
Die Beziehungen zu unsern Tanzstundendamen suchten wir durch gesellschaftliche Veranstaltungen aufrecht zu erhalten. – Im Winter fuhren wir auf der Eisbahn des Bassins in der Aue, die nur von männlichen Schlittschuhläufern frequentiert wurde, unsere Damen im Stuhlschlitten herum. Dem Eissport des Schlittschuhlaufens huldigte ehemals die Damenwelt noch nicht; es galt für höchst unschicklich, wenn eine Dame es wagen wollte, selbst Schlittschuhe zu laufen. Der Schlittschuh damaliger Zeit war für zarte Damenfüßchen durchaus ungeeignet. Die eiserne Laufschiene steckte in einem, der Stiefelsohle angepaßten Holzteil, an dessen Seiten längere Riemen und hinten eine Lederkappe für den Haken angebracht waren; mit dem Riemen wurde der Schlittschuh um den Fuß festgeschnallt, derart, daß man jeden Winter wunde Knöchel davontrug. Ein solcher lederumgürteter Fuß konnte keinen Anspruch auf Eleganz machen. Erst wie die zierlichen eisernen Schraubenschlittschuhe eingeführt waren und die fußfreien glatten Röcke anstelle der durch die Krinoline weit aufgebauschten langen Damenkleider modern wurden, wagte sich die schöne Welt an diesen Sport heran, die heute sogar das überwiegende Element auf der Eisbahn bildet. Damals standen die jungen Damen um die Eisbahn des Bassins herum und ließen sich von den Herren zur Schlittenfahrt einladen; wie in der Tanzstunde [108] beim »Herrenhospiz« holten sich die Herren ihre Damen nach Auswahl, oder wenn man ernstere Absichten hatte, quälte man sich stundenlang im Schweiße seines Antlitzes mit seiner Auserkorenen allein ab.
Ich hatte einst bei solchem Eisvergnügen das Pech, daß der Schlitten mit meiner Dame durch das Eis einbrach, in dem Augenblick, wie diese, eine voll entwickelte, gewichtige Schönheit, mit einem graziösen Pas in meinen Schlitten sprang. Zum Glück war das Wasser nur etwas mehr wie knietief, so daß wir uns sofort mit Hilfe anderer ans Ufer retten konnten, um dann im Trabe nach einem warmen Zimmer in die Aue-Restauration zu flüchten. – Den Schreck und die Verlegenheit kann man sich aber denken; ich war froh, daß der Unfall ohne weitere nachteilige Folgen ablief.
Im Sommer arrangierten wir Partien nach Freienhagen, der Knallhütte oder dem Messinghof hinter Bettenhausen usw., an die sich manche schöne Erinnerung für mich knüpft.
[5.10 Familiengeselligkeiten]
[5.11 Taschengeld, Geschenke]
Als Taschengeld bekamen wir in den ersten Jahren nach der Konfirmation wöchentlich 5 Silbergroschen, mit denen wir haushalten mußten. Bei besonderen Vergnügungen mußten wir um Zuschuß bitten, der aber dann auch möglichst knapp bemessen war. Von meinem Taschengelde kaufte ich mir zuweilen ein Theaterbillett auf die Galerie im Hoftheater; mit diesen bescheidenen Mitteln mußte ich haushalten bis zum 17. Jahre; von da ab wurde mir von meinem Vater auch das Rauchen erlaubt, in dem ich mich – ohne Erlaubnis – schon vorher geübt hatte.
Ebenso knapp wie mit dem Taschengeld, wurden wir auch in bezug auf Geschenke zu Weihnachten oder zum Geburtstag gehalten; diese beschränkten sich ausschließlich nur auf notwendige Sachen, Kleidungsstücke, Wäsche, Schals, Schlipse, Handschuhe, Schlittschuhe usw. oder Zeichenutensilien. Zur Ausschmückung des Christbaumes am Weihnachtsfest wurden Äpfel sowie mit Goldschaum von uns selbst überzogene Walnüsse verwendet, dazu etwa ½ Pfund Zuckerschaumgebäck vom Konditor. Wie oft kam es vor, daß meine Mutter, der die Sorge für das Fest allein oblag, am Tage vor heiligen Abend noch nicht das geringste an Geschenken für uns kaufen konnte, wenn unser Vater vergeblich auf Zahlungen aus der Hofkasse, von der Post oder von seinen anderen Kunden warten mußte, denn auf Rechnung durfte meine Mutter nie etwas kaufen. – Welch drückendes Gefühl dann auf meinem Vater lastete, wenn er der Mutter kein Geld geben konnte, ließ sich von seinem ernsten, sorgenschweren Antlitz absehen. Er saß dann abends wenn er aus der Werkstatt kam, schweigend und grübelnd in der Dämmerung im Lehnstuhl, die Lampe wurde nie erst angezündet, ehe es völlig dunkel war. Mein Bruder Konrad, der [110] im väterlichen Geschäft lernte, mußte von einer Kasse zur andern laufen, oder die Kundschaft abklopfen und versuchen, Zahlung zu erlangen; je nachdem diese ausfiel, fielen auch unsere Geschenke aus. Wir waren aber trotz alledem glücklich und zufrieden unter dem strahlenden Weihnachtsbaume und freuten uns über die noch so bescheidenen Geschenke. Der Sylvesterabend wurde auch öfters im größeren Familienkreise gefeiert, wobei es Glühwein und »Hornaffen« gab. Am Neujahrstage ging man in der Verwandtschaft usw. herum zum Gratulieren; beim Großvater, der jedem von uns Kindern einen Taler in die Sparkasse stiftete, wurde der Anfang gemacht, dann folgte mein Lehrmeister u.s.f. Das Gratulieren durch Karte kannte man noch nicht, es gab weder Postkarten noch Kuverts, Briefe wurden zusammengelegt und zugesiegelt oder mit Oblaten zugeklebt. So verliefen die Wintermonate im allgemeinen während meiner Lehrzeit.
[5.12 Hausschlachtung]
Zur Vervollständigung meiner Erlebnisse im Winter darf ich ein besonders für die Jugend wichtiges Ereignis nicht unerwähnt lassen, das sich alljährlich zu Anfang des Winters wiederholte, nämlich das »Schlachtefest«. Die Sitte des Hausschlachtens eines oder mehrerer Schweine für den Hausbedarf ist längst aus der Mode gekommen. Damals war es fast allgemein Gebrauch, daß die besser situierten Hauseigentümer »schlachteten«. Vielfach wurden die Schweine selbst gemästet oder »fett gemacht«, wie man sich ausdrückte, zumeist aber wurden die Schweine, sogenannte Landschweine, von Bauern oder Dorfbewohnern gekauft. Mein Vater hatte seinen bestimmten Lieferanten, der uns die zwei Schweine, die wir jedes Jahr schlachteten, lieferte; es waren Schweine mit möglichst hohem Rücken, Holsteiner Rasse. – Ungarische Schweine oder die jetzt gezüchteten kurzbeinigen englischen Schweine waren bei uns noch unbekannt, weil der Viehtransport auf der Eisenbahn noch ein sehr beschränkter war. – Die Hausmetzger waren in der Regel Maurer- oder Weißbindergesellen, welche die Schlachterei zu ihrem Winterberuf erlernt hatten; es bot sich [111] keine Gelegenheit zur Bauarbeit im Winter, sie mußten auf diese Weise sich Verdienst schaffen. Unsere »Schlachten-Maler« waren zwei Gebrüder Ritz, die im Sommer ihren Malerberuf als »Wißbänner« ausübten. Am Schlachttag wurden die Schlachtopfer früh morgens vom Bauern uns ins Haus gebracht und mit eintretender Helligkeit auf dem Hofe abgestochen. Die Schlachtgeräte, darunter das »scheibe Faß«, worin das tote Schwein abgebrüht wurde, und die Schlachtebank, die beide geliehen waren, wurden aufgestellt; die geschlachteten Tiere wurden auf dem Hofe »hakenrein« ausgeschlachtet, d.h. völlig sauber abgeborstet, ausgeweidet und dann an den »Krummhölzern« der mitten durchgeschnittene, weit geöffnete Körper mit gespreizten Beinen an der Wand aufgehängt. Darauf wurden sie in der Werkstatt zerlegt, ein Teil kam in den Kessel im Waschhause, der andere auf das Hackebrett, auf dem mit 4–6 Hackemessern das Fleisch zum Wursten von unseren Arbeitern und uns Jungen gehackt wurde. Auch beim Wurstmachen mußten wir Brüder die vom Metzger gestopften Würste binden helfen. Abends gab es dann die erste Wurstesuppe, an der die Metzger und Arbeiter mit teilnahmen. In den nächstfolgenden Wochen kam täglich frisches Schlachtewerk auf den Tisch; außerdem aber wurden Wurstesuppen Verwandten und Freunden gespendet, denn sonst hätte man Gefahr gelaufen, daß das Schlachtewerk, das wir so rasch gar nicht vertilgen konnten, sauer geworden wäre; Abnehmer hierfür fanden sich immer genügend.
[5.13 Der zweite Lehrsommer]
Mit dem 1. April begann ich wieder mit meiner praktischen Tätigkeit, an die ich meine Hände und Arme erst wieder gewöhnen mußte, ehe die Arbeit mit den schweren Werkzeugen, Steinhauerknüppel, Spitze, Fläche und Kröndel wieder flott von statten ging; in der ersten Zeit bekam man eine Art Turnfieber mit argen Muskelschmerzen, die sich erst allmählich wieder verloren.
Im zweiten Sommer wurden mir schon bessere und größere Arbeiten anvertraut, u.a. Sandsteinarchitektur-Arbeiten [112] für das neue Bahnhofsgebäude, die zu meiner Genugtuung jedesmal für gut oder wenigstens für tauglich befunden und mir abgenommen wurden.
Mein Lehrmeister hatte in der Casseler Judenschaft zahlreiche Kunden, für die er bei vorkommenden Todesfällen Leichensteine auszuführen hatte, an denen hauptsächlich wir Stadtlehrlinge unsere Kunst betätigen mußten. Es waren dies meist große Steinplatten in glatter Ausführung, auf denen in hebräischen Buchstaben die Aufschrift eingehauen wurde, welche vom jüdischen Vorsänger in der Synagoge mit Namen Eppstein vorher auf den Stein aufgezeichnet werden mußte. Neben diesen schlichten Monumenten wurden aber auch reichere für unseren christlichen Friedhof von uns geliefert; von beiden Arten habe ich während meiner Lehrjahre eine Anzahl ausgeführt. Im letzten Lehrjahre konnten sich die Stadtlehrlinge eine Arbeit wählen, an der sie ihre erlernte Kunstfertigkeit zur Schau bringen konnten. Ich hatte zu dieser, ebenso wie mein Kollege Eißenbach, eine etwa einen Meter hohe Vase gewählt, die ich nach meinem eigenen Entwurf in Sandstein ausführte; unsere beiden Vasen wurden im Garten vor dem Hause aufgestellt, ob sie noch existieren, ist fraglich, da der Garten längst bebaut ist.
[5.14 Fußreise nach Wahlhausen]
Im Sommer 1858 machte ich mit zweien meiner Vettern eine Fußtour nach Wahlhausen bei Allendorf (Werra) zum Besuche unseres Onkels, des Försters Scheurmann, ältesten Bruders meiner Mutter. Wir marschierten früh morgens 5 Uhr von Cassel ab über Helsa, Wickenrode, Großalmerode, Trubenhausen usw. und kamen nach 14stündigem Marsche abends todmüde in Wahlhausen an, wo wir von unseren Verwandten, besonders von unseren Vettern und Cousinen freudig begrüßt wurden. Wir verlebten einige recht frohe, glückliche Tage dort im Kreise der Familie; mit unsern Vettern machten wir Ausflüge nach Allendorf, Sooden, der Teufelskanzel und dem Hanstein. Meinen Cousinen, besonders den beiden älteren, hatte ich mich sehr angefreundet, mein Herz hatte Feuer gefangen, [113] ich benutzte jede Gelegenheit, die sich bot, um Süßholz zu raspeln; wir schwärmten uns an, wie es die Jugendzeit unter »zärtlichen Verwandten«, die sich seltener sehen, so mit sich bringt.
Zur Erinnerung an unseren Besuch meißelte ich die Anfangsbuchstaben von uns drei Vettern, mit dem Werkzeug eines in der Nähe arbeitenden Steinhauergesellen, in einen Gartentürpfeiler aus Sandstein. Dies Merkmal habe ich vor einigen Jahren bei Gelegenheit einer Kegelpartie nach dem Hanstein, die uns Kegelbrüder der Dienstags-Kegelgesellschaft durch Wahlhausen führte, noch vorgefunden und meinen Freunden gezeigt; der Garten gehört jetzt dem dortigen Schullehrer.
Nach viertägigem Aufenthalt bei unseren lieben Verwandten trennten wir uns und nahmen Abschied, der uns recht schwer wurde. Wir wanderten denselben Weg wieder nach Cassel zurück, waren aber bei weniger guter Stimmung, wie auf dem Hinweg. Wir schwelgten noch lange in Erinnerung an die schönen Tage, die nun vorüber waren; als ich wieder an die Arbeit ging, wollte sie mir erst gar nicht schmecken, meine Gedanken weilten noch oft in Wahlhausen.
[5.15 Familienleben im Elternhaus]
In unserer eigenen Familie hatte der Storch in diesem Jahre mal wieder Einkehr gehalten, er brachte uns zu aller Überraschung zwei Knäblein zu gleicher Zeit, meine Zwillingsbrüder Georg und Louis. Unser neu hinzugekommenes Geschwister-»Paar« hatte, abweichend von andern Zwillingen, die sich oft täuschend ähnlich sehen, gar keine Ähnlichkeit, keiner glich dem andern; der ältere, Georg, war halb mal größer wie sein Nachkömmling Louis, eine Verwechselung blieb also hier ausgeschlossen.
Die Aufgabe für meine Mutter, neben ihren vielen heranwachsenden Kindern nun noch zwei Säuglinge zu gleicher Zeit großzuziehen, war besonders bei unsern beschränkten Wohnungsverhältnissen doppelt schwer. Oft wußte die durch ihre viele Hausarbeit schon sehr überlastete Mutter sich kaum zu [114] helfen; wenn beide Kleinen, die sie selber stillte, zugleich hungrig waren und nach ihr jammerten, dann nahm die kleine, tapfere Frau beide Quälgeister, auf jeden Arm einen, und gab ihnen zusammen zu trinken. Dies rührende Bild sorgender Mutterliebe habe ich mehrfach mit angesehen. – Meine Mutter kam aber bei alledem so leicht nicht aus der Fassung, bei unermüdlicher Tätigkeit in dem großen Haushalt mit neun Kindern verzagte sie nicht und bewahrte sich ihren guten Humor. Sie war eine treffliche Erzählerin und gab uns manche ergötzliche Geschichte zum besten, darunter einige, die ich versuchen will hier wiederzugeben:
»Während der Regierung des vorletzten Kurfürsten war der Amtssitz der Hofbauverwaltung auf Wilhelmshöhe. Der Bruder meiner Mutter hatte als junger Mann bei dieser Behörde vorübergehend Beschäftigung gefunden. Zur selben Zeit war ein neuer Hilfsbote dort angestellt, der die Botenzüge zwischen Wilhelmshöhe und Cassel zu besorgen hatte. Bei einem dieser Gänge hatte er dienstliche Akten dem in der Stadt am Friedrichsplatz wohnenden ›Hofbausekretarius Ludovici‹ zu überbringen. Bei dem weiten Weg versuchte er den komplizierten Namen zu behalten, warf aber, wie er in die Stadt kam, die Silben konfus durcheinander und frug an der Wohnung des Beamten: ›Komme ich hier recht zum Herrn Hof-Ludensekervizedarius Bauzi?‹ was ihm lachend bestätigt wurde. – Eine weitere Geschichte spielte sich bald nach der französischen Zeit oder noch während derselben ab, wo die hier ansässigen Franzosen sich manches herausnahmen; darunter war ein Herzog von Montmorency, dessen Frau, eine sehr starke Dame, immer einen Hund mit sich führte. Mit diesem Köter spazierte sie eines Tages in eine herrschaftliche Anlage, in der das Mitbringen von Hunden verboten war. Der zum Schutz der Anlagen bestimmte Aufseher trifft die Herzogin und verbietet das Mitnehmen des Hundes. Die Herzogin hält sich aber hierzu berechtigt und entgegnet dem gestrengen Wächter: ›Je suis la duchesse de [115] Montmorency et le duc il a permis.‹ Der derbe Niederhesse legte sich das ihm unbekannte Französisch nach seiner Auffassung aus und erwiderte der Dame in barschem Tone: ›Ich ehe wohl, daß Sie ne dicke Pommeranze sin, aber Ihr Permi kimmet deshalb doch nicht ninn,‹ – sie durfte den Hund nicht mitnehmen.«
[5.16 Berufskrankheit des Vaters]
Meine Mutter klagte niemals, sie wußte, daß für meinen Vater die Sorge um die vergrößerte Familie auch immer drückender wurde, die geschäftlichen Einnahmen dagegen besserten sich nicht. Der Umsatz, den mein Vater in seinem Geschäftsbetrieb erzielen konnte, war nicht sehr erheblich; mit nur einem gelernten Gehilfen und zwei Arbeitern, die alt und grau bei uns geworden waren, betrieb er mit aller Anspannung seiner persönlichen Arbeitskraft sein Geschäft. Streng und gewissenhaft in allem, was er übernahm, genoß mein Vater das größte Vertrauen und die Achtung aller Kreise, mit denen er in geschäftlichen oder gesellschaftlichen Beziehungen stand. Aber bei allem redlichen Quälen und Mühen konnte er bei seiner großen Familie nichts erübrigen. Der damalige Geschäftsbetrieb meines Vaters war aber auch gegen den in der heutigen Zeit ein viel schwierigerer; die Ölfarben wurden nicht wie heute strichfertig aus den Fabriken bezogen, sondern sie mußten mit der Hand auf großen glatten Platten vermittels eines besonders geformten Reibesteines mit breiter Unterfläche fein gerieben werden, was recht lange dauerte. Ebenso war es mit dem Trockenlack »Siccativ«, den Vater selbst fabrizierte. Auf einem in unserem Garten freistehenden gemauerten Ofen wurde der Lack gekocht. Durch das Zusetzen von Silberglätte während des Kochens entstanden giftige Dämpfe, gegen die sich Vater durch einen Schwamm vor dem Munde zu schützen suchte. – Diese Arbeiten gefährdeten trotz aller Vorsicht die Gesundheit unseres Vaters in hohem Grade, er bekam die Bleikolik, die ihn in diesem Jahre (1858) zum ersten Male ganz plötzlich überfiel, so daß wir das schlimmste befürchteten. Wir mußten mitten in der Nacht [116] den Doktor Schotten herbeiholen. Gottlob wurde der schwer Erkrankte wieder hergestellt, aber diese heimtückische Krankheit wiederholte sich später alle paar Jahre und untergrub die Gesundheit meines Vaters, so daß der früher so kräftige und elastische Mann körperlich sehr herunterkam und früh alterte.
[5.17 Bürger-Feuerwehr]
Hier klicken (→) für das Original-Foto der Martinskirche von Carl Machmar. (Universitäts-Bibliothek Kassel)
Martinskirche: Siehe auch das Kapitel »2.13 Altstadt: Martinskirche, Straßenpflaster, Druselteich«.

Die St. Martinskirche mit den neogotischen Türmen nach dem Umbau.*MA
Im Mulang-Archiv vorhanden: »Geschichte der Freiwilligen Feuerwehr der Residenzstadt Cassel. Festschrift zur Abschiedsfeier am 9. November 1907. Von Heinrich Schaefer, Kommandant der Casseler Freiwilligen Feuerwehr und Stadtveordneter«
[Zwischen den Seiten 116 und 117:]

Die St. Martinskirche vor dem Umbau.
Durch die Nachbarschaft des Spritzenhauses wurde unser Vater, der bei der Feuerwehr Kommandant der Spritze Nr.6 war, fast immer an erster Stelle in Anspruch genommen und vielfach in seiner Nachtruhe gestört. Eine Berufsfeuerwehr, die heute in allen Großstädten besteht, konnte sich unsere Stadt noch nicht leisten, auch die freiwillige Turner-Feuerwehr wurde erst später gebildet. Es bestand nur eine Bürger-Feuerwehr, der beizutreten jeder gesunde Bürger bis zum 50. Lebensjahre verpflichtet war. Das Feuerlöschwesen stand damals in Cassel im Vergleich zum heutigen auf einer sehr niedrigen Stufe, wie es heute in kleinen Landstädtchen etwa noch anzutreffen ist. Unsere Stadt hatte noch keine Druckwasserleitung mit Hydranten, noch keine elektrischen Meldeapparte, ebensowenig Dampfspritzen und die mannigfachen vervollkommneten Rettungsapparate, Leitern usw. Wenn irgendwo Feuer ausbrach, wurde die Feuerglocke auf der Martinskirche (s. Abbild.) mit rasch aufeinander folgenden Schlägen, durch kurze Pausen unterbrochen, angeschlagen. Der Turmwächter rief durch ein mächtiges Sprachrohr von der oberen Altane des großen Kirchturmes nach allen Windrichtungen mehrmalig »Feuer« und bezeichnete ungefähr die Brandstätte; das übrige besorgte die Bürgerfeuerwehr, die wie ein aufgestörter Ameisenhaufen aus allen Teilen der Stadt zum Spritzenhaus eilte und dorthin genauere Kunde über die Brandstätte mitbrachte. Der Turmwächter hatte nur noch die Pflicht, so lange wie er eine Flamme sah, mit der Glocke weiter zu stürmen; an der Anzahl der Schläge konnten die Bewohner erkennen, ob das Feuer zu- oder abnahm; wenn die Glocke ganz schwieg, war die Gewalt des Feuers gebrochen. In der Stadt, besonders in unserer [117] Straße, gab es dann immer einen Mordspektakel, das Militär wurde alarmiert, Hornisten durchzogen die Straßen und schreckten mit ihrem schauerlich klingenden Feuersignal
die etwa noch schlafenden Bewohner auf. Das gesamte Militär, sogar die Artillerie mit den Kanonen, rückte mit voller Ausrüstung aus den Kasernen und stellte sich auf dem Friedrichsplatze auf; von dort wurden dann die Brandpiketts an die Brandstelle kommandiert. Die Bürgerschaft war verpflichtet, bei der Dunkelheit der Straßen Lichter hinter die Fenster zu stellen. Unser Vater war stets einer der ersten am Spritzenhaus, denn sobald die Feuerglocke von dem uns naheliegenden großen Kirchturm ertönte, schreckten wir jäh aus dem Schlafe; am ganzen Leibe zitternd, zogen wir uns an und liefen dann auf die Straße oder, wenn sie in der Nähe war, an die Brandstätte. Um die schwerfälligen Spritzen mit ihren viereckigen grünen Wasserkästen an die Brandstelle zu fahren, mußten die Pferdehalter in der Bürgerschaft den Vorspann liefern; am schnellsten erfolgte dieser durch die Pferde der Posthalterei aus deren benachbarten Ställen. Der Wasserbedarf wurde in großen, aufrecht stehenden offenen Tonnen, »Kümpe« genannt, die auf einem schwerfälligen Untergestell mit zwei kleinen Rädern festgemacht waren, ebenfalls durch Pferde an die Brandstelle gezogen. – Die Nachfüllung der Kümpe erfolgte aus dem Druselteich, der zur Füllung von Cisternen in den Straßen abgelassen wurde. Aus diesen Tonnen oder etwaigen anderen Wasserbehältern wurde das Wasser in ledernen Feuereimern, die mit einem Henkel versehen waren, durch eine gliederförmig aneinandergereihte Menschenkette von Hand zu Hand gehend, bis in sogenannte Zubringer gebracht und von diesen in die Spitze gepumpt. Zu dem Dienst des Wasserreichens stellten sich die Zuschauer freiwillig oder sie wurden herangezogen, wenn Not an Mann war. Daß bei dem hastigen Weiterreichen kaum die Hälfte von dem geschöpften [118] Wasser in die Spritze kam, kann man sich denken, die in der Kette stehenden Menschen wurden aber quatschnaß. Bei diesen zeitraubenden Umständlichkeiten dauerte es natürlich sehr lange, bis der erste Strahl Wasser in das brennende Gebäude kam, das inzwischen meist schon halb abgebrannt war; die Spritzen versagten auch verschiedentlich, wenn die Schläuche platzten, zum großen Gaudium des gaffenden Publikums. Wie ganz anders geht es jetzt zu bei einem ausbrechenden Brande, und mit welcher Schnelligkeit, ohne besondere Aufregung der großen Masse, wird ein Brand gelöscht; bei den jetzt bestehenden Berufsfeuerwehren mit ihrer militärischen Disziplin wird die Bewohnerschaft kaum in Mitleidenschaft gezogen.
[5.18 Schlußzeit der Lehre, Modellieren]
Inzwischen war der letzte Winter meiner Lehrjahre heran gekommen; meine Haupttätigkeit in diesem Winterhalbjahr bestand in der Anfertigung konstruktiver Gipsmodelle; mit diesen Arbeiten mußte man sich möglichst vertraut machen mit Rücksicht auf das später anzufertigende Meisterstück. Wenn man nämlich in der ehrbaren Maurer- und Steinhauerzunft als Meister aufgenommen werden wollte – und diesem Ziele strebte ich nach – hatte man neben einer mündlichen Prüfung ein umfangreiches Modell nach einer bestimmten Aufgabe in Gips auszuführen. Mein Bruder August, der inzwischen auch die kurfürstliche Akademie besuchte, genoß, wie ich, auch dort den Unterricht im Modellieren. Wir beide arbeiteten auch im Hause an unseren Gipsmodellen und benutzten zu diesen Arbeiten unser Zimmer, das wir zwei Brüder neben einem Schlafzimmer innehatten. An solchen Tagen, wo wir in Gips formten oder Gesimse in Gips zogen, ließ es sich nicht vermeiden, daß unsere Stube einer Stukkateurwerkstatt ähnlicher sah, wie einem Wohnzimmer; dann hatten wir allemal harte Kämpfe zu bestehen mit unserer Kathrine, so hieß unser Mädchen für alles, das auch unser Zimmer zu reinigen hatte. Wir standen mit ihm oft auf dem Kriegsfuße, wenn es sich Respektswidrigkeiten gegen uns erlaubte und seinen Zorn an [119] uns ausließ. Hatte Trinchen am Ende der Woche unser Zimmer im Schweiße ihres Antlitzes gereinigt, dann ließ sie ihrer bösen Zunge die Zügel schießen und machte ihrem Ärger Luft mit den Worten: »Däh Schwinnehunne, jetz honn ich ochen Schwinnestall mo widder gemistet, wie lange wird’s duhren, dann iß es widder de ahle Sauerei; däh sollt uch was schämen« – sie war nämlich eine dralle Maid vom Dorfe; aber recht hatte sie, Schmutz und Staub war jedoch nicht zu vermeiden, denn wo geschnitzt wird, fallen Späne!
Als Resultat meiner Tätigkeit auf diesem Gebiete hatte ich zwei Modelle fertig gebracht, einen runden Tempelbau mit einer Kuppel und eine architektonisch reichere Vorhalle mit zwei Kreuz-Gewölben vor einem Hauptportal, zu dem gewundene freitragende Treppen an beiden Seiten hinaufführten. Der Kuppelbau fand später auf dem Casseler Rundofen in unserer guten Stube seinen Platz, der Portalvorbau auf einer Kommode, beide Modelle bildeten Dekorationsstücke in dieser Stube, zu denen noch zwei verschiedene, von mir und meinem Bruder August modellierte Gipskonsolen an den Wänden hinzukamen.
[5.19 Gesellengrad]
Beim Abschluß meiner Studien auf der Bauhandwerkschule bekam ich und viele meiner Mitschüler eine Anerkennung durch die Überreichung eines praktischen Lehrbuches, der »Hausmauererkunst«. – Beim Abgang von der Akademie wurde uns Brüdern die silberne Denkmünze zuerkannt, diese Auszeichnung wurde aber nur in einem gedruckten Bericht erwähnt, ausgehändigt wurde sie niemals; das Geld hierfür blieb nach dem damals herrschenden Prinzip weiser Sparsamkeit im Staatssäckel. Im Herbst 1859 hatte ich meine praktische Lehrzeit beendet und mußte, um zum Gesellen befördert zu werden, mein Gesellenstück machen. Zur Anfertigung dieses Gesellenstücks wurde ich dem Hof-Maurer- und Steinhauermeister Credé überwiesen; es bestand in der Ausführung eines Stückes von den Säulenfüßen am Museum Fridericianum, die an Stelle der alten verwitterten damals erneuert wurden. [120] Jeder Säulenfuß war aus drei Stücken zusammengesetzt, mein Gesellenstück bestand aus einem solchen Drittel. – Am 19. Oktober 1859 wurde ich nach vollendeter Lehrzeit losgesprochen, ich erhielt als erstes Dokument meinen Lehrbrief; hiermit hatte ich die erste Staffel in meinem Beruf, den Gesellengrad, erreicht. Zu meiner weiteren Ausbildung wollte ich nun die Baugewerkschule in Holzminden besuchen, deren Kursus bald darauf begann. Nach einigen Tagen verabschiedete ich mich deshalb von meinem Lehrmeister, der mich mit väterlich ermahnenden Worten entließ und mir beim Abschied ein neugeprägtes Blankes 2 Talerstück in die Hand drückte – das war das erste Geld, das mir mein Beruf einbrachte!
[5.20 Baugewerkschule in Holzminden]
Inzwischen war meine einfache Equipierung für den Aufenthalt in Holzminden in Stand gesetzt, die in einem platten, unregelmäßig geformten, schwarzen Lederkoffer untergebracht wurde. Dieser entstammte einem ausrangierten Reisewagen, er konnte sein Alter nicht verleugnen, aber nachdem seine Außenseite mit einem Lackanstrich verschönert war, wurde er für mich noch diensttauglich befunden. Das Monogramm H. Sch., das mein Vater mit weißer Ölfarbe auf den Koffer malte, in der guten Absicht, daß er nicht verwechselt oder gar gestohlen werde, wäre kaum nötig gewesen, denn dies Unikum hätte mir niemand geräubert, höchstens den Inhalt.
Am Tage vor meiner Abreise nach Holzminden übergab mir der Vater das Geld, das ich zur Bestreitung der notwendigsten Ausgaben gebrauchte; das kleine Kapital, das für mich im Laufe der Jahre in der Sparkasse sich angesammelt hatte, kam hierbei zu geeigneter Verwendung. Mit ernsten Worten wurde ich väterlich verwarnt, jede unnütze Ausgabe zu vermeiden, denn ich hätte mit Ausnahme eines bescheidenen Taschengeldes auf weitere Zuschüsse nicht zu rechnen. Ich mußte mich also unter allen Umständen so einrichten, daß ich mit den mir zu Gebote stehenden Mitteln auskam, das nahm ich mir fest vor.
[121] 6. In der Fremde.
[6.1 Reise nach Holzminden, Schulbeginn]
Es war an einem kalten Oktobertage, als ich mich frühmorgens von meinen Eltern und Geschwistern verabschiedete und in noch völliger Dunkelheit zum Bahnhof ging, um meine Reise nach Holzminden anzutreten. Auf dem Bahnhof traf ich mit meinem Vetter Louis Hochapfel und meinem Schulfreund Georg Seidler zusammen, die beide als Fachgenossen schon im Winter vorher die Baugewerkschule besucht hatten; mit diesen reiste ich gemeinschaftlich. Außerdem gesellten sich noch zwei ebenfalls nach Holzminden durchreisende Kameraden aus Wiesbaden zu uns, die mit Seidler und Hochapfel schon bekannt geworden waren, so daß wir nun zu fünft von Cassel zunächst nach Carlshafen abfuhren. Von Carlshafen ab mußten wir die Post benutzen und fuhren mit dieser mit noch mehreren anderen Passagieren zusammengedrängt über Höxter–Corvey nach Holzminden. Durch die anregende Unterhaltung, die sich unter den Passagieren, besonders unter den vier Bauschülern, über ihre Erlebnisse entwickelte, wurden meine Gedanken abgelenkt, so daß ich nicht dazu kam, mich den Gefühlen der Trennung von Eltern und Geschwistern hinzugeben; ich kam dadurch leichter darüber hinweg. – Am späten Nachmittag des 26. Oktober trafen wir in Holzminden ein und stiegen im »Hotel Buntrock« ab, wo wir uns die erste Nacht einquartierten.
Am anderen Morgen meldete ich mich auf der Bauschule beim Direktor, Kreisbaumeister Haarmann, an; ich mußte mich einer Prüfung unterziehen, um in die 2. Klasse aufgenommen zu werden. – Ich mußte dann an die Kasse der Baugewerkschule den Betrag von 56 Talern einzahlen, womit [122] meine Aufnahme vollzogen war. Für diesen Betrag wurde mir folgendes gewährt: Unterricht, Heizung, Erleuchtung, Unterrichtsmaterialien, Beköstigung, Wäsche, Zeitschrift, Wohnung und ärztliche Hilfe; in dieser Reihenfolge werden die Leistungen, die mir für die geringe Summe zuteil wurden, in der Quittung, die ich noch in Händen habe, aufgeführt. – Auf die Dauer des Semesters von fünf Monaten machte es also für den Monat 11 Taler 6 Silbergroschen oder nach heutigem Gelde 33 Mark 60 Pfg., mithin für den Tag schreibe und sage 1 Mark 16 Pfennige. – Man sieht, damals hatte man doch noch etwas fürs Geld! Alsdann ließ ich mich in die Uniform der Bauschule, einen grauen, englisch ledernen Rock mit blanken Messingknöpfen, auf denen das Schulwappen aufgeprägt war, einkleiden, die besonders bezahlt werden mußte, und nun war der Bauschüler oder »Buschäuler« (so wurden diese vom Volke in plattdeutsch genannt) fertig.
[6.2 Schul-Schlafsaal]
Meine Mittel erlaubten es nicht, daß ich, wie Vetter Hochapfel und Freund Seidler und die Söhne besser situierten Eltern, Privatquartier bei Bürgern der Stadt beziehen konnte, ich wurde im Kasernement der Schule einquartiert und bekam die Nummer 102. – Die Schlafräume des Kasernements bestanden aus größeren und kleineren sogenannten »Schlafsälen«, die meist direkt unter den Dächern der verschiedenen zur Anstalt gehörenden Gebäude lagen, ich wurde in einem der kleinsten im Hauptschulgebäude untergebracht, den ich mit noch elf anderen Schülern zu teilen hatte. – Das Mobiliar unseres »Schlafsaales« bestand aus dem Massenbett, zwölf aneinander gereihten Abteilen, die durch stark mannsbreit von einander liegenden Schiedbrettern, zwischen durchgehenden Brettverschlägen am Kopf- und Fußende, auf gemeinsamen Bretterboden gebildet wurden. – Eine gewöhnliche sackleinene Matratze mit Keilkissen, darüber ein Bettuch, ein Kopfkissen und eine starke wollene Decke bildeten die Weichteile dieser »Betten«. Man konnte nur über das Fußende in das Bett ein steigen, und es gehörte eine gewisse Geschicklichkeit dazu, sich in [123] diesen schmalen Kastenverschlag hineinzubugsieren. Mit den Kopfenden berührten die Betten die schräg geputzte Wandfläche der Dachunterseite, so daß man beim Aufrichten sich sehr oft an den Kopf stieß. – Ich hatte noch das besondere Pech, gerade unter einer schrägen Dachluke mit einem eisernen Dachfenster zu liegen und mir in der ersten Nacht an der eisernen Sperrstange des Fensters die Nase blutig zu schinden, mit der ich mich beim Aufrichten im Bett an dieser Stange schrammte. Außer der blutenden Nase genoß ich noch die Annehmlichkeit, daß mir das Schwitzwasser von den Fensterscheiben direkt auf mein Gesicht tropfte und mein Kopfkissen durchnäßte. Ich konnte diesen Mißstand nur dadurch abstellen, daß ich die Sperrstange krumm nach oben bog und meinen Jammerlappen, d.h. meine blaue Steinhauerschürze, nachts zwischen das Dachfenster einklemmte, um das Schwitzwasser aufzufangen; bei Frostwetter war die Schürze vollständig festgefroren. – Die erste Nacht, die ich blutjunger Mensch unter den mir noch wildfremden älteren Handwerksgesellen verlebte, brachte ich fast schlaflos zu. Ich sah durch das noch unverhüllte Dachfenster, wenn ich die Augen öffnete, direkt in den besternten Nachthimmel. In der Erinnerung an mein Elternhaus überkam mich furchtbares Heimweh; ich mußte mir große Gewalt antun, um meinen Jammer zu unterdrücken und keine Schwäche zu zeigen. Meine nächsten Schlafkameraden, von denen mich links und rechts nur das dünne Schiedbrett trennte, waren recht verträgliche Leute; der eine war Steinhauergeselle wie ich, ein Schweizer aus St. Gallen, der andere ein Zimmergeselle aus Ibbenbüren in Westfalen. Letzterer hatte die unangenehme Eigenschaft, daß er nachts, wenn er auf dem Rücken lag, beim Atmen heulende Töne ausstieß. Der arme Kerl wurde deshalb oft arg gepisakt; ich stieß ihn nur an, wenn er anfangen wollte zu heulen, und dann legte er sich auf die Seite. Aber einige Schlafkameraden langten oft über uns nebenliegende hinweg, schlugen ihn mit der Hand oder mit einem [124] Schlappen auf den Mund, so daß er schließlich, wenn er mit Heulen einsetzte, im Schlafe aufschrak und es sich allmählich abgewöhnte.
Über das, was sich unter so dicht gedrängt zusammenwohnenden Menschen verschiedenen Alters, von oft recht zweifelhafter Bildung alles abspielt, will ich unterlassen, nähere Einzelheiten anzuführen; neben vielfach recht komisch wirkenden Vorfällen kamen aber auch solche weniger angenehmer Natur vor, in die man sich aber bei dem Zusammenliegen der Schläfer ohne Zwischenraum zwischen den Schlafstellen schicken mußte, wenn man sich nicht durch Prüderie oder große Empfindsamkeit die Freundschaft seiner Kameraden verscherzen wollte.
Die Koffer standen an den Fußenden der Betten, sie dienten als Schwellen beim Besteigen der Betten und bildeten die einzige Sitzgelegenheit; sonst hatte jeder Schüler noch ein schmales Spind für Kleidungsstücke, das alles war die ganze Einrichtung.
Frühmorgens um 6 Uhr wurden die Schüler durch junge Burschen geweckt, die, mit einer Glocke schellend, von Schlafsaal zu Schlafsaal gingen und das Gas in denselben anzündeten. Diese armen Kerle wurden für die unliebsamen, aber notwendigen Störungen oft schlecht empfangen; wenn sie mit ihrer Schelle in den Schlafsaal kamen und weckten, dann wurden sie mit Schlappen, Pantoffeln oder sonstigen Wurfgeschossen bombardiert und räumten eiligst das Feld. Für mich war das gewaltsame Aufschrecken aus dem festen Schlaf, besonders in der ersten Zeit, nichts Angenehmes, es half aber nichts, man mußte schleunigst vom harten Lager sich erheben, über das Fußende aus dem Bette klettern, in seine Buchse und Pantoffeln schlüpfen und, mit einem Handtuch umgürtet, zwei Treppen hinunter auf den Hof laufen, um sich dort, auch wenn es noch so kalt war, im Freien zu waschen. Unter einem offenen Schuppen standen Holzbänke mit kleinen blechernen Waschnäpfen, von denen man einen zu erhaschen suchte und an der [125] Pumpe mit Wasser füllte. Vor Kälte schnatternd, wusch man sich so rasch wie möglich in dem eiskalten Wasser, und unterwegs beim Wiederherauflaufen trocknete man sich mit dem Handtuch ab. Dies Mittel des Waschens im Freien diente sehr zur Abhärtung, es brachte vor allem jede Schläfrigkeit aus den Knochen, sodaß man beim Beginn des Unterrichts noch bei Gaslicht früh um 7 Uhr frisch und munter war.
[6.3 Unterricht, Verpflegung]
Der Unterricht begann mit einem kurzen Gebet des Lehrers, das stehend von uns angehört wurde. Um 8 Uhr ertönte die Glocke, dann ging es auf die Speisesäle, in denen lange Tafeln mit Holzbänken auf beiden Seiten standen, an den Tafeln hatte jeder seinen Platz nach der Nummer des Kasernements einzunehmen. – Auf dem Wege vom Klassenzimmer nach den Speisesälen, die in einem andern Gebäude lagen, kaufte man sich sein Brot bei den Bäckerfrauen, die in großen Körben in der Vorhalle des Schulgebäudes Brot feilhielten – es waren lange schmale Braunschweiger Brote –, mit einem solchen unter dem Arm stürmte man zum »Morgenkaffee«. Aber dieser war nichts weniger als Kaffee, sondern eine Cichorienbrühe, die, mit Milch gemischt, in großen blechernen Kannen dampfend auf den langen Tafeln stand und aus blechernen Tassen getrunken wurde. Der einzige Vorzug, den dies Getränk hatte, war der, daß es heiß war und deshalb weniger den Gaumen kitzelte, wie den Körper erwärmte.
Wer durch ein Futterkistchen von Hause beglückt wurde, benutzte die noch freie Zeit bis 9 Uhr, wo die Glocke wieder zum Unterricht rief, um sein Frühstück durch ein Gänsefettenbrot oder durch Wurst, Frikadellen usw., je nachdem Mutter ihre Liebesgaben gespendet hatte, zu ergänzen. – Meine Futterkiste, ein schwarzer, mit Eisen beschlagener, verschließbarer Kasten, war ein altes Inventarstück, das zu diesem Zwecke sich als besonders geeignet erwies. Sie übte eine wesentliche Anziehungskraft auf meine hungrigen Schlafkameraden aus, die mir jedesmal beim Eintreffen eifrig mithalfen, den Inhalt rasch verschwinden zu lassen. Nach der Frühstückspause wurde [126] von 9–12 Uhr weiter unterrichtet und dann Mittag gemacht. Wenn das Mittagessen fertig bereitet war, erschallte die Futterglocke, die uns zur Massenabfütterung – es waren über 700 Schüler – wieder in die Speisesäle rief, wo jeder nach seiner Nummer den Platz einzunehmen hatte. – Die Kost, die uns verabreicht wurde, war, wie beim Militär, meist mit Kartoffeln zusammengekochtes Gemüse, Hülsenfrüchte, oder getrocknetes Obst. Jeder Tag in der Woche hatte sein bestimmtes Gericht, das in regelmäßigem Turnus wiederkehrte. Fleisch gab es nur 3 mal, und zwar am Dienstag in Form einer breiartigen gekochten Wurst zu Hülsenfrüchten, deren zurückbleibende Schalen in der nächsten Woche wieder mit untergehackt wurden, – Beweis: ein Stück davon mit Bindfaden von mir selbst in der Wurst gefunden. – Jeden Donnerstag gab es Bouillonsuppe mit gekochtem Kuhfleisch und Gemüse. Sonntags gab es ebenfalls Bouillonsuppe mit Braten, aus dem die Kraft zur Bouillon vorher herausgekocht war.
Für verschiedene Gerichte hatten sich bezeichnende drastische Namen bei den Schülern eingebürgert, so nannte man Backobst mit Kartoffeln »Appel und Tabak«, weil die schwarzen getrockneten Zwetschen an Kautabak erinnerten; weißer Kohl wurde wegen der großen Kohlblätter »Fußlappen« genannt und eine Suppe mit kaffeebohnengroßen Graupen »Totensuppe« u.s.f. – Daß solche Bezeichnungen nicht zur Erhöhung des Appetits beitrugen, ist nicht zu verwundern, ich konnte mich deshalb auch nicht überwinden, diese Gerichte zu genießen, und hungerte lieber.
Jeden Sonnabend bestand die Abendmahlzeit in Pellkartoffeln und Heringen, das war für uns ein Leibgericht, d.h. wenn die Heringe unverdorben waren. – Um so größer war dann aber der Ärger der Schüler, wenn es verdorbene Heringe gab, die nicht zu genießen waren; dann machte sich der Unmut Luft durch allerlei Allotria, die mit den in der Mitte durchgeschnittenen Heringen, die so auf den Tisch kamen, getrieben wurde; das Schulgebäude duftete dann oft tagelang nach nichts weniger wie frischen Heringen.
[6.4 Pausen und freie Zeit]
[127] Die Mittagspause dauerte 2 Stunden, sie wurde von den meisten Schülern dazu benutzt, um sich im Freien zu bewegen oder auch Schlittschuhe auf den Wiesen und den Teichen in der Nähe des Schulgebäudes zu laufen. – Ich verwendete diese Zeit mit noch einigen anderen Schülern dazu, alles das, was man im Unterricht vorher nur skizzenhaft zu Papiere bringen konnte, besser auszuarbeiten; ich kam dadurch nie in Rückstand mit solchen Arbeiten, die bei sehr vielen Schülern ganz unterblieben. Auch des Abends nach dem Abendessen arbeitete ich mit einer Anzahl Kameraden bei einem Talglicht, das ich mir selbst stellen mußte, wenn das Gas ausgedreht war, allerdings auch zum Nachteil meiner Augen, die ich so angegriffen hatte, daß ich zu deren Schutz eine Zeitlang eine blaue Brille und einen grünen Schirm tragen mußte.
Sonnabend nachmittags fiel der Unterricht aus, weil Generalreinigung der Klassenzimmer stattfand. – An diesen Nachmittagen und dem folgenden Sonntag fanden wir Casselaner uns mit einer Anzahl Schulkollegen zusammen, die keinen Gefallen daran fanden, mit den Handwerksgenossen in der unter diesen üblichen derben, zünftigen Weise zu verkehren, darunter war ein lieber Freund, Fritz Kirchner aus Nordhausen. Wir hielten treu zusammen, machten gemeinschaftliche Ausflüge, die sich bis nach Höxter und Corvey ausdehnten, und frequentierten ferner den Holzmindener Bürgerklub, in dem die gebildeten Elemente unter den Schülern gern eingeführt wurden; sie waren als Tänzer für die jungen Damen sehr willkommen. Wir Freunde bildeten zu etwa 10 jungen Leuten einen geselligen Kreis, in dem wir uns regelmäßig zusammenfanden. – Im Musikzimmer des Klubs bot sich mir die sehr erwünschte Gelegenheit, öfters Klavier zu spielen, und ich trug hiermit viel zur Unterhaltung in unserem kleinen Kreise bei. Auch mit einigen höheren Lehrern der Bauschule kamen wir im Klub zusammen und beteiligten uns an fachwissenschaftlicher Unterhaltung. dadurch entstanden nähere Beziehungen, die zur Folge hatten, daß mehrere von uns Einladungen erhielten. [128] Ich verkehrte ebenfalls durch solche Einladung in der Familie unseres ersten Architekten an der Bauschule, meines liebenswürdigen Lehrers, mit dessen Frau, die recht gut Klavier spielte, ich erfreuliche Gelegenheit fand, gemeinschaftlich zu musizieren.
In den Weihnachtsferien reisten wir drei Casselaner in die Heimat, um das Fest mit unseren Angehörigen zu verleben. Für mich war der Aufenthalt im Elternhause eine wohltuende Abwechselung und Erholung nach allen Entbehrungen in Holzminden.
[6.5 Ende der Holzminden-Zeit]
Nach den Festtagen trafen wir mit unseren Freunden in Holzminden wieder zusammen, um unser Studium bis zum Abschluß des Wintersemesters fortzusetzen, dann gingen wir auseinander, jeder seinen eigenen Weg ins Leben. Mit Ausnahme Fritz Kirchners in Nordhausen, mit dem ich dauernd in freundschaftlichen Beziehungen geblieben bin, habe ich von den übrigen Freunden, die ich auf der Baugewerkschule kennen gelernt habe, bald nichts mehr gehört; es waren aber solide, nette Menschen, deren ich mich noch gern erinnere.
Ich hatte mit diesem Wintersemester nun die zweite Klasse der Baugewerkschule absolviert. Mit dem Zeugnis, das mir ausgestellt wurde, konnte ich diesmal Ehre einlegen; ich war glücklich, meinem Vater damit zu beweisen, daß die Mittel, die er mir, meinen Brüdern voraus, zur weiteren Ausbildung gewährte, nicht vergeblich aufgewendet waren.
Was nun ferner mit meiner technischen Ausbildung noch werden würde, ob ich auch die erste Klasse der Baugewerkschule noch besuchen konnte, das ruhte in der Zukunft Schoß. Von meinem Vater eine weitere Beihilfe erwarten zu können, war ausgeschlossen; ich wußte ja, daß er hierzu nicht in der Lage war. Ich war also in Zukunft ganz auf mich selbst angewiesen und mußte die mir noch fehlende Fachausbildung mit eigenen Mitteln zu erlangen suchen; diese mußte ich mir aber erst selbst verdienen.
[6.6 Rückkehr nach Kassel, Wanderbuch]
[129] Ich kehrte von Holzminden nach Cassel zurück und blieb noch einige Tage im Elternhause, um dies dann zu verlassen und als reisender Handwerksbursche mein Glück in der Welt zu versuchen. Ehe ich »auf die Walze« gehen konnte – bezeichnete man damals das Reisen in »die Fremde« – mußte ich mir von der kurfürstlichen Polizeidirektion ein Wanderbuch ausstellen lassen, das zu meiner Legitimation zu dienen hatte. In einem Vorwort auf der ersten Seite dieses Wanderbuchs werden »väterliche Worte an den reisenden Handwerksgesellen« gerichtet, die sich an Ermahnungen und guten Ratschlägen geradezu erschöpfen.
Mein Wanderbuch war ausgestellt:
»Für den Steinhauer Heinrich Wilhelm Schmidtmann aus Cassel«, mit folgender Personalbeschreibung:
Geboren am 22. Februar 1842.
Größe: 5’7.
Zähne: gut (heute?).
Haare: braun.
Bart: –
Stirn: frei.
Kinn: rund.
Augen: blau.
Gesicht: oval.
Nase: stumpf.
Farbe: gesund.
Mund: mittel.
Statur: schlank.
Besondere Kennzeichen: –
Dann folgte auf Seite 2 ein Zeugnis:
»Daß der Heinrich Wilhelm Schmidtmann aus Cassel bei mir 3 ½ Jahre als Lehrling in Arbeit gestanden und sich während dieser Zeit treu, fleißig und gesittet betragen hat, auch, soviel mir bekannt ist, keine Schulden hinterläßt, bezeuge ich hiermit der Wahrheit gemäß.
Cassel, in Kurhessen, am 13. April 1860.
Unterschrift des Meisters. (Namen.)
Unterschrift des Zunftmeisters.« (Namen.)
Die Seite 3 lautet:
»Gegenwärtiges Wanderbuch ist für das In- und Ausland bis Ende 1862 gültig (in diesem Jahre mußte ich mich zum Militär stellen).
[130] Ist geimpft.Gut nach Hannover.
Alle Zivil- und Militärbehörden werden ersucht, den Inhaber frei und ungehindert reisen und zurückreisen zu lassen etc.
Cassel etc.
Kurfürstliche Polizei-Direktion.«
So war denn die Zeit gekommen, wo ich das Elternhaus dauernd verlassen mußte, um von nun an allein, auf meine eigene Kraft angewiesen, durch das, was ich gelernt hatte, mich durchs Leben zu schlagen. Auch mein Bruder Konrad war in seinem Beruf weit genug vorgebildet, um sich in der Fremde zu versuchen. Unsere Abreise war auf ein und denselben Tag festgesetzt. Ich wollte nach dem Norden, dem vornehmlichen Wanderziele aller Steinhauer, die in Hannover am Welfenschloß, in Hamburg an der Nikolaikirche, am Schweriner Schloß und am Cölner Dom sehr gesucht waren und dort lohnende Beschäftigung fanden; mit Hannover wollte ich beginnen. Mein Bruder Konrad wollte nach dem Süden und suchte zuerst in Frankfurt a.M. Stellung.
[6.7 Reise nach Hannover, Begegnung mit Hrn.Gille]
Am Abend vor unserer Abreise übergab mir der Vater einen Betrag von 20 Talern als Reisegeld und Zehrpfennig für die nächste Zeit. Er war sehr bewegt und ermahnte mich mit väterlichen Worten, mir als rechtschaffener Mensch einen guten Namen zu erwerben und stets meine Schuldigkeit zu tun; ich sei nun jetzt als alleinstehender junger Mann den Gefahren des Lebens ausgesetzt; von nun an sei es meine Sache, für mein Fortkommen zu sorgen; er habe an mir getan was er könne, mehr zu tun sei ihm nicht möglich; ich solle daran denken, welche Sorgen er für seine übrige Familie zu tragen habe, er wünsche mir alles Gute und viel Glück für die Zukunft! Unter Tränen versprach ich ihm in die Hand, daß ich mich bemühen würde, ihm nur Freude zu machen, und dankte ihm für alle Liebe und Güte, die er mir erwiesen hatte. Mein Vater hatte vorher sich nie in so ernster Weise mir gegenüber ausgesprochen, um so tiefer ergriffen mich seine Worte; [131] ich nahm mir fest vor, stets an diese Mahnungen zu denken, sie mir zur Richtschnur im Leben dienen zu lassen und mir allein fortzuhelfen.
Am frühen Morgen des 14. April 1860 verabschiedeten wir uns von Mutter und Geschwistern. Vater begleitete uns, seine beiden ältesten Söhne, zum Bahnhof. Mein Bruder Konrad reiste ¼ Stunde vor mir mit dem Zuge nach Frankfurt a.M. ab; wir sagten ihm Lebewohl und begaben uns dann zu dem bereitstehenden Zuge nach Hannover. Ich wählte ein Coupé, in dem nur ein Herr Platz genommen hatte, den ein Geschäftsfreund meines Vaters, Sattlermeister Schäfer, zur Bahn geleitete. Schäfer begrüßte meinen Vater und fragte ihn, ob ich, sein Sohn, auch nach Hannover fahren wollte; wenn dies der Fall sei, möge ich mich von seinem Freunde, der dort bekannt sei, auf der Hinreise über Hannover näher unterrichten lassen. Er stellte uns den Herrn als Rentier Gille aus St. Francisco vor. Dieser erkannte in meinem Vater einen früheren Lehrkollegen aus der Braunschen Wagenfabrik. Auch mein Vater begrüßte freudig seinen alten Bekannten, von dem er in der kurzen Zeit bis zur Abfahrt des Zuges erfuhr, daß er in Amerika sein Glück gemacht habe und jetzt wieder nach Europa zurückgekommen sei, um sich in Cassel zur Ruhe zu setzen. Er sei im Begriff, seine in Hannover verheiratete Schwester und deren Familie zu besuchen; er freue sich, mich zum Reisegefährten zu haben, dann hätte er ja die beste Gelegenheit, während der Fahrt nach Hannover mich über vieles auszufragen.
Nach herzlicher Verabschiedung von meinem Vater fuhren wir, allein im Coupé bleibend, zusammen nach Hannover.
Wie der Zufall oft im Leben eine große Rolle spielt, so war auch dies zufällige Zusammentreffen im Eisenbahnwagen für mich ein Glücksumstand, dem ich eine entscheidende, günstige Wendung in meinem Leben zu danken habe.
Während der Fahrt nach Hannover nahm mein Reisebegleiter Gelegenheit, sich von mir über Casseler Verhältnisse, [132] die ihm durch seine langjährige Abwesenheit völlig fremd geworden waren, erzählen zu lassen; ich erfuhr von ihm ausführlicher, wie er vor vielen Jahren, nach beendigter Lehrzeit als Sattler, nach Amerika ausgewandert sei und dort sein Glück gemacht habe, so daß er sich jetzt in seiner Vaterstadt Cassel niederzulassen gedenke. Während der angeregten Unterhaltung frühstückten wir zusammen, ich stellte meine Hausmacherwurst zur Verfügung, die meinem Begleiter ein besonderer, langentbehrter Leckerbissen war, er seinen vorzüglichen kalifornischen Wein. So vergingen in lebhaftem Gespräch die Stunden bis zu unserem Eintreffen in Hannover.
Als wir in den Bahnhof einfuhren, sahen wir diesen überall mit Fahnen und Girlanden reich geschmückt – es war gerade am Geburtstage der Königin Marie von Hannover, Mein Begleiter machte scherzhaft die Bemerkung, daß es doch sehr aufmerksam von der Stadt sei, daß sie zu unserer Ankunft den Bahnhof geschmückt habe. Er verhalf mir noch zu einem dienstbaren Geist, der mich in die Stadt zur Steinhauerherberge führen und mein Gepäck dorthin besorgen sollte. Nun trennte er sich von mir mit dem Wunsche, daß ich in Hannover Arbeit finden und daß es mir gutgehen möge. Ich bedankte mich für die mir erwiesene Freundlichkeit und verabschiedete mich, um dann mit meinem Dienstmann in der mir fremden Stadt als zureisender Steinhauer in deren Herberge in der Knochenhauerstraße mein Quartier aufzusuchen.
[6.8 Steinhauerherberge in der Knochenhauerstraße]
Auf dem Wege dorthin erfreute mich das Leben und Treiben in der festlich geschmückten Stadt, die gegen unser bescheidenes Cassel einen bei weitem großstädtischeren Eindruck machte, obgleich Hannover damals erst etwa 60.000 Einwohner zählte. Man sah aber überall neuere Bauten, größere Läden die auf einen besseren Wohlstand schließen ließen; vor allem waren die Straßen besser gepflegt, sie hatten durchweg Asphalttrottoire, die man in Cassel noch nicht kannte; dazu kam das vornehmere Treiben auf der Straße gerade an diesem Tage. Alle diese Eindrücke wirkten anfangs wohltuend auf meine [133] Stimmung, aber je mehr ich mich der Steinhauerherberge näherte, die in einer schmalen Straße inmitten des alten Stadtteils lag, desto mehr ließ meine Stimmung nach, besonders als ich in der Herberge anlangte und in die alte dumpfe, düstere Gaststube eintrat, in der mich der Herbergsvater Lange, ein derber, aber doch dabei jovialer Spießbürger, empfing. Nach Vorzeigen meines Wanderbuches wurde mir durch eine Art Kellner mein Quartier in einer im Dachgeschoß liegenden Kammer mit einem ins Dach hineingebauten Erkerfenster angewiesen, aus dem man in den engen, schmutzigen Hof und auf die Ziegeldächer dicht zusammenliegender alter Hinterhäuser blickte. Ohne mich lange in dieser recht ungemütlichen Bude aufzuhalten, begab ich mich wieder hinunter in die Gaststube, um zu Mittag zu essen und mich bei meinem Herbergsvater nach den Adressen der Steinmetzmeister zu befragen, die am Bau des Welfenschlosses (der jetzigen technischen Hochschule) beteiligt waren. Den Gang zu diesen zwecks Ansprache um Arbeit verschob ich auf Anraten meines Wirtes auf den andern Morgen; er meinte, es sei richtiger, mich vorher erst etwas in der Stadt umzusehen. Ein mit mir zugereister Herbergsgenosse, ein Kürschnergeselle aus Sachsen, der mit mir aß, bot sich dazu an, mit mir gemeinschaftlich einen Bummel durch die auch ihm unbekannte Stadt zu machen, was ich gern annahm. Wir pilgerten denn los und zogen kreuz und quer durch die Stadt, so daß wir erst gegen Abend wieder in unserm Quartier eintrafen. Mein Wirt teilte mir so gelegentlich mit, daß jemand dagewesen sei, der nach mir gefragt habe; ich erwiderte, das müsse wohl ein Irrtum sein, denn mich kenne ja doch niemand in Hannover; ich fragte, ob er seinen Namen genannt und wie er ausgesehen habe. Lange aber sagte, er habe sich den Herrn in der Dunkelheit nicht ansehen können, dieser habe nur nach dem Steinhauer Schmidtmann aus Cassel gefragt, er käme vielleicht morgen wieder vor; dann sei er gleich wieder gegangen. Ich besann mich, wer dies wohl gewesen sein könne, und vermutete einen Freund meines Onkels [134] George Schmidtmann, von dem ich jenem brieflich empfohlen war; an meinen Reisebegleiter dachte ich gar nicht mehr.
Ich verbrachte den ersten Abend in der Herberge im Gespräch mit dem sächsischen Herbergsgenossen und sah mir das Leben und Treiben der in der Gaststube in einem dichten Tabaksqualm zusammensitzenden Handwerksgesellen an, darunter war eine Anzahl zünftiger Steinhauer, an die ich mich aber noch nicht heranwagte. Ich ging darauf zeitig in meine Klappe, weil ich von all den neuen Eindrücken und dem mehrstündigen Bummel in der Stadt recht abgespannt war; der Gedanke, wer der Herr wohl sein könne, der nach mir gefragt hatte, beschäftigte mich im Nachdenken während des unruhigen Schlafes in dem mir sehr unbequemen Bett, aus dem die Strohhalme herausragten. Schließlich schlief ich ein und wachte erst spät am andern Morgen auf, als die Sonne durch das Erkerfenster in mein sehr bescheidenes Quartier hineinlugte. Ich hatte mich gerade angezogen und sah in meiner gestrickten wollenen Jacke aus dem Fenster auf die alten Dächer, als der Kellnerjunge an meine Tür klopfte und mir zurief, ich solle herunterkommen, der Herr sei wieder da, der gestern nach mir gefragt habe. Ich beeilte mich und folgte dem Kellner auf dem Fuße; im Gastzimmer fand ich Herrn Gille, der mich sehr freundlich begrüßte und fragte, ob ich ausgeschlafen habe – es war schon nach 10 Uhr. Er sei aber absichtlich etwas früh gekommen, um mich nicht wieder zu verpassen. Er schlug mir vor, am Nachmittag einen Spaziergang mit ihm zu machen zur Besichtigung der Sehenswürdigkeiten Hannovers; wenn ich einverstanden sei, würde er mich zu einer bestimmten Zeit abholen. Ich stimmte freudig zu und stellte mich ihm, wie verabredet, zur Verfügung; so blieb mir am Vormittag noch Zeit, mich wegen Arbeit umzusehen.
[6.9 Arbeit am Welfenschloß]
Sofort nach eingenommenem Kaffee machte ich mich auf den Weg zum angesehensten Steinmetzmeister, dem Hof-Maurer- und Steinmetzmeister Lange in der Theaterstraße. Der Weg war nicht vergeblich, denn ich fand sofort Arbeit am [135] Welfenschlosse; die Casseler Steinhauer waren bei ihm gut angeschrieben, sein erster Steinhauerpolier namens Engel war ein Wahlershäuser. Ich sollte aber erst am Montag anfangen, hatte also – es war Freitag – noch einige Tage für mich, was mir sehr erwünscht war, denn ich fand Zeit, mich nach einer Wohnung umzusehen. Es war mir sehr daran gelegen, so rasch als möglich aus dem ungemütlichen Quartier in der Herberge herauszukommen.
Am Nachmittag gegen 3 Uhr holte mich Herr Gille ab zum Spaziergang durch den Georgengarten nach Herrenhausen; ich sah zum ersten mal den mächtigen Neubau des königlichen Welfenschlosses (siehe Abbild.) und war erstaunt über die reiche Sandsteinarchitektur, von der ich mir vorher keinen Begriff machen konnte.
[Zwischen den Seiten 132 und 133:]
[6.10 Hr.Gille und Familie Kirchweger]
Nach einem mehrstündigen Spaziergang lud mich Herr Gille ein, mit ihm in Hartmanns Biertunnel, dem schönsten Bierlokal Hannovers, ein Glas Bier zu trinken. Gille hatte sich verabredet, hier mit seinem Schwager, dem Kgl. Maschinendirektor Kirchweger, zusammenzutreffen. Ich nahm diese Einladung dankbar an und folgte ihm in das vornehme Lokal, das mir sehr imponierte; solche prächtige Wirtschaftsräume hatte ich noch nicht gesehen. – Der größte Raum bestand aus aneinander gereihten gotischen Spitzbogengewölben, die auf reichgegliederten Pfeilern ruhten; weil er dadurch den Eindruck einer Kirche machte, wurde dieser Raum »Bierkirche« benannt, ein Name, den das Lokal bis auf den heutigen Tag behalten hat. Während wir eine Weile in einem der Räume bei einem Glas Bier Platz genommen hatten, traf der Schwager des Herrn Gille ein, dem ich vorgestellt wurde. Eine stattliche, vornehme Persönlichkeit mit ernstem, gemessenem Wesen, erschien Direktor Kirchweger sehr zurückhaltend und viel in Gedanken vertieft, er beteiligte sich nur zwischendurch an der Unterhaltung; einige Fragen, die er an mich richtete über das, was ich in Hannover beginnen wollte, beantwortete ich mit einer gewissen Befangenheit.
[136] Als wir ausgetrunken hatten, erhoben sich die Herren, und auch ich wollte mich entfernen, nachdem ich meinen verbindlichsten Dank für die mir erwiesene große Freundlichkeit ausgesprochen hatte. Ich wurde aber gefragt, ob ich noch etwas für den Abend vorhabe, was ich verneinte. Darauf bot mir Direktor K. an, mit ihm zu gehen und im Kreise seiner Familie bei einer Tasse Tee den Abend zu verbringen, seine Frau und Töchter würden sich sehr freuen, etwas über Cassel durch mich zu erfahren.
Ich glaubte erst ablehnen zu müssen, weil ich für solchen Besuch meine Garderobe nicht als genügend erachtete, wurde aber, wie ich war, für durchaus salonfähig erklärt, und so wagte ich es, die Einladung anzunehmen.
Kirchweger hatte seine Dienstwohnung in einem Gebäude, das an die Maschinenwerkstätten des Hannoverschen Bahnhofs stieß, zu dem man eine lange Holzbrücke passieren mußte, die über die Geleise der Bahn führte. Die Wohnung nahm die ganze erste Etage und das Dachgeschoß ein, im Parterre waren die Bureaux für die technischen Oberbeamten. – Kirchweger war Vorstand des gesamten Hannoverschen Eisenbahnmaschinenwesens. In seinem Fache eine hochangesehene Persönlichkeit, erhielt er später für seine Verdienste um die Stadt das Ehrenbürgerrecht der Stadt Hannover.
Ich folgte etwas beklommenen Herzens den mir vorangehenden Herren, denn mir bangte davor, was für eine Aufnahme ich, der völlig fremde, als Handwerksbursche eben zugereiste Steinhauergeselle, in der vornehmen Familie finden würde; zaghaft betrat ich die Wohnung. Nachdem ich mit den Herren abgelegt hatte, wurde ich in das Wohnzimmer geführt, wo die Frau Direktor und ihre Töchter um den Tisch herum saßen. Gille stellte mich den Herrschaften vor, bei den jungen Damen fand ich eine überaus freundliche Aufnahme; sie kamen mir mit größter Liebenswürdigkeit entgegen und nahmen mich in ihre Mitte, um sich mit mir über Cassel zu unterhalten. Die älteste Tochter, Fräulein Ottilie, die zwei Jahre älter wie [137] ich war, kannte Cassel durch längeren Aufenthalt in der Familie Henschel; ich suchte, so gut ich vermochte, auf die an mich gerichteten Fragen Rede und Antwort zu stehen. Meine anfängliche Befangenheit war bei der natürlichen Herzlichkeit und dem ungezwungenen Ton in der Unterhaltung bald geschwunden; als wir zu Tische gingen, mußte ich zwischen den beiden ältesten Töchtern Platz nehmen. – Ich kam mir vor wie ein verwunschener Prinz, gestern noch ein heimatloser Fremder in der räucherigen Spelunke meiner Herberge, einsam, zwischen Leuten der harten Arbeit, heute inmitten einer hoch angesehenen, feinen Familie, die mir unbekannten jungen Mann die gastfreundlichste Aufnahme gewährte – ich wußte nicht, wie mir geschah, und dachte an meine Angehörigen, die mich in solchem Kreise nicht vermuten konnten.
Nach Tisch setzte sich Fräulein Ottilie, von ihrem Vater dazu aufgefordert, ans Klavier, um etwas vorzuspielen; das vorgetragene Musikstück war, so viel ich mich entsinne, ein Impromptu von Schulhoff. Daß ich dies ebenfalls gespielt hatte, erwähnte ich beiläufig. Die Unterhaltung führte dadurch auf das Gebiet der Musik; ich erbat mir die Erlaubnis, auch etwas spielen zu dürfen, die gern gegeben wurde. Mit meiner ersten Nummer hatte ich gleich einen durchschlagenden Erfolg, besonders dadurch, weil ich sie auswendig spielte. Auf meine Äußerung, daß ich noch mehr auswendig spielen könne, wurde mir keine Ruhe gelassen, ich mußte weiter spielen. – Ich zog dann meine besten Register auf und spielte auf dem guten Instrument alles, was mir in die Finger kam; ich merkte, daß ich meinen Zuhörern Freude damit machte. In schon vorgerückter Abendstunde mußte ich an den Aufbruch denken und bat, mich empfehlen zu dürfen, weil ich fürchtete, mein »Hotel« nicht mehr aufzufinden. Beim Verabschieden wurde ich eingeladen, am folgenden Sonntag nachmittag zum Kaffee wieder zu kommen, wenn ich nichts anderes vorhätte, und da dies nicht der Fall war, sagte ich freudig dankend zu.
Ehe ich in meine Herberge zurückkehrte, trank ich in Hartmanns Tunnel noch ein Glas Bier, voll von glücklichen Empfindungen [138] über das, was mir in der fremden Stadt in den eben verlebten Stunden geboten war. – Gegen Mitternacht suchte ich mein armseliges Quartier in der Herberge auf, das, gegen die mit behaglicher Eleganz eingerichtete Kirchwegersche Wohnung, mir wie eine düstere Höhle vorkam. Ich suchte sofort meine dürftige Lagerstätte auf und schlief bald darauf ein, umgaukelt von den Gedanken an den schönen Abend.
[6.11 Umzug in den Potthof]
Den folgenden Tag benutzte ich dazu, mir zunächst eine Wohnung zu suchen, die vor allen Dingen nicht viel kosten durfte. Von meinem Herbergsvater erfuhr ich, daß in dem Quartier eines seiner zugereisten Fremden, der in Hannover Arbeit gefunden hatte, noch eine Schlafstelle frei sei; wenn sich jemand fände, der Wohnung suchte, dann möge er diese empfehlen, der Mietspreis sei 20 Silbergroschen für die Woche mit Kaffee. – Bei dem Verdienst von 4 Talern wöchentlich, den ich bei Tagelohnarbeiten – auf diese mußte ich fürs erste rechnen – zu erwarten hatte, konnte ich keine großen Sprünge machen, ich mußte mich sehr einrichten. – Es war mir deshalb sehr willkommen, eine so billige Wohnung haben zu können, die ich alsbald aufsuchte; im Hause »Potthof Nr. 8« – einer schmalen Gasse – (s. Abbild.) befand sich in der ersten Etage die gesuchte Wohnung. Der Hausflur ließ darauf schließen, daß eine gewisse Reinlichkeit in dem bescheidenen Hause herrschte, denn er war, als ich das Haus betrat, frisch mit weißem Sand bestreut; ich ließ mir durch die Besitzerin, eine freundliche ältere Frau, die Wohnung zeigen. Sie führte mich in ein großes Zimmer, in dem ein Mann mit grünem leinenen Arbeitskittel an einem Tische saß; es war ein Uhrmachergehilfe, der seinen kranken Fuß verbunden hatte und sich im Hause mit Reparaturen verschiedener Uhren beschäftigte. Ich stellte mich ihm vor mit dem Bemerken, daß ich die noch freie Schlafstelle zu mieten beabsichtige. Er zeigte mir in einem dunkeln Raum, der, durch eine breite Glastür mit dem Zimmer verbunden, einen großen Alkoven bildete, das noch zu vermietende Bett, welches dicht neben einem andern stand, in [139] dem ein fremder Maurergeselle nächtigte. Ich war zuerst nicht sehr erbaut von dem Schlafraum, den ich mit noch drei Schlafkameraden teilen sollte; durch meinen Aufenthalt in Holzminden aber war ich an das Zusammenschlafen mit fremden Menschen so gewöhnt, daß ich es bei dem billigen Preis erst einmal darauf ankommen lassen wollte; ich wagte den Versuch und ließ mich durch das Zureden des Zimmerkollegen bestimmen zu mieten.
[Zwischen den Seiten 138 und 139:]
Das Zimmer in seiner einfachen Einrichtung bot noch genügend Wandfläche, um ein Klavier aufstellen zu können, denn das durfte mir nicht fehlen! Als ich dies meinem Zimmerkollegen, dem Uhrmacher, sagte, war er sehr erfreut darüber; er meinte, wir könnten dann Konzerte unter uns geben, weil einer der Mitbewohner sehr gut Ziehharmonika spiele – welcher Hochgenuß stand mir also bei dem billigen Mietpreise in dieser Wohnung noch in Aussicht!?
Soweit war ich nun der Sorge um eine Wohnung überhoben; ich ging hinaus nach dem Welfenschloß, um mir den Weg zu der Arbeitsstätte zu merken, und sah mir dann noch den angrenzenden Stadtteil an. Ich erkundigte mich auch danach, wo ich in der Nähe zu Mittag speisen könnte, und fand billigen Mittagstisch im Gasthaus »zur Taube«, gegenüber dem Judenkirchhof, wo auch die meisten Steinhauer etc. vom Welfenschloß aßen; das Mittagessen kostete 3 Silbergroschen täglich im Abonnement. Darauf kehrte ich in meine Herberge zurück und nahm dort meine Mahlzeit ein; ich teilte meinem Wirt mit, daß ich die von ihm benannte Wohnung gemietet hätte und noch am selben Nachmittag dorthin übersiedeln wollte. – Auf meiner Dachstube verbrachte ich noch einige Stunden zur Erholung, ließ dann mein Gepäck nach Potthof Nr.8 befördern und beglich meine Rechnung.
Nach nochmaligem Bummel durch die Stadt aß ich in einem Restaurant zu Abend, ging dann in mein neues Quartier, wo ich den fußlahmen Zimmerkollegen allein vorfand, und brachte dort meine Garderobe, so gut es ging, unter. Wir [140] gingen bald darauf schlafen; in der Nacht aber wurde ich munter gemacht, als mein Schlafnachbar, ein rothaariger Maurergeselle, mit dem andern Mitbewohner, einer Art Ausläufer für ein Geschäft, beide in angesäuseltem Zustande, geräuschvoll heimkehrten und mich aus dem Schlafe aufschreckten. Auf die Frage an den ebenfalls munter gewordenen Uhrmacher, ob ich der neue Schlafkollege sei, antwortete dieser bejahend; er bat die Skandalmacher, sich ruhig schlafen zu legen, was denn auch geschah. Ich konnte aber bei der widerwärtigen Nachbarschaft erst nach längerer Zeit einschlafen. Am andern Morgen stand ich vor den in den Sonntag hineinschlafenden Genossen auf, trank meinen Kaffee allein und verließ die Wohnung, um das sonntägliche Treiben in der Stadt zu beobachten. Später ging ich wieder in die Herberge zu Lange, um zu Mittag zu speisen und mich dort bis zu meinem Besuch bei Kirchwegers aufzuhalten.
[6.12 Umzug hinter den Bahnhof]
Gegen 4 Uhr machte ich mich auf den Weg und wurde von den Damen freudig empfangen. Beim Kaffee mußte ich meine Erlebnisse in Hannover erzählen und kam dabei zu näherer Aussprache, wie ich mich einrichten müsse, um mir allein fortzuhelfen; ich hätte mich aus diesem Grunde nach einer billigen Wohnung umsehen müssen, was mir auch gelungen wäre; billig sei sie allerdings dadurch, daß ich mit noch drei Genossen zusammenwohnen müsse. Diese Nachricht wirkte offenbar nicht günstig auf die Damen, und als ich die Adresse meiner Wohnung Potthof Nr.8 nannte, sahen sie sich mit dem Ausdruck des Erstaunens gegenseitig an, wagten aber nichts zu erwidern. Ich merkte sehr bald, daß diese Mitteilung keine erfreuliche war; die alte Haushälterin der Familie, eine Jugendfreundin der Frau Direktor – sie zählte mit zur Familie – nahm mich denn auch bald allein zur Seite in ein anderes Zimmer; sie sagte mir leise, daß die Straße, in der ich Wohnung gefunden hätte, keinen guten Ruf in der Stadt habe, ich sollte dort keinesfalls wohnen bleiben. – Ich war sehr erschrocken über das, was ich hörte, und dankte für die Aufklärung; [141] unter solchen Umständen wollte ich lieber, ohne zu säumen, umziehen und mir eine andere Wohnung suchen, weil ich mich ohnehin in der dort verlebten Nacht nicht wohl gefühlt hatte. – Mathilde, so hieß die alte, treue Seele, wußte auch gleich Rat, sie hatte erfahren, daß in der Nachbarschaft hinter dem Bahnhof in der »Umfuhr« – so hieß die Straße – eine Wohnung zu haben sei, die ich mir noch an demselben Nachmittag ansehen könne; sie kenne die Vermieterin und wolle sich dafür verwenden, daß ich die Wohnung billig bekäme; aus dem Potthof aber müßte ich schleunigst heraus, sonst schädigte ich mich in meinem Ansehen. Sie ließ mir keine Ruhe, ich mußte mir die nahegelegene Wohnung sofort ansehen. Fräulein Marie, die drittälteste Tochter des Hauses, führte mich durch die großen Werkstätten, in denen wegen der Sonntagsruhe nicht gearbeitet wurde, bis zu einem Tore in der das Bahnhofsgebiet umgrenzenden Mauer und schloß dies auf. Schräg gegenüber lag das Haus, in dem die Wohnung zu vermieten war; meine liebenswürdige Begleiterin versprach, bis zu meiner Rückkehr zu warten und das Tor offen zu halten. Ich ließ mir die Wohnung von der Vermieterin zeigen, es war ein schmales Zimmer im ersten Stock, dazu gehörte ein Schlafzimmer im darüberliegenden Dachgeschoß mit zwei Betten. Für mich allein war die Wohnung zu teuer, sie sollte mit Kaffee monatlich 10 Taler kosten. Ich mietete aber doch sofort, weil ich einen Lehrkollegen aus Cassel, den Schwager des Baumeisters W. Koch, demnächst erwartete; mit diesem hoffte ich, mich in die Wohnung teilen zu können, was auch bald darauf zutraf. Die Wohnung war fertig eingerichtet und konnte jederzeit bezogen werden; ich beeilte mich deshalb zurückzukehren, um meine Begleiterin nicht zu lange warten zu lassen. Fräulein K. war sehr erfreut darüber, daß ich gemietet hatte und nun in der Nachbarschaft wohnen würde; ebenso erfreut waren auch die übrigen Damen, denen der Schreck, daß ich im Potthof Wohnung genommen hatte, in die Glieder gefahren war.
[142] Es wurde nun beschlossen, den Umzug noch an demselben Tage zu bewerkstelligen; in Begleitung eines männlichen Hausfaktotums ging ich in meine nicht weit entfernt gelegene Wohnung, um meine Siebensachen wieder zu packen. Ich traf nur den lahmen Stubenkollegen an, dem ich meinen Entschluß mitteilte; als Grund gab ich an, in einer verwandten Familie Quartier gefunden zu haben. Meiner Wirtin zahlte ich für die eine Nacht die volle wöchentliche Miete und war froh, so schnell in ein besseres Heim einziehen zu können. Mein rasches Handeln wurde mit Freuden begrüßt, als ich nach kurzer Zeit wieder in die Familie zurückkehrte. Nun erleichtert aufatmend, verbrachte ich den Abend in froher Stimmung bei lebhafter Unterhaltung in ähnlicher Weise wie den Abend vorher. Beim Verabschieden wurde mir das Versprechen abgenommen, als nunmehriger Nachbar ohne weitere Einladung jeden Sonntag nachmittag zwanglos in der Familie zu verkehren. Kein Mensch konnte glücklicher sein wie ich; ich war nun nicht mehr allein auf mich selbst angewiesen, ich hatte ganz unerwartet Anschluß an eine liebenswürdige, den angesehensten Kreisen Hannovers angehörende Familie gefunden; ich konnte mit diesem Anfang meiner Laufbahn in der Fremde wohl zufrieden sein.
[6.13 Arbeitsbeginn am Welfenschloß]
Am andern Morgen ging ich in meinem Arbeitskostüm, dem englischledernen Holzmindener Schulrock mit um die Hüfte geschlungener Steinhauerschürze, zu meiner Arbeitsstelle am Welfenschloß und meldete mich beim dortigen Polier. In einer großen, nach allen Seiten hin offenen Steinhauerbude arbeiteten etwa 12–14 Steinhauer, die meistens sehr reich gegliederte Architekturteile zum Schloßbau bearbeiteten. Ich wurde als Junggeselle (tatsächlich war ich auch im Alter der Jüngste) eingestellt, dann, nach Überlieferung des Steinhauergeschirrs, über das unterrichtet, was ich alles zu beobachten hatte, und bekam darauf eine Arbeit, woran ich meine Kunst erproben sollte. Diese Aufgabe war für mich keine leichte, einesteils wegen der ungewöhnlich reichen Detaillierung des [143] Werkstücks, dann aber, weil ich durch die Winterruhe von der praktischen Arbeit mich entwöhnt hatte. Ich mußte mir die Zeit nehmen und konnte nicht so schaffen wie meine Kollegen, die in steter Tätigkeit immer an solchen reicheren Steinhauerarbeiten beschäftigt waren. Der Ausfall meiner Arbeit war maßgebend für mein Bleiben am Bau des Welfenschlosses, sie wurde mir aber abgenommen und zufriedenstellend befunden. Ich hatte damit den Beweis erbracht, daß ich als Steinhauer so weit ausgebildet war, um den hier gestellten Anforderungen genügen zu können. Hätte ich den mir aufgegebenen Werkstein verhauen, dann wäre ich »ausgewiesen« worden, d.h. man hätte mich als minderwertig nicht mehr in der Werkbude gebrauchen können, und ich wäre auf eine andere Arbeitsstelle geschickt worden oder hätte weiter reisen müssen. Ich wurde nun auch für würdig befunden, dem Geheimbund der Steinhauer, der mit dem einfachen Namen »die Gesellschaft« bezeichnet wurde, beizutreten. Hierzu war ich verpflichtet, wenn ich in der Bude bleiben wollte, in der ausschließlich Mitglieder der »Gesellschaft« arbeiteten. »Die Gesellschaft« der Steinhauer war ein Bund mit strengen Satzungen und Gebräuchen, die von jedem Mitgliede aufs genaueste beobachtet werden mußten; nur solche, die durch einwandfreie Leistungen ihre Kunstfertigkeit in der Steinhauerei erbracht hatten, wurden in den Bund ausgenommen. Die Steinhauer damaliger Zeit suchten ihre Ehre darin, der »Gesellschaft« anzugehören, als deren Mitglieder sie auf allen bedeutenden Werkplätzen von den Steinmetzmeistern bevorzugt wurden. Steinhauer, die dem Bunde nicht angehörten, wurden »Schwarze« benannt; diejenigen, die sich mißliebig machten oder ihren Verbindlichkeiten nicht nachkamen, wurden »schwarz gemacht«, d.h. sie wurden ausgestoßen. Für den Bund Unbrauchbare nannte man »Ausgewiesene«. Der Bund übte unter sich treue Kameradschaft und unterstützte seine Mitglieder in Not oder auf der Wanderschaft durch Arbeitsnachweis u.a.
[6.14 Zunftgebräuche]
Es ist vielleicht von Interesse für meine Leser, etwas Näheres zu erfahren über die rituellen Sitten und Gebräuche, [144] deren Beobachtung unter strenger Geheimhaltung jedem Mitglied zur Pflicht gemacht wurde; jetzt hat die Geheimhaltung keine Bedeutung, die Gesellschaft existiert nicht mehr. Ich beginne mit der Kleidung, die jeder »Gesellschafter« auf der Wanderschaft tragen mußte, wenn er um Arbeit »zusprechen« wollte. In einem schwarzen, zweireihigen Rock, der von rechts nach links bis zum Halse fest zugeknöpft sein mußte, so daß er keine Spur von weißer Wäsche sichtbar ließ, in hochschäftigen Stiefeln, mit weißen englischledernen Hosen, auf dem Kopf einen schwarzen Zylinder, in der linken Hand einen kräftigen Rohrstock mit abgerundetem Knopf, einem ledernen Riemchen um das Handgelenk, den Daumen auf dem Knopf liegend – so mußte der »fremde zureisende Steinhauer« an die Steinhauerbude herantreten, wenn er um Arbeit zusprechen wollte, Außerdem hatte er eine Prüfung zu bestehen, wenn er als echter Gesellschafter anerkannt sein wollte. Zeigte sich z.B. auf unserem ausgedehnten Werkplatze am Welfenschloß ein zureisender Gesellschafter, der auf unsere Bude zukam, dann wurde ihm zuerst keinerlei Beachtung geschenkt und ruhig fort gearbeitet. Am äußeren Rand der Bude mußte er dann stramm stehen bleiben, den Stock in der linken Hand bis ans Ohr heben und wieder herablassen (ähnlich wie das »Honneur« beim Militär) und mit energischem Tone anfragen: »Excüse arbeiten Steinhauer hier?« Niemand antwortete ihm; er fragte in gleicher Weise zum zweiten Male, wieder ohne Antwort zu erhalten. Dann mußte er noch heftiger mit herausforderndem Ton fragen: »Sie werden verexcüsieren, arbeiten Steinhauer hier?« Dann erst geht der Altgeselle auf ihn zu und fragt: »Was belieben Sie, ehrbarer Fremder?« worauf er erwidert: »Als ehrbarer Steinhauer um Arbeit anzufragen!« Kommt ihm aber der Altgeselle unvorschriftsmäßig entgegen, d.i. mit herabhängender Schürze, und reicht ihm ohne weitere Form gemütlich die Hand (was sehr oft geschieht, um dem Fremden auf den Zahn zu fühlen, ob er echt ist), dann hat der Fremde mit Entrüstung zu erwidern: »Sie [145] werden venexcüsieren, belieben Sie mich zu empfangen, wie es einem ehrbaren Steinhauer zusteht.« Vorschriftsmäßig hat nämlich der Altgeselle beim Gruß die Schürze mit der rechten unteren Ecke nach links unter das Schürzenband bis an die Hüfte hochzuschürzen, so daß sie im Dreieck, mit der Spitze nach unten, herunter hängt; ebenso muß dem Fremden beim Betreten der Bude der Weg frei gehalten werden, es darf kein Richtscheit oder sonst ein Arbeitsgerät im Wege liegen, was vorher mit Absicht hingeworfen wird. Jeden Verstoß hat der Fremde mit den Worten: »Sie werden verexcüsieren?« zu monieren, worauf Abhilfe geschehen muß mit den Worten: »Sie sind verexcüsiert.«
Wenn der Fremde auf die Aufforderung, näher zu treten, in die Bude eingetreten ist, wird ihm der Hüttenstuhl (ein rundes Sitzbrett mit einem Bein in der Mitte) übergeben, um Platz zu nehmen, was derart geschehen muß, daß er den Stuhl von vorn zwischen den Beinen hindurch, nicht etwa von hinten herum, aufstellt. Beim Sitzen bleibt der Stock in der linken Hand, an der Innenseite des linken Fußes stehend. Dann erfolgt der Budengruß, indem alle anwesenden Steinhauer, voran der Altgeselle, an den Fremden vorschriftsmäßig aufgeschürzt herantreten, ihm mit dem Excüsezeichen, d.i. kurzes Erheben des linken Daumens nach dem linken Ohr, die rechte Hand reichen und ihm leise ins Ohr flüstern: »Seien Sie gegrüßt, ehrbarer Fremder«, worauf er zu erwidern hat: »Danke, ehrbarer Steinhauer.«
Hatte der Fremde gezeigt, daß er bei seiner Begrüßung jede Abweichung von den formellen Gebräuchen bemerkt und durch seine Einsprache gerügt hat, dann wurde er als waschechter Genosse aufgenommen und konnte sich nunmehr zwanglos unterhalten. Hatte er aber selbst Fehler gemacht, die auf Nachlässigkeiten oder Unkenntnis in der Beobachtung der Form zurückzuführen waren, so wurden diese vermerkt und abends auf dem »Verkehr«, so nannte die »Gesellschaft« die Herberge, in der wir unser großes eigenes Zimmer hatten, je nach der [146] Bedeutung der Fehler bestraft. Das Strafmaß für die Fehler wurde mit dem Namen »Bernhard« bezeichnet; wesentliche Fehler kosteten einen »Großen Bernhard«, d.i. ein Fäßchen Bier, kleinere unwesentlichere einen »Kleinen Bernhard«, d.i. eine Flasche echten Korn. Über alle Fragen der Gesellschaft sowohl, wie über Aufnahme neuer Mitglieder, wurde an bestimmten Abenden auf dem Verkehr ein »Budenrecht« abgehalten, eine Art Fehmgericht, in dem ein feierlicher Ernst herrschte. Die Genossen standen im Kreise herum mit verschränkten Armen und beratschlagten mit ernster Miene. Verstöße ihrer Mitglieder wurden abgeurteilt, die je nach ihren Verfehlungen mit großen oder kleinen Bernharden bestraft wurden. An zugereist Fremde wurde das sogenannte »Geschenk«, bestehend in Brot und Schnaps, überreicht, was in sehr gewissenhaft beobachteten Formen, deren Schilderung zu weit führen würde, geschah usw. Nach dem feierlichen Abschluß einer solchen Zeremonie begann der gemütliche Teil der Zusammenkünfte, scherzhafte Vorträge wechselten mit Gesängen im Chor oder auch Solo ab, und dabei wurden die durch Urteil erzielten Bernharde getrunken und mancher »Haarbeutel mit heimgenommen.
Jeden Sonnabend war »Verkehrsabend«, der es jedem Genossen zur Pflicht machte, auf dem Verkehr zu erscheinen, dabei galt nur Krankheit als Entschuldigungsgrund. Meist wurde dann für den Sonntag ein gemeinschaftlicher Ausflug beschlossen, dem ich mich aber nie angeschlossn habe, weil ich es vorzog, in der Familie Kirchweger zu verkehren. Allerdings wurde diese Verfehlung jedesmal gerochen, ich wurde fast regelmäßig zu einem »großen Bernhard«, d.i. ein Ankerfäßchen Bier, verdonnert. Zum Glück hatte ich mich geschäftlich bald eingearbeitet, ich führte mit wenigen Ausnahmen nur Bildhauerarbeiten, Friese, Kapitäle und Konsolen usw. aus, die besser bezahlt wurden und mir einen so guten Verdienst einbrachten, daß ich das Strafopfer leichter zu tragen imstande war; auf der anderen Seite sparte ich die Sonntagsausgaben, [147] die nicht unerheblich waren, denn die »Herren Steinhauer« liebten nicht zu knausern, sondern gut zu leben. Am Tage nach einem solchen Sonntag wurde ich dann stets in der Bude angerempelt und mit Stichelreden behandelt: »Musjeh (so wurde der einzelne angeredet) Schmidtmann, wo steckten Sie wieder gestern? Sie schämen sich wohl, mit uns zu gehen?« usw. Ich erklärte dann stets, daß ich andere Pflichten hätte, denen ich nicht nicht entziehen könne; wenn ich meinen Bernhard geleistet hatte, war dann alles wieder in der Reihe, denn ich stand im übrigen mit meinen Kameraden sehr gut.
[6.15 Arbeitsumstände]
So war denn das Sommerhalbjahr hingegangen. Jeden Morgen um 5 Uhr war ich auf der Arbeitsstelle, die ich abends 7 Uhr erst verließ. Von meiner Wohnung bis zum Welfenschloß hatte ich ½ Stunde Wegs zurückzulegen, es hieß also morgens früh um 4 Uhr aufstehen. Abends nach der Arbeit, wenn ich nach Hause kam, war ich oft so müde und abgeschlagen, daß ich mehrmals bei meinem bescheidenen Abendbrot auf dem Sofa einschlief und, spät in der Nacht aufwachend, kaum noch Bettruhe genießen konnte.
Bei meinem Verdienst, der bei ausschließlicher Akkordarbeit zwischen 6 bis 8 Talern wöchentlich schwankte, fand ich gerade mein Auskommen, konnte aber nichts zurücklegen, was ich beabsichtigt hatte, um die erste Klasse der Baugewerkschule Holzminden besuchen zu können. Es blieb mir also unter diesen Umständen nichts anderes übrig, als ebenso wie meine Kollegen den Winter hindurch praktisch weiter zu arbeiten, was bei eintretender Kälte in geschlossenen, heizbaren Buden geschah. Die Winterarbeit bildet aber bei den Steinhauern immer einen Nagel zum Sarge, weil das stete Einatmen des Staubes vom zu bearbeitenden Stein in der geschlossenen Bude die Steinhauerkrankheit, d.i. Lungenschwindsucht, zur Folge hat, an der die meisten Steinhauer frühzeitig zugrunde gehen.
[6.16 Polytechnikum und Baubüro]
Der Verkehr im Hause Kirchweger hatte sich mit der Zeit so vertraulich gestaltet, daß ich mich über meine Verhältnisse [148] offen aussprechen konnte, auch darüber, daß ich mit mir noch nicht im klaren wäre, was ich im Winter beginnen wollte. Schon lange hatten die Damen mir zugeredet, meine praktische Tätigkeit, die doch so viel Unzuträglichkeiten mit sich brächte, aufzugeben und mich auf technischem Gebiete zu versuchen. Mir fehlte aber hierzu der Mut, weil ich meine Ausbildung für unzureichend ansah, um eine Stellung als Bautechniker annehmen zu können. Aber Zureden half, ich wagte es, nachdem Vater Kirchweger sich ins Mittel gelegt und mir den Rat gegeben hatte, im Winter das Polytechnikum in Hannover als Hospitant zu besuchen und solche Vorlesungen im Baufach zu belegen, die in die Nachmittags- und Abendstunden fielen; ich behielt so den Vormittag frei, um durch Tätigkeit auf einem Baubureau noch etwas verdienen zu können. Nach den Zeichnungen und Zeugnissen aus Cassel und Holzminden zu urteilen, die ich ihm vorgezeigt hatte, könne ich den Nachweis erbringen, daß ich schon einiges zu leisten vermöge. Er erklärte, sich für mich verwenden zu wollen, und gab mir verschiedene Adressen auf, die ich unter Berufung auf ihn besuchen sollte. – Seinem Rate folgend, unterbrach ich meine Arbeit am Welfenschloß mehrmals und machte verschiedene Besuche.
Meinem Vater hatte ich mitgeteilt, daß ich mich um eine Anstellung auf einem technischen Bureau bemühen wollte; bald darauf erhielt ich von ihm einen Brief, in dem er mir mitteilte, daß ein Schwager seines Freundes, des Tapetenfabrikanten Spörer, Stadtbaumeister in Hannover sei; ich möge diesen ebenfalls aufsuchen, Spörer wollte ihn vorbereiten. Auch Kirchweger riet mir, Stadtbaumeister Droste zu besuchen und auf ihn Bezug zu nehmen, was ich denn auch wagte.
[6.17 Volontär am Stadtbauamt]
Droste, ein sehr jovialer, liebenswürdiger Herr, empfing mich mit großer Freundlichkeit; von seinem Schwager Spörer hatte er schon Mitteilung erhalten, daß ich mich an ihn wenden würde. Er frug mich aus über Cassel, meinen Lehrgang in Holzminden, und was ich bis jetzt alles in Hannover unternommen hätte. In kurzen Zügen schilderte ich ihm meine [149] Laufbahn, wie gut es mir in Hannover bis jetzt ergangen sei, und fand bei ihm ein geneigtes Ohr. Um sich noch näher über alles für ihn Wissenswerte zu unterrichten, lud er mich ein, ihn nächster Tage abends zu besuchen und meine Zeichnungen und Zeugnisse mitzubringen. Dieser Einladung folgend, fand ich mich zu gewünschter Zeit ein, unterbreitete meine Zeichnungen und Zeugnisse, und nahm hernach in dem kleinen Kreise des Drosteschen Hauses, bestehend aus den drei Personen Vater, Sohn und Tochter, letztere beide etwas jünger wie ich, am Abendee teil. Auch hier hatte ich das große Glück, eine überraschend freundliche Aufnahme zu finden, zu der mir mein bißchen Klavierspielen wohl mit verholfen haben mochte. Der alte Herr wurde dadurch sehr aufgedreht und heiter gestimmt, was sonst selten vorgekommen war, wie ich hörte; er war nämlich seit einigen Jahren Witwer. Droste gab mir das Versprechen, sich um meine Anstellung am Stadtbauamte verwenden zu wollen, wenn ich mich dazu verstehen würde, eine Prüfungszeit als Volontär für die Dauer von 3 bis 4 Monaten einzugehen. Wenn ich diese Bedingungen annehmen wolle, dann würde er Gelegenheit haben, sich von dem zu überzeugen, was ich zu leisten vermöchte. Falls ich seinen Erwartungen entspräche, würde er beim Magistrat der Stadt für mich eintreten; er lege Wert auf praktische Vorbildung, ihm wäre ich deshalb genehmer, wie mancher andere, dem eine solche fehle. Droste selbst war nämlich auch aus der Praxis hervorgegangen; er war in Mannheim vor seiner Anstellung in Hannover als Maurermeister etabliert gewesen. Eine Zusage mußte ich aber davon abhängig machen, ob ich von Hause eine Unterstützung finden würde, welche es mir ermöglichte, mich während der Monate ohne Verdienst wenigstens einigermaßen über Wasser halten zu können.
Mein Vater, dem ich über alles ausführlich Mitteilung gemacht hatte, erklärte sich auf meine Bitte bereit, mich mit monatlich 12 Talern unterstützen zu wollen, aber nur für höchstens 3 Monate. – Doch »frisch gewagt, ist halb gewonnen«, [150] dachte ich, stellte mich dem Herrn Stadtbaumeister zur Verfügung und trat mit Anfang des folgenden Monats meine Stellung an, nachdem ich vorher meine Beschäftigung als Steinhauer aufgegeben hatte. Der Vorsorge halber aber blieb ich einstweilen noch in Verbindung mit meinen seitherigen Kollegen und trat noch nicht aus der »Gesellschaft« aus; ich konnte ja noch gar nicht wissen, ob ich meine Prüfung mit Erfolg bestand, oder ob ich andernfalls nicht wieder zu Knüppel und Eisen greifen mußte, und so schloß ich einstweilen mit meiner praktischen Tätigkeit ab.
[151] 7. Auf anderer Bahn.
[7.1 Arbeiten an Mühlengebäuden]
In der Nähe des Hannoverschen Residenzschlosses an der Leine liegen zwei städtischen Mühlen, die Brückmühle und die Klickmühle damals benannt, letztere jetzt die Pumpstation des städtischen Wasserwerks mit seinen herrlichen Bauten. Die alte Brückmühle war abgebrochen worden; an ihrer Stelle erhebt sich jetzt ein stattlicher Bau über dem Wasserspiegel der Leine, deren Flut in dem massiven Unterbau mächtige Turbinen durchströmt, die das gesamte Mühlengetriebe in Bewegung setzen. Dies neue Gebäude war damals im Rohbau bis auf den inneren Ausbau fertiggestellt, als ich vom Stadtbaumeister Droste dem mit der Bauführung betrauten Stadtbauvogt Ratkamp als neugebackener Bautechniker zur Hilfeleistung überwiesen wurde.
Meine erste Arbeit war das Entwerfen und Detaillieren der sämtlichen Tischlerarbeiten für den Neubau. Auf diesem Gebiete hatte ich mich aber bisher noch gar nicht versucht, mir fehlte jedes Vorstudium, auch waren mir damals noch keine Werke bekannt, aus denen ich mein Wissen auf diesem Gebiete hätte bereichern können. Um mir die nötigen Kenntnisse zu verschaffen, suchte ich an ausgeführten Arbeiten abzugucken, was mir dienlich erschien. Von besseren Fenstern und Türen machte ich mir Skizzen über Verzapfungen der Rahmenhölzer, Überfälzungen, Profile etc. Auf diese Weise gelang es mir, mich einigermaßen einzuarbeiten, die Zeichnungen für sämtliche Tischlerarbeiten fielen zur Zufriedenheit meines Vorgesetzten aus, so daß die Ausführung danach erfolgte. Stadtbauvogt Ratkamp, ein älterer, unverheirateter Herr, hatte sich bei seiner langjährigen Praxis reiche Erfahrungen im Baufach [152] erworben, mit denen er mir, dem noch sehr unerfahrenen Anfänger, in freundlicher Weise an die Hand ging.
Der Neubau der Brückmühle bot gegen andere Gebäude viel Außergewöhnliches durch die Ausführung von Wasserbauten in Verbindung mit Hochbauten. Die Anlage mächtiger Dammbildungen zur Abhaltung des Stromes bei Herstellung der Mauern zu den Turbinenkammern, die schwierige Wasserbewältigung etc., dies alles kennen zu lernen, war für mich hochinteressant. Ich habe mehrmals Nächte hindurch die mit Fackelschein beleuchtete Arbeitsstelle nicht verlassen, wenn Kalamitäten bei Hochwasser eintraten. Bei dieser Gelegenheit schaffte ich mir ein Paar mächtige Wasserstiefel an, die ich in späteren Jahren mit Vorliebe getragen habe.
Um mich theoretisch noch mehr auszubilden, hatte ich im Polytechnikum an vier Abenden und zwei Nachmittagen Vorlesungen belegt, wozu mir Stadtbaumeister Droste freie Zeit gewährte. So suchte ich meine Kenntnisse zu bereichern, das Gefühl der Unsicherheit schwand allmählich, und ich bekam immer mehr Selbstvertrauen.
[7.2 Geldsorgen und Hoffnungen]
Nach Ablauf von drei Monaten sandte mir meine Mutter einen Brief; sie schrieb mir im Auftrage meines Vaters, daß es ihm nicht möglich sei, mir ferner noch einen Zuschuß zu gewähren, ich müsse versuchen, wieder etwas zu verdienen. Es sei doch auch keine Schande, ebenso wie alle meine bekannten Berufskollegen wieder praktisch zu arbeiten. Die Versprechungen des Stadtbaumeisters Droste, mir eine Stelle am Stadtbauamt zu verschaffen, wären wohl gut gemeint, sie würden sich aber wohl schwerlich erfüllen lassen, weil ich kein Hannoveraner sei; es täte Vater sehr leid, mir weiter kein Geld schicken zu können, es wäre ihm absolut unmöglich. Diese Mitteilung erschreckte mich und machte mich sehr mutlos; ich stand vor der Frage – was nun beginnen?
In meiner Notlage suchte ich meinen Stadtbaumeister auf und zeigte ihm rückhaltlos das Schreiben meiner Mutter; ich erklärte ihm, daß ich auf keinen Fall den Versuch machen [153] würde, einen weiteren Zuschuß zu erbitten; wenn auch schweren Herzens würde ich wieder zu Knüppel und Eisen greifen müssen, wenn ich jetzt keine Anstellung bekommen könne. Droste teilte mir darauf vertraulich mit, daß er eine Stelle für mich habe, über die demnächst entschieden werden würde, bis dahin möge ich mich geduldigen. Er werde mir eine kleine Privatarbeit zuwenden, mit dem Honorar hierfür könne ich vorläufig meine Existenz bestreiten. Zunächst mußte ich auf seinem Bureau im Stadtbauamt arbeiten; hier fand ich Gelegenheit, mit dem alten Herrn in nähere Beziehungen zu treten. Ich fühlte bald heraus, daß er mir wohlwollte, dadurch, daß er mir die Ausarbeitung eines Projektes für drei aneinanderstoßende kleinere Wohngebäude übertrug. Er ließ mir, ohne irgendwelche Beihilfe, volle Selbständigkeit; ich war sehr erfreut, daß das Projekt zur Zufriedenheit des Bauherrn ausgefallen war. Die nach diesem meinem Erstlingsentwurf ausgeführten Häuser stehen heute noch am »Jungfernplan« in Hannover, sie sind gegen heutige Ansprüche allerdings einfach und geschmacklos. Der Bauherr händigte mir bei Ablieferung des Projektes einen Doppel-Friedrichsd’or ein, nach unserem jetzigen Gelde ungefähr 35 Mark – kein Mensch aber konnte froher sein als ich, nach diesem ersten klingenden Erfolg!
Es ging mir, seitdem ich nicht mehr praktisch arbeitete, recht kümmerlich; meine Einnahmen betrugen kaum etwas mehr wie ein Drittel von dem Verdienst, den ich als Steinhauer gehabt hatte, ich mußte mich deshalb sehr einschränken. Außer dem Zuschuß, den ich von Hause bekam, beglückte mich meine Mutter alle vier Wochen mit einer Futterkiste; der wertvollste Inhalt war in der Regel ein Steintopf mit Mus oder Wurstefett, weil ich mit diesen Ingredienzien längere Zeit haushalten konnte, um mein frugales Abendbrot aufzubessern; mitunter leistete ich mir auch einen leckeren Handkäse. Mit meinem Mittagstisch hatte ich mich auch billiger eingerichtet, ich aß für 25 Pfennig bei Battermann in der kleinen Packhofstraße. In dieser bescheidenen Weise mußte ich mich etwa vier [154] Monate durchschlagen, in denen nur die Sonntage durch das Gastrecht, das ich im Hause Kirchweger genoß, mir eine angenehme Abwechselung brachten.
[7.3 Anstellung bei der Stadt]
So war denn wieder ein Monat verstrichen, die Entscheidung über meine Anstellung ließ noch immer auf sich warten, sie schien mir immer zweifelhafter, weil Stadtbaumeister Droste sich nicht darüber äußerte; ich wagte auch nicht danach zu fragen. Von Ratkamp erfuhr ich, daß Droste viel Ärger und Verdrießlichkeit über meine Anstellung habe; er gebe sich alle erdenkliche Mühe, um mir die Bauführerstelle an dem Neubau des Brauergildehauses auf dem Grundstück der städtischen Brauerei am Georgenwall zu verschaffen, habe aber noch nichts erreicht. Die städtische Brauerei, die der Brauergilde, einer Körperschaft der vereinigten Brauhausbesitzer, d.h. solcher Hauseigentümer, auf deren Häusern eine aus dem Mittelalter stammende Braugerechtsame ruhte, unterstellt war, wurde verwaltet vom Brauereigilde-Vorsteher-Kollegium, in dem ein städtischer Magistratsdeputierter, der jeweilige Bausenator, Sitz und Stimme hatte. Dieser, derzeit Senator Lücke, seines Zeichens ein Branntweinbrenner und langjähriges Magistratsmitglied, war aber gegen meine Anstellung und suchte sie zu hintertreiben; er bekämpfte sie, weil ich noch zu jung sei und noch keine Erfahrung besäße, hauptsächlich aber, weil ich kein geborener Hannoveraner wäre. Meine Anstellung durchkreuzte seinen Plan, einen Anderen an diesen Platz zu bringen, dem er bestimmte Aussicht gemacht hatte. So leichtes Spiel räumte ihm aber mein mir sehr gewogener Gönner Droste nicht ein, der sich mit Entschiedenheit gegen meinen Konkurrenten auflehnte, für den er keine Verantwortung übernehmen könne. Er hatte es durchgesetzt, daß ich mich vor der Entscheidung über meine Anstellung den Herren des Kollegiums vorstellen durfte, denen ich bald darauf meine Aufwartung machte. Ich fand bei den Herren eine wohlwollende Aufnahme, bis auf Senator Lücke, der mich sehr kühl behandelte und Andeutungen machte, daß meine Anstellung wohl kaum zum Beschluß gelangen [155] würde. Ich referierte meinem Gönner über meine Besuche und drückte meine Besorgnis darüber aus, daß es Senator Lücke gelingen würde, seinen Anwärter doch durchzubringen; Droste erklärte aber mit Bestimmtheit, daß er dann seine Pläne zurückzöge.
Am andern Morgen kam mein Vorgesetzter in offenbar heiterer Stimmung aufs Bureau, legte eine Rolle Zeichnungen vor mich auf mein Zeichen-Brett – es war sein Entwurf zum Brauergildehaus – und gratulierte mir zu meiner Anstellung, die in der Abends vorher stattgehabten Sitzung des Brauereigildekollegiums endgültig erfolgt sei, nachdem Senator Lücke aus der Baudeputation ausgetreten. Droste freute sich sehr über das Ausscheiden seines alten Gegners, der ihm schon viele Ärgerlichkeiten bereitet hatte, und drückte die Hoffnung aus, daß, nachdem er so nachdrücklich für mich eingetreten sei, meinerseits alles aufgeboten werde, um ihm Ehre zu machen, was ich ihm feierlich in die Hand gelobte. Meine Anstellung, so teilte er mir mit, beginne sofort, mit einem Monatsgehalt von 30 Talern, freier Wohnung, freiem Brand und Licht.
Meine Freude, endlich aus dem Hangen und Bangen heraus zu sein, läßt sich denken. Meine Eltern berichtete ich sofort über die unerwartete glückliche Wendung, die für meine Zukunft entscheidend sein sollte. Mein Vater nahm meine Mitteilung mit geteilten Gefühlen auf; er schrieb mir, statt zu gratulieren, er verstände es nicht, daß ich diese Stelle bekommen hätte, ich sei doch noch viel zu jung – ich war kaum 18 Jahre, ob meine Vorbildung ausreiche, erscheine ihm auch fraglich. Jedenfalls könne ich von großem Glück sagen, daß mir ein solches Vertrauen entgegengebracht würde; an mir würde es nur liegen, dies zu rechtfertigen und immer mehr zu befestigen.
[7.4 Alte und neue Freundschaften]
»Offensichtlich war es der Feuerspritzen-Fabrikant Louis Tidow (1805–1878), dessen Sohn und Nachfolger Conrad in der Tat ebenfalls 1842 geboren wurde. Spätestens als Rentier lebte Louis Tidow mit Ehefrau Amalie im Haus Andreaestraße 5 in Hannover.« (Mitteilung von Matthias Blazek)
Mein lieber Vater, der trotz aller seiner steten, unverdrossenen Arbeit bei dem beschränkten Umsatz geschäftlich keine großen Erfolge erzielen konnte, der statt dessen reichlich mit Sorgen zu kämpfen hatte, war eine mehr skeptisch veranlagte [156] Natur, ihm fehlte auch jeglicher Spekulationssinn; er mußte, ehe er sich ein Urteil bildete, alles erst völlig klar sehen. Es war deshalb begreiflich, daß es für ihn einer gewissen Zeit bedurfte, um sich zu überzeugen; er gebrauchte in solchn Fällen den Ausdruck »erst abwarten«; ob ich meiner Stellung gewachsen sei, mußte ihm erst die Zeit lehren, zunächst verhielt er sich noch reserviert. Die Familie Kirchweger erfuhr noch am selben Abend die frohe Botschaft, die mit sichtlicher Freude auf genommen wurde. Meine veränderte bessere Lebensstellung, als nunmehriger städtischer Bauführer, brachte es mit sich, daß ich in gesellschaftlichem Verkehr mich ungleich freier fühlen und bewegen konnte, wie ich es seither als Handwerksgeselle nicht zu tun wagte. Die Folge davon war, daß sich meine Beziehungen zur Familie K. immer besser gestalteten; ich wurde gehalten wie ein naher Verwandter des Hauses und von nun ab auch in den Familien eingeführt, die mit K.’s in freundschaftlichem Verkehr standen. Dazu gehörte die Familie des Dr. Davisson, der Vorsteher des ersten Pensionsinstituts für Ausländer in Hannover war. Ich fand hier die liebenswürdigste Aufnahme und hatte Gelegenheit, mich einigen netten, fein gebildeten Pensionären, zwei Engländern aus Glasgow und einem Franzosen aus Angers, besonders anzufreunden, mit denen ich während ihrer Pensionszeit in Hannover viel verkehrte. Die einzige Tochter des Hauses, Cécile, war die beste Freundin der Schwestern K. An den Familienabenden, die im Hause Davisson öfters abgehalten wurden, gaben die jungen Damen uns jungen Männern Anregung zu interessanten Unterhaltungen, musikalischen Vorträgen und Gesellschaftsspielen; meist wurde Schluß gemacht mit einem Tänzchen, zu dem ich aufspielte. Diese Veranstaltungen gehören mit zu meinen schönsten Erinnerungen und bilden heute noch ein Unterhaltungsthema, wenn ich mit meinen alten Freundinnen jener Zeiten gedenke.
Eine weitere Bekanntschaft machte ich darauf mit der K.’s befreundeten Familie des Maschinenfabrikanten Tidow; zwei [157] Töchter und ein Sohn der Familie waren mit mir annähernd gleichen Alters; mit letzterem war ich als Mitglied der Liedertafel »Union« schon vorher bekannt geworden. Die Eltern des Hauses, sonst seelensgute Menschen, waren ein ungleiches Paar, die Mutter ruhig, geduldig und nachsichtig, besonders gegen ihre Kinder, der Vater dagegen heftig, aufbrausend und kurz in seinem Wesen – ein wunderlicher alter Kauz – der trotzdem von seinen Kindern nicht ernst genommen wurde. Vater Tidow hatte sich auch von der Pike auf in die Höhe gearbeitet und war als praktischer Maschinenschlosser in die Welt gezogen; er schenkte mir, der ich in ähnlicher Weise mich in der Welt durchzuschlagen suchte, seine besondere Zuneigung. Ich wußte ihn zu nehmen, bei seinem Interesse für das Bauwesen fehlte es auch nie an Stoff zur Unterhaltung zwischen uns. Und so kam es denn, daß ich mit dem alten Herrn auf gutem Fuße stand, den übrigen Familienmitgliedern war mein Einfluß auf ihn sehr willkommen, wenn sie etwas erreichen wollten, mußte ich Fürsprache einlegen, die oft, aber nicht immer, von Erfolg war.
Der Verkehr im Hause Tidow nahm mich von jetzt ab vorzugsweise in Anspruch, wenn ich geschäftlich frei war, meine Besuche bei K.’s und D.’s waren dadurch seltener. An der abendlichen Familientafel hatte ich meinen festen Platz neben dem alten Herrn, der mich, während gespeist wurde, über alles, was der Tag sowohl geschäftlich wie politisch usw. gebracht hatte, gründlich ausquetschte; er weihte mich dann auch wieder ein in das, was ihm von Interesse schien, und so führten wir meist die alleinige Unterhaltung. Wenn wir genug geplaudert hatten, kam Mutter T., gab dem Alten die Zeitungen und veranlaßte ihn zum Lesen, dann zogen sich die Damen mit mir in ein anderes Zimmer zurück, um zu musizieren. In dieser Weise verbrachte ich manche Abende und Sonntage in dieser Familie, der ich in meinen Erinnerungen ein stets freundschaftliches Gedenken bewahrt habe.
[7.5 Arbeit am Brauergildehaus, Wohnungswechsel]
Mit diesen Schilderungen bin ich denen über meine berufliche Tätigkeit um einige Jahre vorausgeeilt; was ich über [158] diese, anschließend an meine Anstellung als städtischer Bauführer, weiter zu berichten habe, will ich nun nachholen. Ehe mit dem Bau des Brauergildehauses am Georgenwall begonnen werden konnte, mußten erst die nötigen technischen Vorarbeiten hergestellt werden, über die ich mich sofort nach Überreichung des Entwurfes durch Stadtbaumeister Droste hermachte. Die erste Aufgabe war, den skizzenhaft gezeichneten Entwurf vollständig genau durchzuarbeiten, die Fassaden, Grundrisse und Schnitte als Werkrisse für die Ausführung herzustellen und dann den Kostenanschlag aufzustellen. Ich war recht besorgt, ob ich wohl der Aufgabe auch gewachsen sein würde, denn sie war für mich als Anfänger tatsächlich keine leichte und erforderte die Anspannung aller meiner Kräfte. Aber unter den Augen meines mir wohlwollenden Chefs und mit Rat und Hilfe meines Kollegen Rathkamp arbeitete ich mich bald in die Sache hinein und schaffte freudig mit regem Eifer, sodaß ich so rasch vorwärts kam, daß mit dem Bau im Frühjahr 1861 begonnen werden konnte.
Um immer in der Nähe des Baues sein zu können, wurde mir im alten Brauereigebäude an der Osterstraße im Parterre ein großes Zimmer zum Geschäftsbureau mit daran anstoßen dem Schlafzimmer überwiesen. Meine erste Wohnung in der Umfuhr hinter dem Bahnhof hatte ich infolge von Differenzen mit meiner zanksüchtigen Wirtin gewechselt mit einer Wohnung bei meinem Schneidermeister Senne, einem biederen hannoverschen Spießbürger, dessen treuer Kunde ich war, soweit von meiner bescheidenen Kundschaft die Rede sein konnte. Von hier bezog ich alsdann meine Dienstwohnung im Brauhause.
Das sehr geräumige Zimmer ließ es zu, daß ich mir, neben meinem großen Zeichentisch, meine Einrichtung noch recht behaglich machen konnte. Ich schaffte mir nun auch ein besseres Piano an, das ich durch allmähliche Abzahlung als Eigentum erwarb, dies war mein erster selbst erworbener Besitz, auf den ich nicht wenig stolz war. Die Stelle meines Hauswirtes vertrat Braumeister Ebert, zu dessen Wohnung meine Zimmer gehörten, die er an die Bauverwaltung abgetreten hatte.
[159] Außer ihm bewohnte noch der Brauereiverwalter Wildhagen das Haus, dem die Geschäftsräume unterstellt waren. Die oberen Etagen, bis in das hohe Dach hinein, dienten zur Lagerung von Gerste, Hopfen u.a. Das alte Brauhaus an der Osterstraße brannte vor etwa 15 Jahren total ab, und ein wunderbarer Zufall war es, daß gerade, als ich meinem Schwiegersohn gelegentlich eines Besuches in Hannover meine frühere Wohnstätte zeigen wollte, die Flammen aus einer Giebelluke herausschlugen, so daß wir Augenzeugen des Brandes waren. Die Brauerei selbst befand sich hinter dem Hause; Sudhaus, Mälzerei, Darre, Gärkeller und Faßhalle in verschiedenen Bauten. Dahinter lagen die großen, doppelt übereinanderliegenden Lagerbierkeller, halb in die Erde hineingebaut, halb über derselben; diesen fügte sich der große Neubau an, der am Georgenwall errichtet werden sollte. Im Erdgeschoß desselben war eine auf Säulenstellung überwölbte Vorhalle vorgesehen, von der eine breite Treppe zur Hauptetage führte, auf beiden Seiten waren Läden. Die Hauptetage war dazu bestimmt, für den »Englischen Club«, dem der vornehmste hannoversche Adel angehörte, als Gesellschaftslokal zu dienen. Die Innenausstattung der Klubzimmer war eine für damalige Verhältnisse vornehme, mit reicher Innenarchitektur, die übrigen Etagen waren zu herrschaftlichen Wohnungen bestimmt.
[7.6 Wohn-, Bier- und Geldverhältnisse]
Von meinem Bureau zur Baustelle führte der Weg durch die Brauerei, deren Betrieb ich dabei kennen zu lernen Gelegenheit hatte. Ebenso lernte ich durch den täglich öfteren Verkehr das ständige Personal, das in der Brauerei tätig war, kennen; es waren gemütliche Leute, meist Bayern und Böhmen, mit denen ich auf gutem Fuße stand.
Zu meinen Bezügen, außer meinem Gehalt, gehörte, wie schon erwähnt, freie Wohnung, freier Brand und Licht, außerdem aber bekam ich stets Freibier, und dies nicht allein für mich, sondern auch dann, wenn ich Gäste bei mir hatte, denn Bier zum Freitrunk für das in der Brauerei tätige Personal war von der Verwaltung reichlich bewilligt. Ich brauchte nur den Wunsch zu äußern, »ein Blech« Bier, d.h. eine große blecherne Kanne mit breitem Boden, auf meiner Bude zu [160] haben, dann wurde mir dies, voll schäumenden Gerstensaftes frisch vom Lagerfaß von einem der Brauburschen gebracht. Mein Monatsgehalt war 30 Taler, ich erfuhr aber bald aus den Büchern und Akten meines Vorgängers, der den Bau der Mälzerei und Darre zu leiten hatte, daß diesem ein Gehalt von 40 Talern bewilligt war. Die Arbeiten, die ich bei dem architektonisch reicheren Gebäude zu liefern hatte, übertrafen aber erheblich diejenigen an den einfacheren Brauereigebäuden. Ich erfuhr auch, daß die Zeichnungen früher auf dem Bauamte gemacht waren, während ich selbst alle Zeichnungen ohne Hilfe auf meinem Bureau machen mußte.
Die Mitglieder der Baukommission nahmen mehrfach Veranlassung, mich auf meinem Bureau zu besuchen und ließen sich meine Zeichnungen vorlegen. Bei einer Konferenz in meinem Bureau hörte ich, wie mein Chef sich den Herren gegenüber über meine Tätigkeit äußerte und hervorhob, daß ich keiner weiteren Hilfe bedurft hätte. Er tat dies anscheinend weil, trotz seines Eintretens für mich, meiner Anstellung vorher durch Senator Lücke Schwierigkeiten bereitet waren. Die Anerkennung, die ich auf diese Weise erfuhr, gab mir den Mut, meinem Chef vorzustellen, ob ich bei meiner umfangreichen Tätigkeit nicht das gleiche Gehalt bekommen könne, das mein Vorgänger bezogen hatte. Auch er hielt meinen Anspruch auf Gleichstellung des Gehaltes für berechtigt und stellte selbst den Antrag bei der Kommission. Diese genehmigte den Antrag und bewilligte das gleiche Gehalt, sogar mit Zurückdatierung bis zum Anfang meiner Anstellung. Ich bekam somit von da ab 40 Taler Gehalt und für 3 Monate je 10 Taler, also 30 Taler, nachbezahlt. Das war ein Erfolg, wie ich ihn nicht erwarten konnte, über den ich sofort überglücklich nach Hause berichtete.
Ich fühlte mich mit einem Male wie ein Krösus und konnte die Schulden, die ich in meinen Hungermonaten notgedrungen machen mußte, abzahlen. Von nun ab konnte ich mir auch einen besseren Mittagstisch erlauben, ich aß in [161] Schröders Hotel für 7 ½ Groschen täglich im Abonnement. Auch abends, wenn ich frei war, konnte ich hin und wieder ein Restaurant, Konzert oder das Königliche Theater besuchen, das ich bisher kaum kennen gelernt hatte.
[7.7 »Lieder-Tafel Union« und »Quartett-Verein Kongreß«]
Ich kam auf diese Weise öfters mit jungen Leuten zusammen, deren Bekanntschaft ich teils schon auf dem Polytechnikum gemacht hatte, das ich von nun ab mehrmals in der Woche, allerdings nur abends, besuchen konnte. Zu diesen jungen Leuten zählte auch der einzige Sohn eines Mitinhabers der Buchdruckereifirma »Gebrüder Jänecke«, deren Wohnung und Geschäftslokal an der Osterstraße in der Nähe des Brauhauses sich befand. Wir befreundeten uns bald näher, es war wieder die Musik, die uns zusammenführte; Freund Jänecke besuchte mich zuweilen, und ich wurde von ihm geladen zum gemeinschaftlichen Musizieren. So entstand zwischen uns ein Freundschaftsbund, der uns fürs Leben als treue Freunde zusammenhielt, der noch heute, nachdem Louis Jänecke als Geheimer Kommerzienrat Senior-Chef der bedeutenden Firma Gebrüder Jänecke geworden ist, unverändert fortbesteht. Mit einer schönen Baritonstimme begabt, war er ein fleißiger Liedersänger, dem ich manches Lied begleiten mußte. Als solcher war er auch Mitglied der »Liedertafel Union«; durch ihn lernte ich eine Anzahl Liedertäfeler kennen, die mir zuredeten, in die Union als Mitglied einzutreten. Dem Zureden folgend, ließ ich mich in die Union aufnehmen und wurde in den zweiten Baß einrangiert.
Durch den Eintritt in diese angesehenste Liedertafel Hannovers erweiterte sich meine Bekanntschaft bald; es bildete sich unter uns jüngeren Mitgliedern der Union eine freundschaftliche Vereinigung, die bis auf den heutigen Tag im »Quartett-Verein Kongreß«, dessen Ehrenmitglied ich seit langen Jahren bin, fortbesteht; auf diesen werde ich später noch zurückkommen.
[7.8 Fortgang der Arbeiten, neue Freundschaften]
Den Bauarbeiten am Neubau des Brauergildehauses mußte ich von jetzt ab meine volle Kraft widmen. Mein Vorgesetzter ließ mich zu meiner großen Genugtuung sein Projekt [162] in allen seinen Teilen selbständig durcharbeiten und gewährte mir in meinen Anordnungen volle Freiheit. Um bei dem flotten Fortschritt des Baues mit den vielen zeichnerischen Arbeiten gleichen Schritt zu halten, mußte ich oft bis in die Nacht hinein am Zeichenbrett sitzen und meist die Sonntage zu Hilfe nehmen. Die Anerkennung meiner Vorgesetzten machte mir Freude und spornte mich immer mehr an. Die angestrengte Tätigkeit aber machte sich auf der anderen Seite recht fühlbar; mein körperliches Befinden ließ zu wünschen übrig, ich empfand oft eine nervöse Abspannung. Um diese zu überwinden, machte ich jeden Morgen früh vor 7 Uhr einen Spaziergang ins Holz – die Eilenriede – und trank meinen Morgenkaffee auf der »List«, einer städtischen Waldwirtschaft. Außer mir beteiligten sich an diesen Morgenpromenaden meine Freunde, Louis Jänecke und der Bauführer eines benachbarten Neubaues, Ludwig Möckel, jetzt Geh. Oberbaurat in Doberan, sowie einige Sangesfreunde aus der Union und dem Männergesangverein. Nach genossenem Morgentrunk zogen wir dann, gemeinschaftlich Quartett singend, in die Stadt zurück. Wir jungen Gäste schlossen uns einer Anzahl älterer Herren an, die seit langen Jahren ihren Morgenkaffee auf der »List« tranken; darunter war der Senior Boedicker, erster Pfarrer an der Marktkirche. Boedicker war durch seinen frischen Humor wie sein biedertreues Wesen ein besonders anregendes und belebendes Element in diesem Kreise, er legte diesem den Namen »Norddeutscher Morgenpromenaden-Verein« bei.
»Use olle Senior«, wie er von den Hannoveranern genannt wurde, war wohl die populärste Persönlichkeit in der ganzen Stadt. Schlicht und einfach in seiner äußeren Erscheinung, oft mit hochschäftigen Stiefeln, einen derben Hakenstock in der Hand, wanderte er von Haus zu Haus, um Gaben für Notleidende zu sammeln oder zu spenden. Als wahrer Seelsorger ein Mann der werktätigen Liebe, nahm er sich der Mühseligen und Beladenen an.
B. hatte, um seine mehr und mehr gelähmte Frau die frische Luft genießen zu lassen, sich einen kleinen halbverdeckten [163] Chaisenwagen und ein Pferd angeschafft; er kutschierte meist selbst, seine Fahrten dehnten sich oft auf benachbarte Dörfer und Gutshöfe aus, wo er gelegentlich auch um Gaben anklopfte. Den Stallmist von seinem Pferde bekam jedes Jahr der Wirt auf der »List« gegen einen bestimmten Preis, für den alljährlich ein einfaches Essen, »das Pferdemist-Essen«, – so nannte es Boedicker –, abgehalten wurde, zu dem die Mitglieder des »Morgenpromenadenvereins« geladen wurden. Unter den Schnurren, die Vater Boedicker in vertrautem Kreis zum besten gab, war auch die Erzählung eines Vorgangs, der ihm viel Spaß gemacht hat:
Eines Sommermorgens von der List heimkehrend, traf er am Eisenbahnübergange – da, wo später das Tivoli gebaut wurde und fast bis zum »Neuen Hause« an der Eilenriede noch kein Wohnhaus stand, – einige Kinder, welche mit feuchtem Lehm – in Cassel »Leimen« genannt – nach ihrer Art Bauwerke usw. aufführten. Wie Vater B. spielende Kinder selten unangesprochen ließ, so fragt er freundlich: »Na, Kinder, was baut Ihr denn da?« »Wie buet de Marktkerke!« »Macht Ihr denn den Pastor Boedicker auch hinein?« »Ne, wie hewwet keine Schiete mehr!« So bezeichneten die naturwüchsigen Jungen einfach ihr Baumaterial. Ihn selbst kannten sie nicht, und wer ihn nicht kannte, vermutete keinen Geistlichen in diesem bescheiden einhergehenden, schlichten Mann. Wie die Hannoveraner aber ihren »Vater Boedicker« liebten und hoch ehrten, das beweist das herrliche Standbild, das ihm seine dankbare Vaterstadt vor der Marktkirche gesetzt hat. – – –
[7.9 Zusatzaufträge, finanzielle Entspannung]
Mit meinem Bau kam ich flott vorwärts; nach der Ausarbeitung der nötigen Details war ich meist zwischen den Arbeitern auf dem Gerüst und bereicherte durch eigenen Augenschein meine praktischen Kenntnisse.
Gegen den Herbst des Jahres, bei früher eintretender Dunkelheit, ließen mir die Arbeiten am Brauergildehaus genügend freie Zeit, um mich nebenher noch anderweit zu beschäftigen, und ich versuchte mir noch anderweit Aufträge zu verschaffen. [164] Von meinem Vorgesetzten, der sich davon überzeugt hatte, daß ich mit meinen Arbeiten für den Bau auf dem Bureau stets voraus war, wurde ich nicht gehindert, im Gegenteil, er empfahl mich seinem Kollegen, Stadtbaumeister Schlüter in Hildesheim, zur Ausarbeitung eines Projektes zu einer Brücke über die »Innerste«, mit dem ich mehrere Monate zu tun hatte. Bald darauf erhielt ich noch einen zweiten Auftrag von einem Tischlermeister Jacob, dem ich das Projekt zu einem Wohnhaus an der Hildesheimer Straße machte. Mit diesen Arbeiten konnte ich meine langen Herbst- und Winterabende ausfüllen, und verdiente mir dadurch neben meinem Gehalt noch etwa 250 Taler, so daß ich im ersten Jahre meiner technischen Laufbahn über 700 Taler bare Einnahme hatte, neben freier Wohnnung, Brand, Licht und Bier!
Ich war dadurch, obgleich an Jahren der jüngste unter den mit mir befreundeten Kollegen, finanziell am besten gestellt. Nun brauchte ich mir in gesellschaftlicher Beziehung keine Entbehrungen mehr aufzuerlegen, ich durfte mir ohne Skrupel eine Ausgabe erlauben, an die ich vorher nie zu denken wagte. – Meine Eltern und Geschwister konnte ich zu Weihnachten reich beschenken. Es war mir ein besonders glückliches und erhebendes Gefühl, daß ich jetzt imstande war, meinen lieben Eltern für die mir gebrachten Opfer schon so bald Beweise meiner Erkenntlichkeit liefern zu können. Mein Vater bekam einen Schlafrock, meine Mutter und älteren Schwestern bekamen Stoffe zu Kleidern, meine Brüder praktische Geschenke, die kleinen Geschwister, denen sich im Laufe des Sommers noch ein Schwesterchen, unsere Antoinette, zugesellt hatte, erhielter Spielsachen usw. Es war eine große Kiste voll, die ich zum Weihnachtsfeste auskramte, ein Geschäft, das mir unendliche Freude machte.
Ich konnte nun in vollen Zügen mich dem Genusse der Wintervergnügungen hingeben, die sich mir in den befreundeten Familien und in der »Union« vielfach boten – – – welcher Unterschied gegen den Winter vorher, gegen die Entbehrungen, die ich mir da auferlegen mußte!
[7.10 Neue Bekanntschaften, Fertigstellung der Brauergilde]
[165] Von meinem Chef wurde ich auch verschiedentlich eingeladen; ich hatte dadurch Gelegenheit, eine Anzahl angesehener Berufsgenossen kennen zu lernen, so daß sich meine Bekanntschaft auch in den Fachkreisen immer mehr erweiterte. – – –
Inzwischen machte mein Neubau immer mehr Fortschritte; es gewährte mir eine besondere Genugtuung, daß bei den umfangreichen Versetzarbeiten der teils sehr großen Sandstein-Architekturteile nicht der geringste Unfall zu verzeichnen war. Allerdings war dies weniger mein Verdienst, wie das meines vorzüglichen Poliers Eckert, eines erfahrenen, umsichtigen Mannes, mit dem es ein Vergnügen war, zusammen zu arbeiten.
Gegen Ende des Jahres bat ich meinen Chef, der inzwischen vom König von Hannover zum Baurat ernannt worden war, daß er mir ein Attest ausstellen möge über das andauernde Tragen einer Brille, weil ich dies der Militärbehörde zum Nachweis meiner Kurzsichtigkeit einreichen wollte, um bei der zu Anfang des folgenden Jahres stattfindenden Ziehung vom Militärdienst frei zu kommen. Droste war sehr überrascht, hierdurch zu erfahren, daß ich erst 20 Jahre alt sei, er hatte mich für viel älter, etwa 25 Jahre alt, gehalten. Ich war nie nach meinem Alter gefragt worden und war klug genug, dasselbe nicht zu verraten; durch meinen frühzeitigen Bartwuchs – ich trug ein Schnurr- und Kinnbärtchen – sah ich tatsächlich älter aus, wie ich wirklich war. Droste machte von der Entdeckung, daß ich noch so jung war, keinen für mich nachteiligen Gebrauch, denn er hätte sich dann selbst vorwerfen lassen müssen, daß es gewagt sei, einem noch so grünen Bürschchen, wie ich es den Jahren nach war, einen so verantwortungsvollen Posten anzuvertrauen. Aber die freudige Hingabe an die Aufgabe, die mir gestellt war, ersetzte das, was mir am Alter fehlte, und so gelang es mir, den mir anvertrauten Neubau rechtzeitig zur vollen Zufriedenheit meines Vorgesetzten und des Brauergilde-Kollegiums abzuliefern, so daß die Übersiedelung des englischen Klubs zum festgesetzten Termin stattfinden konnte.
Auf Veranlassung des Vorsteherkollegiums wurde an der Außenfassade des neuen Gebäudes in einer Blende zwischen [166] gekuppelten Fenstern der dritten Etage eine aus Sandstein gearbeitete Gedenkplatte mit dem Wappen der Brauergilde und dem eingehauenen Text eingemauert:
Erbaut von der Brauergilde
im Jahre 1861–62
durch Stadtbaumeister Droste
Bauführer Schmidtmann.
Durch die Einfügung meines Namens in die Tafel sollte meine Mithilfe am Bau anerkennend zum Ausdruck gebracht werden, deren mein Chef bei der Übergabe des Baues in einer mich ehrenden Weise gedachte, wofür ich ihm bewegten Herzens dankte.
[7.11 Friedhof-Bauführung, Wohnung bei Familie Senne]
Die Anerkennung, die ich auf diese Weise erfuhr, sicherte meine Stelle am Stadtbauamte; mir wurde gleich darauf die Bauführung über die umfangreichen Arbeiten des neuen städtischen Friedhofs am Engesohder Berg übertragen, und ich begann sofort mit den Vorarbeiten zu den mannigfachen Bauwerken auf dem Stadtbauamte.
Meine Wohnung im Brauhause mußte ich nun aufgeben und zog wieder zu meinem Schneidermeister Senne, bei dem inzwischen auf meine Empfehlung mein Bruder August, der von Wien nach Hannover zugereist war und im Atelier des Glasmalers Horn Beschäftigung gefunden hatte, sowie mein Vetter Louis Hochapfel, der bei Architekt Oppler als Bauführer angestellt war, Quartier bezogen hatten.
Wir drei Verwandten teilten uns mit der Familie Senne in eine große Stube, neben der in einem Alkoven die gemeinschaftliche Schlafstube für meinen Bruder und Vetter Louis sich befand; mein Schlafzimmer lag getrennt hiervon hinten an einem Korridor. Letzteres hatte ich mir auf meine Kosten neu herrichten lassen durch Putzen der Wände, Erneuerung des Anstrichs und der Tapeten, Ausspohnen des Fußbodens usw., um die darin hausenden Quälgeister, kleine, braune, sechsbeinig Kriechtiere, die sich an meinem süßen Blute allnächtlich zu sättigen suchten und mir den Schlaf raubten, in Schranken zu [167] halten und vom Erdboden resp. aus meinem Schlafzimmer zu entfernen, was mir auch glücklich gelang.
Der Verkehr zwischen uns drei Casselanern und der Familie Senne, die aus Mann, Frau und einem hoffnungsvollen, aber spindeldürren Töchterchen bestand, war ein sehr ungezwungener und so urgemütlich, wie man ihn sich kaum denken kann. Weder wir, noch unsere Hauskamisole waren dazu angetan, uns Zwang aufzuerlegen, wenn unsere Gemütlichkeit dadurch gestört worden wäre. Neben unserer Stube, der »guten Stube«, befand sich das Wohnzimmer mit dem Zuschneidetisch, an dem Meister Senne arbeitete, das auch von uns in treuer Gemeinschaft mitbenutzt wurde. Mutter Senne, eine dicke, behäbige Hannoveranerin mit ewig lächelndem Gesicht, war das Urbild eines gemütlichen Phlegmas. Vater Senne, ein trockener, aber dabei drolliger Kautz, hatte auf seinem Zuschneidetisch ein Eau de Cologne-Fläschchen mit »blauem Zwirn«, so nannte er den »reinen Korn«, von dem er zuweilen einen »lütten Sluck« zu sich nahm; vorher rieb er allemal mit dem Kork an dem Fläschchen, daß es einen pfeifenden Ton abgab.
Bei dem drückend heißen Sommer war es sowohl den Eltern Senne, wie uns Hausgenossen zuweilen ein Bedürfnis, ein Mittagsschläfchen zu halten; dann wurde stets Rat geschafft, daß jeder einen Platz fand, wo er sein Haupt niederlegen konnte. Mutter Senne bekam das Sofa in der Wohnstube, das Sofa in unserer Stube benutzte einer von uns dreien. Meister Senne und die beiden übrigbleibenden legten sich auf den Zuschneidetisch oder die Holzpritsche; mehrere Rollen Zeug oder Futterstoff mußten das Kopfkissen ersetzen; so schliefen wir Männer in Hemdsärmeln, Mutter Senne in einer losen Kattunjacke den Schlaf der Gerechten.
Bei der Verträglichkeit unserer gutmütigen Wirtsleute durften wir uns allerlei Scherze erlauben; kamen wir z.B. nachts spät in animierter Stimmung nach Hause, dann brachten wir vor der Kammertür den beiden Alten ein Ständchen und sangen: »Am Brunnen vor dem Tore«, oder »Es hat ein [168] Schneider ’ne Laus«, und andere schöne Lieder. Wenn es dann zu toll wurde, kam Meister Senne in der Unterhose, mit einer weißen Zipfelmütze auf dem Kopfe, herausgestürzt, mit einer Elle bewaffnet, und trieb uns nach neckischem Kampfe in unsere Schlafzimmer.
[7.12 Das Zirkusbären-Schrecknis]
Die Erinnerung an unsern biederen Kleiderkünstler ruft einen erschütternden, grausigen Vorgang mir ins Gedächtnis, der sich vor unsern Augen abspielte und dadurch noch besonders erwähnenswert erscheint, weil eine gewisse Vorahnung voraus ging, die sich tatsächlich erfüllte. Die Renz’sche Menagerie – damals neben der Kreutzberg’schen die größte in Deutschland – war nämlich in Hannover eingetroffen und gab in einer Riesenbude auf dem Klagesmarkt ihre Schaustellungen. Abends war die Hauptvorstellung, Fütterung sämtlicher Raubtiere, vorher Auftreten eines berühmten Tierbändigers, dessen Dressur der wilden Bestien viel von sich reden machte und der Menagerie einen starken Besuch zuführte. Auch ich entschloß mich, eine solche interessante Abendvorstellung mit anzusehen, aber nur in Gemeinschaft mit Meister Senne, der noch nie eine Menagerie besucht hatte; er vermochte es nicht, sich in die Nähe der Bestien zu wagen aus Angst, es könne ein Tier ausbrechen und ihn oder einen anderen Menschen zerreißen. Diese Schrulle, mit der er sich schon oft bei seiner Frau und Tochter lächerlich gemacht hatte, wollte ich ihm austreiben und bestand darauf, unterstützt von seiner Frau, daß er mit mir in die Menagerie ging; ich warf ihm, als er noch immer sich weigerte, Feigheit vor. Das aber mochte unsere bange Schneiderseele doch nicht auf sich sitzen lassen, er nahm allen Mut zusammen und schloß sich mir zum Besuche der Tierbude an. Beim Fortgehen konnte er nicht unterlassen, seiner Frau zuzurufen: »Sollst mal sehen, es passiert was – ick hewwe so ne Ahnung.« »Wenn se Dich man nur nich uffreeten, Du ohle Bangeböchse,« gab ihm seine drollige Alte lachend zur Antwort. Unterwegs wiederholte er seine Befürchtung, ihm ahne, daß etwas passiere, sodaß es mir endlich doch zu viel wurde und ich ihn bat, solch albernes Geschwätz [169] zu unterlassen. Auf dem Klagesmarkte angelangt, gingen wir an der Längsseite der Bude herunter und besahen uns die großen Reklamegemälde mit Szenen aus dem Tierleben, darunter war eine Löwenjagd, die Meister Senne auffiel, weil einer der Beduinen von einem Löwen vom Pferde heruntergerissen und zerfleischt wurde. Beim Anblick dieses Bildes wurde S. sofort wieder nervös und war kaum zu bewegen, die Bude zu betreten, ich mußte erst grob werden. Vor der schmalen Eingangsseite hatte sich viel Publikum angesammelt, welches sich auf billige Weise amüsierte über die weißen und bunten Kakadus und Papageien, die unter fortwährendem Geschrei in schrillen, kichernden oder kreischenden Tönen ihre possierlichen Kletterübungen auf den an Ketten hängenden, hin- und herschaukelnden Bügeln machten; dazu kam das dröhnende Brüllen der Löwen und Trompeten der Elefanten, das aus dem Innern der Bude herausschallte und schließlich das Vorzeigen einer mächtigen Boa-Constrictor, die ein herkulisch gebauter Neger sich über beide Schultern legte und den züngelnden Kopf der Schlange von hinten fassend, nach allen Seiten zeigte. Daneben stand der Ausrufer, der ein großes Tamtam mit dem Klöpfer verarbeitete, daß einem Hören und Sehen verging, und dann mit seiner abgeschrieenen Stimme das Publikum mit dem Rufe: »Immerran, immerran, treten Sie näher meine Herrschaften, jetzt beginnt die große Vorstellung usw.« – zum Eintritt aufforderte und die lästig herandrängenden Zaungäste mit den Worten: »Platz da, Platz da« zurückwies und den Besuchern den Weg zur Kasse freizumachen. Der Eingang zu den Rängen ging nach beiden Seiten; in der Mitte zwischen den Eingängen thronte vor einer mit bunten Stoffen und glänzenden Borden reich trapierten Wand auf einem Sessel – wie eine indische Pagode – als Inhaberin der Menagerie, die Witwe Renz, eine etwas voluminöse, aber immer noch hübsche Dame, die, mit strenger Miene Ordnung haltend, alles unter Augen behielt, und, wo es Not tat, in kurzen, befehlenden Worten mit ihrem Personal, oder in gemessenen höflichen Formen mit dem eintretenden Publikum sprach.
[170] Daß ihr Vermögen nicht alle in wilden Tieren angelegt war, zeigte sie durch ihre kostbare Toilette und den reichen Schmuck an Brillanten, der auf ihrem üppigen Busen, an den Armen, Fingern und Ohren funkelte, und in seltsamen Kontrast zu der im übrigen zum Teil trödelhaft erscheinenden Einrichtung ihres Wanderunternehmens stand. Die ganze Szenerie außerhalb wurde mit flackernden Gasolinlampen beleuchtet und ebensolche Lampen waren auch im Innern, etwa einen Meter entfernt, vor den Käfigen angebracht, um diesen volles Licht zuzuführen.
Ich nahm an der Kasse zwei Billetts für den ersten Platz gegen den Willen meines ängstlichen Begleiters, der gern möglichst »weit vom Schuß« bleiben wollte; es half ihm aber nichts, ich faßte ihn unter den Arm und zog ihn hinter mir her. In der langen Reihe der dicht aneinanderstehenden Wagenkäfige befanden sich voran die harmlosen Nagetiere, dann kamen die Affen, in der Mitte die großen Raubtiere und dann Pflanzenfresser, Antilopen, Elefanten nebst einigen Dickhäutern und schließlich Lamas, Zebras, Straußen und andere Viehcher, durchweg alles Prachtexemplare. Zwischen den Käfigen der Löwen und Tiger war ein geräumiger Käfig frei für die Vorführungen der dressierten Bestien. Die Tiere waren ungeduldig wegen der bevorstehenden Fütterung und besonders die großen Katzen sprangen über und umeinander in wilden Sätzen von einer Wand der Käfige zur anderen, zwischendurch heiser brüllend oder fauchend, dabei mit gierig lauerndem Blick nach der Seite lugend, von wo aus das Fleisch oder anderes Futter vom Tierpfleger angefahren wurde.
Für mich war der Anblick der erregten Tiere ein fesselnder und ich hatte meine Freude an den temperamentvollen Bewegungen derselben, für meinen Begleiter aber war es kein Genuß und seine Aufregung steigerte sich, wie der Tierbändiger, ein stattlich schöner Mann, enganschließend gekleidet, nur bewaffnet mit einer Reitgerte, in dem freien Käfig auftrat und mit seinen gefährlichen Zöglingen, die grollend aus den [171] anstoßenden Käfigen gekrochen kamen, in der bekannten Weise experimentierte und zum Schluß seinen Kopf in den offenen Rachen eines Löwen hielt – alles dies ging gut vorüber, sodaß das beifallspendende Publikum, besonders aber der Angstpeter – Meister Senne – aufatmete.
Nach dieser Vorführung wurden die Zuschauer gebeten, sich vor den großen Bärenkäfig zu begeben. In diesem Käfig standen zwei gewaltige Bären hochaufgerichtet an den Gitterstäben, keuchend vor Gier nach dem Futter. Durch einen Schieber war von dem Käfig ein Teil abgetrennt, in den der Tierbändiger eintrat und dem Publikum mitteilte, daß er heute zum ersten male mit den noch ungezähmten Tieren zusammen arbeite; darauf ließ er den trennenden Schieber herausziehen. Die Bären waren offenbar stutzig über den ungewohnten Besuch in ihrem Käfig und drängten sich nach der Seite. Der Bändiger aber tat ganz vertraulich mit ihnen – er stellte sie als »Müller und Schulze« vor – und warf ihnen kleine Fleischstücken in den offenen Rachen, die sie hastig verschlangen; er wagte es sogar, Fleischstücke, die nicht aufgefangen wurden, unter ihnen aufzunehmen und ihnen von neuem zuzuwerfen. Damit hätte er es sich genügen lassen sollen, das glaubte das ängstlich zuschauende Publikum und auch die Menageriewärter, die den Schieber wieder einschieben wollten. Der Tierbändiger aber wurde unwillig und befahl, weil er noch nicht fertig sei, den Schieber wieder fortzunehmen, was die Leute, besorgt mit dem Kopfe schüttelnd, tun mußten; ich stand dicht dabei und hörte den Warnenden Zuruf, der aber von dem tollkühnen Mann nicht beachte wurde. Die Bären wurden durch das Hantieren vor dem Käfig aufgeregt und fingen an, zornig zu brummen, was den Bändiger veranlaßte, den ihm zunächst stehenden Bären in den Pelz zu fassen mit den Worten: »Na, Schulze, du willst wohl Streit anfangen.« Im selben Augenblick wendet sich das gewaltige Tier, den Bändiger mit seinen mächtigen Pranken von hinten umklammernd, faßt es dessen Schulter mit dem Rachen und reißt mit einer Tatze das halbe Gesicht, mit der anderen [172] die fleischige Brust des starken Mannes auf, so daß das Blut sofort an ihm herunterströmte. Mit einem Schrei des Entsetzens stob die gedrängte Menge auseinander, ich kletterte über die Barriere in den zweiten Rang und sprang dabei auf einen vor mir beim Überklettern zu Boden gestürzten Herrn; vor Schreck gebannt blieb ich hier stehen und sah die grauenvolle Szene mit an. Der Tierbändiger behielt die Geistesgegenwart und versuchte mit allen Kräften, sich aus der Umklammerung des wütenden Tieres zu befreien, es gelang ihm, seine Schulter frei zu machen und seinen Arm mit dem gekrümmten Ellenbogen tief in den Rachen des Bären zu stoßen. Von außen versuchte man ihn von dem Ungetüm zu befreien, die Wärter schlugen und stießen mit Eisenstangen und der Fleischgabel auf das Tier ein und mehrere Offiziere stachen mit ihren Degen danach, trafen aber zugleich den Bändiger, der laut aufschrie; man rief nach Schußwaffen, um die Bestie zu erschießen, das Personal wußte nicht, was es anfangen sollte und verlor durch das Zurufen des aufs höchste erregten Publikums ganz den Kopf; nur der im Käfig mit dem Bären um sein Leben ringende Mann verlor in seiner schrecklichen Lage trotz seines Blutverlustes die Besonnenheit nicht und rief, man solle nicht schießen, der Schieber solle eingeschoben werden – er wollte offenbar sich loszumachen suchen und in dem abgetrennten Raum in Sicherheit bringen. Die Wärter aber in ihrer Aufregung stießen beim Einbringen des breiten Schiebers mit diesem gegen die Gasolinlampe, daß sie herunterfiel und zum Glück erlöschte, ohne zu explodieren; aber die dadurch verursachte Dunkelheit vor dem Käfig erhöhte das schauerliche der Situation und steigerte die Aufregung der Zuschauer, dazu kam das Gebrüll und Geschrei der wild erregten Tiere – es war fürchterlich! Als der Schieber eingeschoben war, mußten erst andere Lampen herbeigeholt werden, da sah man zum Entsetzen, daß der Bändiger mitsamt dem Bären, der ihn noch immer umklammert hielt, in den abgetrennten Teil geraten war. Den Unglücklichen verließen jetzt die Kräfte, er war durch den anhaltenden Blutverlust [173] völlig erschöpft und befahl mit schwacher gurgelnder Stimme, den Schieber wieder herauszuziehen; er vermochte sich nun nicht mehr aufrecht zu halten und brach unter dem gewaltigen Tier zusammen. Es war ein herzzerreißender Anblick, den vorher so stolzen Mann jetzt zerfleischt in seinem Blute schwimmend am Boden liegen zu sehen, über ihm die gierigen Bestien, die mit den blutigen Tatzen auf ihrem Opfer standen. Mit seinem bis zur Unkenntlichkeit zerrissenen Gesicht lag der Amste vorn am Gitter an einer Stelle, die sich nach oben verschiebbar öffnen ließ. Unter fortwährendem Stoßen in den Rachen und die Tatzen und Schlagen nach den blutgierigen Tieren, die ihre Beute nicht fahren lassen wollten, schoben die Wärter das Gitter hoch und zogen den nun besinnungslosen, zum Tode verwundeten blutüberströmten Menschen aus dem Käfig heraus und trugen ihn sofort durch die tiefbewegte Menge hindurch nach einem bewohnbaren Wagen der Menagerie. Die herbeigeholten Ärzte konnten den Ärmsten nicht mehr retten, er erlag bald darauf seinen furchtbaren Wunden. Der tragische Vorgang, der in der Umgebung der Menagerie sofort bekannt wurde, hatte eine Menge Volk herangezogen, das sich mit Erbitterung gegen die Besitzerin wandte, die durch ihre Kälte und Teilnahmlosigkeit eine empörende Gefühlsroheit zeigte. Das Schicksal des seinem Beruf zum Opfer gefallenen Mannes schien ihr kaum nahe zu gehen, im Gegenteil, sie schimpfte auf ihn, er hätte von den Tieren fortbleiben sollen, es sei seine eigene Schuld, wenn er jetzt dranglauben müsse, auch ich drückte ihr meinen Abscheu über ihr widriges Benehmen aus. Meister Senne, den ich vor der Bude wieder traf, war kreidebleich, vor innerer Erregung konnte er kaum sprechen. »Fürchterlich – schrecklich – ich habe doch Recht gehabt – jetzt wird meine Frau nicht mehr lachen,« stieß er abgebrochen immer heraus – er hatte aber nur wenig selbst mit angesehen, weil er sofort aus der Bude gerannt war. Ich erzählte ihm beim zuhausegehen nähers, wie es meine Leser soeben erfahren haben, denen ich nun wieder über erfreulichere Erlebnisse in Hannover weiter berichten will.
[7.13 Das Hannoversche Schützenfest, König Georg V.]
[174] Das hannoversche Schützenfest, plattdeutsch »Friescheiten« oder einfach »Schießen« genannt, war von jeher und ist bis in die heutige Zeit das alljährliche große Volksfest, an dem sich alle Kreise der Stadt, ob hoch oder niedrig, beteiligen. Das Schießen wird stets eingeleitet durch einen großen Festzug, der sich vor dem alten Rathaus am Marktplatz sowie in den angrenzenden Straßen ordnet und von hier mit Musikchören, Fahnen und Bannern zum Festplatz am Schützenhause marschiert. Jeder neu aufgenommene hannoversche Bürger war oder ist heute noch verpflichtet, sich, mit einer Büchse bewaffnet, wenigstens einmal am Ausmarsch des Festzuges zu beteiligen. Zu den Korporationen, die sich am Feste beteiligten, gehörte auch der »uniformierte Schützenchor«, in dem auch Meister Senne eine Charge bekleidete, auf die er nicht wenig stolz war.
Vor dem Schützenhaus ist ein großer runder Tanzplatz, »Rundteil« (von Rondel) genannt, auf dem während der Festtage von 3 Uhr nachmittags ab in kunterbuntem Gemisch alles durcheinander tanzt. Rings um das Rundteil ist eine Zeltstadt aufgeschlagen von teilweise sehr großen Zelten, die den verschiedensten Vereinen angehören. Hinter dem Schützenhause befinden sich die Schießstände mit den Scheiben, auf denen die Büchse vom Morgen bis zum Abend knallt.
Im großen Saale des Schützenhauses wird während der Festtage ein offizielles Festbankett abgehalten, das den Höhepunkt des Festes darstellt. Beim Ausbringen des Hochs auf den Landesherrn, damals König Georg V., wurde vom Fenster aus durch den Schützendeputierten mit der Serviette gewinkt, dann krachten die Böller los, die von hannoverschen Stadtsoldaten, d.h. Magistratsdienern, abgefeuert wurden. Den Glanzpunkt aber bildete der Umzug der königlichen Familie, an der Spitze der blinde König mit seiner hohen Gemahlin, der Königin Marie, dem Kronprinzen und den beiden Prinzessinnen. Die allerhöchsten Herrschaften wurden vom Stadtdirektor Rasch begrüßt und machten dann einen Rundgang durch die großen Vereinszelte; sie wurden von den Vorständen feierlich [175] angeredet unter Überreichung eines Ehrentrunks aus kostbaren Pokalen. In den vornehmsten Zelten beteiligten sich die prinzlichen Kinder am Tanze, zu welchem die Tänzer aus den ersten Bürgerfamilien engagiert wurden. – Der Umzug der königlichen Familie löste allemal einen Jubel der meist schon sehr animierten Menge aus, der Zeugnis ablegte von der Volkstümlichkeit des Königs. »Schorse Rex«, wie seine Untertanen ihn nannten, war eine hohe, imposante, ritterliche Erscheinung, ein stattlicher, schöner Mann. An der Seite seines Adjutanten machte er öfters Spaziergänge durch den Georgengarten oder auch in der Stadt über den Georgen- und Friedrichswall. Trotz seiner absoluten Blindheit ging er mit hoch aufgerichtetem Haupte, von seinem Adjutanten mit einem kaum sichtbaren Kettchen an der Hand geleitet, sicheren Schrittes einher, jeden Gruß erwidernd, der ihm durch ein unmerkliches Zeichen vom Adjutanten übermittelt wurde. Der König gab sich den Anschein, als ob er sehen könne, und man durfte ihn nicht merken lassen, daß man ihn für blind hielt. So z.B. besuchte er die Baustelle des Welfenschlosses, als ich dort noch praktisch arbeitete; da habe ich selbst beobachtet, wie er sich unter Führung des Hofbaumeisters Tramm den Fortschritt des Baues zeigen ließ. Beim Umgang um das riesige Gebäude folgte er mit dem Blicke, wenn auf irgend eine Stelle hingewiesen wurde, als wenn er sehen könne, und schien alles durch eigenen Augenschein einer genauen Prüfung zu unterziehen, tatsächlich aber sah er nicht einen Schimmer. Kirchweger erzählte mir, daß er bei einem Hofball vom König angeredet worden sei, der sich nach dem Maschinenwesen in den königlichen Eisenbahnwerkstätten erkundigte; er stellte hierbei seinen baldigen Besuch in Aussicht, um sich den Betrieb und die Einrichtung in diesen Werkstätten zu »besehen«; er kam aber doch nicht.
Man erzählte sich derzeit einen Vorfall, der in Herrenhausen passiert war, welcher die dem König eigentümliche Schwäche besonders kennzeichnet. Es war dem König mitgeteilt, daß ein älteres, sehr wertvolles Bild im Schlosse schadhaft [176] sei. Der König befahl, daß dies Bild in einem Zimmer aufgestellt werde, und ließ den Hofmaler Bergmann nach Herrenhausen kommen, um ihm die Instandsetzung des Bildes zu übertragen. Als sich der Maler bei Seiner Majestät meldete, ging der König, der sich in seinem Schlosse ohne Führung sicher zurechtfinden konnte, mit Bergmann in den Saal, in dem das Bild aufgestellt werden sollte. Der König hatte sich über die Mängel am Bilde genau unterrichten lassen und deutete mit der Hand nach der Stelle, wo es nach seinem Befehl aufgestellt sein sollte; der Befehl war aber noch nicht ausgeführt, es stand dort wohl eine Staffelei, aber das Bild darauf fehlte noch. Als der König auf alle Mängel aufmerksam gemacht hat, vergißt sich der Hofmaler und erwidert dem König auf dessen Anfrage in seiner derben Sprechweise: »Majestät befehlen, aber ich sehe gar kein Bild, da steht nur eine leere Staffelei,« worauf der König sich sofort von ihm trennte und ihn stehen ließ – er war Hofmaler gewesen. – –
Wenn der König zu Pferde saß, blieb er ebenfalls durch eine feine Kette stets in Fühlung mit dem dicht an seiner Seite reitenden Adjutanten.
[7.14 Hofleben in Hannover]
Das Hofleben in Hannover machte sich für gewöhnlich äußerlich nicht so auffallend geltend, wie in Cassel. Nur bei hohen Festlichkeiten oder beim Besuch fürstlicher Personen zeigte sich die Prachtentfaltung des hannoverschen Hofes. Bei Gala-Auffahrten waren die Prunk-Equipagen mit den berühmten »Weißgeborenen«, herrlichen, durchweg schneeweißen Pferden mit rötlichen Augen – Albinos in ihrer Gattung, die im königlichen Gestüt zu Herrenhausen gezüchtet wurden, – bespannt, wieder andere Gala-Wagen mit Isabellen, die aus unserem hessischen Gestüt in Beberbeck stammten. Es gewährt einen prachtvollen Anblick, diese stolzen Tiere mit ihren dichten langen Mähnen und Schweifen, die mit dunkeln seidenen Bändern und Schleifen durchflochten waren, geritten von schmucken, reich gekleideten Jockeis, sechs- und achtspännig voreinander gespannt zu sehen. Die Hoflivree war zinnoberrot, reich mit [177] Gold verbrämt, die Kutscher trugen schneeweiße Allonge-Perücken mit Dreimaster auf dem Kopfe.
Der Hof residierte im Sommer in Herrenhausen, im Winter im Schloß am Friedrichswall, das später an die städtische Verwaltung abgetreten und von dieser bis auf die heutige Zeit als Rathaus benutzt wurde.
König Georg, persönlich leutselig, war beim Volke wohl beliebt; bei seiner absoluten Blindheit daran verhindert, die realen Verhältnisse mit eigenen Augen anzusehen, war er aber leider ganz in den Händen der Hof-Camarilla und seiner reaktionären Ratgeber, an deren Spitze der damalige leitende Staatsminister Borries stand. Eine besonders einflußreiche, aber unpolitische Persönlichkeit war der Hoffriseur des Königs, Lübrecht, ein aalglatter, gewandter Herr, der den König täglich zu behandeln und sich der besonderen Gunst des Monarchen zu erfreuen hatte. Lübrecht besaß die Eigenschaft, gut zu unterhalten, er wußte dem König zu erzählen, was es neues in seiner Residenz gab. Was mancher höher gestellte Kavalier in der Umgebung des Königs nicht zu erreichen vermochte, das brachte dieser Leibfriseur fertig, so erzählte man sich.
[7.15 Welfenstolz, Partikularismus, Orthodoxie]
Minister Borries unterstützte seinen Monarchen darin, daß dieser in deutschen Angelegenheiten eine streng partikularistische Haltung wahrte und immer Stellung gegen Preußen nahm, obgleich durch die Lage Hannovers, rings umschlossen von preußischem Gebiet, ein Anschluß an die einzige reindeutsche Großmacht jedem Staatsmann geradezu als notwendig erscheinen mußte. Aber König Georg war verblendet genug, der falschen Politik seines Ministers zu folgen, er gab ihm Beweise seines besonderen Vertrauens und erhob ihn damals zu aller Verwunderung sogar in den Grafenstand. Sein Welfenstolz ließ es nicht zu, von seiner Landeshoheit im Interesse des großen Ganzen nur das Geringste zu opfern. Obgleich erst der zweite selbständige König von Hannover, war er doch so durchdrungen vom Gefühl seiner souveränen Machtstellung im deutschen Staatenbunde, daß er, als die nationale Bewegung im deutschen [178] Volke unter Führung Rudolf von Bennigsens feste Gestalt annahm und dieser in die Opposition gegen die Regierung des Königs durch Borries gedrängt wurde, in einer Rede selbstbewußt äußerte, daß das Welfenhaus »bis ans Ende aller Dinge« herrschen werde! Diese Worte wurden seinerzeit nicht ohne Bedenken vom Publikum besprochen und scharf kritisiert.
Auch auf kirchlichem Gebiete stand der blinde König ganz unter dem Einfluß der orthodoxen Partei, die an der bigotten Königin eine mächtige Stütze hatte. Die Änderung des hannoverschen Landes-Katechismus im orthodoxen Sinne rief mit der größtenteils liberalen Geistlichkeit, auf deren Seite das Volk stand, einen Streit hervor, der in eine offene Revolution ausartete.
Es erfolgten Maßregelungen einzelner Pastöre, die in Wort und Schrift gegen die Einführung des neuen Katechismus ankämpften; darunter war Pastor Baurschmidt der unerschrockenste Kämpfer, der infolge seiner Unbotmäßigkeit gegen das Landes-Konsistorium vor dieses nach Hannover geladen wurde. Die Erregung unter der städtischen Bevölkerung kam allgemein zum Durchbruch, als Pastor B. in Hannover eintraf. B. wurde vom Bahnhof feierlich eingeholt und von einer zahllosen Menge nach seiner Wohnung geleitet; er wohnte beim Weinhändler Schulz an der Kalenbergerstraße, vor dessen Hause die Volksmenge dem Geistlichen stürmische Huldigungen ob seines standhaften Auftretens darbrachte.
Seine Vorladung vor das Konsistorium führte andern Tages zu einer gewaltigen Demonstration vor dem Konsistorialgebäude am Marktplatz. Die erregte Menge wollte das Gebäude stürmen; die Polizei hatte trotz ihres starken Aufgebots Mühe, Exzesse zu verhüten und schritt mehrfach zu Verhaftungen. Konsistorialrat Uhlhorn (später Abt von Loccum), als einer der Hauptmucker in Hannover damals besonders verhaßt, lief Gefahr, auf dem Wege zum Konsistorium gelyncht zu werden. Er rettete sich vor der Volkswut, indem er durch eine Droschke hindurch in ein Haus am Marktplatz retirierte und sich dort versteckte.
[179] Am Abend brachte die Bürgerschaft, an der Spitze die hannoverschen Liedertafeln, dem gemaßregelten Pastor B. eine Serenade mit glänzendem Fackelzug; auch wir in der Union beteiligten uns an dieser Ovation, die ohne Störung in würdiger Weise verlief.
[7.16 Katechismusstreit, Revolte, leichte Entspannung]
Aber nachher verteilte sich die nach vielen Tausenden zählende Menge in den Straßen; und wie es meist bei solchen Gelegenheiten zugeht, wo das aufgeregte Volk in Gärung gerät, suchte auch hier der Mob Kapital herauszuschlagen und ließ durch allerlei Exzesse seine Zerstörungswut aus. Die Volkshaufen zogen durch die Gassen, zerstörten die Laternen, warfen an öffentlichen Gebäuden die Fenster ein und attackierten die Polizei, wenn sie sich ihnen entgegenstellte, so daß diese nicht mehr Herr der Situation war; sie sah sich genötigt, militärische Hilfe zu requirieren, die in Kavalleriepatrouillen die Straßen durchzog und mit der Waffe in der Hand die revoltierende Menge auseinandertrieb. Ich war mit meinem Vetter Georg Henkel, der uns besuchte, auch in einen Volkshaufen geraten, auf den das Militär einhieb; wir konnten uns nur mit knapper Not in eine Seitengasse retten und nur unter Schwierigkeiten unsere Wohnung erreichen. Von unseren Fenstern aus konnten wir auf das Getümmel des hin und her wogenden Volksaufstandes herabsehen; das Schreien, Brüllen und Pfeifen war fürchterlich.
Wir sahen eine Anzahl Menschen fallen, die sich nach dem Zurückdrängen der Menge durch das Militär und die Schutzleute nicht mehr fortbewegen konnten, sie mußten auf dem Trottoir so lange liegen bleiben, bis sie später auf Bahren fortgetragen werden konnten. Darunter waren mehrere schwer verwundete Schutzleute, von denen sogar einige für tot gesagt wurden, was sich aber zum Glück nicht bestätigte. Blutige Köpfe und sonstige Verletzungen durch Hieb- und Stichwunden hat es wohl genug gegeben, aber gottlob keine Leichen.
Der König mußte nach diesem Ausbruch des Volksunwillens schließlich nachgeben, der von der orthodoxen Partei [180] heraufbeschworene Katechismusstreit wurde damit beseitigt; die nächste Folge aber war der Sturz des Ministers Borries; die Hannoveraner waren froh, den verhaßten Machthaber nicht mehr am Ruder zu wissen. An sich klein und unansehnlich von Figur, mit verkniffenem, häßlichem Gesicht, war Borries bei den Hannoveranern nichts weniger wie eine Respektsperson. Wenn man ihm auf der Straße begegnete, wurde er fast nie gegrüßt; er sah aus wie einer, dem man etwas schenken möchte, er hielt nichts auf sein Äußeres und ging meist in einem fadenscheinigen Anzug einher.
Das neuberufene, gemäßigtere Ministerium Hammerstein verfolgte leider im Sinne des Königs auch eine rein welfische Politik. Die Folge davon war, daß das gut national gesinnte hannoversche Volk mit seinen besten Vertretern sich der Oppositionspartei anschloß. Männer wie Bennigsen, Plank, Miquel, Albrecht, Rasch u.a. hielten den nationalen Gedanken hoch, sie traten zu diesem Zwecke mit anderen Patrioten zusammen und gründeten den National-Verein. – –
Wie sehr die Hannoveraner trotz aller politischen Wirren und Fehlgriffe an ihrem Königshause hingen, bewies die Errichtung des Denkmals für den verstorbenen ersten König Ernst August auf dem Bahnhofsplatze; bei der Feier zur Enthüllung dieses Denkmals ließ auch ich im Chor der vereinigten Liedertafeln meine Stimme mit erschallen. Das Denkmal mit der steifen Reiterfigur des Königs, die an einen Bleisoldaten erinnert, trägt an seinem Granit-Postament die Inschrift: »Dem Landesvater sein treues Volk.« – –
[7.17 Deutschnationaler Patriotismus, Sangesbrüderschaften]
In dieser Zeit, in der es in Jung-Deutschland überall gärte, wo der mächtige Drang nach Einheit unseres zerrissenen, politisch ohnmächtigen deutschen Vaterlandes in Turn-, Schützen- und Sängerfesten durch Wort und Lied sich Bahn brach, fanden sich die jüngeren Elemente überall zusammen, den nationalen Geist wach zu halten und zu heben. In Hannover wurde der Männer-Turnklub gegründet, der den Bau der großartigen Turnhalle an der Maschstraße [181] durch die Stadt veranlaßte. Ich wurde ebenfalls Mitglied und nahm wöchentlich zweimal an den Turnübungen teil.
Auch in unserer Liedertafel Union bildeten wir unter uns jüngeren Mitgliedern einen engeren Kreis und vereinigten uns zu einem Doppelquartett unter dem Namen »Die kleine Union«.
Durch Heranziehung von guten Kräften aus dem Männergesangverein und der neuen Liedertafel, mit denen wir schon angefreundet waren, erweiterten wir unseren Sängerkreis und gründeten den Quartettverein »Congreß«. Der Name »Congreß« wurde gewählt, weil in der Zusammenkunft, die von uns berufen war, Vertreter mehrerer Vereine sich zusammenfanden. Der Verein sollte sich auf ein vierfaches Quartett beschränken, heute ist er achtfach und mehr besetzt. An erster Stelle dieses Vereins stand von Anfang an unser aller Freund Louis Jänecke; noch heute, nach bald 50jährigem Bestehen des Vereins, ist er dessen geliebter, hochverehrter Präsident, der die Fahne des »Congreß« stets hoch hielt, dem es zu danken ist, daß der »Congreß« unter den Gesangvereinen Hannovers sich hohen Ansehens zu erfreuen hat. – Wir Sangesbrüder standen in engstem freundschaftlichen Verkehr zueinander; die Freundschaftsbande haben die langen Jahre überdauert. Der Wahlspruch, in einem dem »Congreß« gewidmeten wundervollen Quartett gesungen: »Treulich halten wir zusammen, wie’s auch immer kommen mag«, gilt auch mir gegenüber heute noch wie damals. Es wurde seither kein Fest gefeiert, ohne daß ich, als Ehrenmitglied und ehemaliger Vereins-Pianist, dazu geladen wurde; und wenn ich es irgendwie einrichten konnte, folgte ich der Einladung.
Der Dirigent vom »Congreß« war ebenfalls unser Freund, der vortreffliche Organist an der Marktkirche und Komponist Heinrich Molk, dessen Lieder und Männerchöre in den Gesangvereinen gern gesungen wurden. Unsere Übungsabende fanden wöchentlich in unserem Vereinslokal statt, das wir beim Restaurateur Ochsenkopf in der Seilwinderstraße gemietet hatten. [182] Neben dem ernsten Streben im Quartettgesang, tunlichst das beste zu leisten, unterstützt von einem vorzüglichen Stimmenmaterial, besonders im ersten Tenor, kam aber im »Congreß« auch der Frohsinn und der gesunde Humor zu seinem vollen Rechte. Unser Vereinsabzeichen, einen eingetriebenen Hut mit einer Lyra darstellend, soll sinnbildlich den ausgelassenen Frohsinn im Bunde mit der Sangeskunst bezeichnen. Die fröhlichen Stunden im »Congreß« bleiben mir, wie allen denen, die solche kennen lernten, unvergeßlich. An den Übungsabenden wurde erst mehrere Stunden fleißig gesungen, der Dirigentenstab in der sicheren Hand Heinrich Molks führte das Regiment. Die schnodderigen Witze, die Molk dabei zwischen durch hinnehmen mußte, brachten ihn, – er hatte ein dickes Fell, – nie aus dem Gleichgewicht, er blieb immer bei guter Laune. Nach den Übungen aber führte Fidelitas allein das Szepter, dann fanden sich unsere Sangesfreunde, darunter Künstler vom Kgl. Hoftheater, ein; dem Übermute wurden keine Schranken gesetzt. In der Regel wurde der Humor eingeleitet durch den Congreß-Marsch, den ich als Vereinspianist spielen mußte; die ganze Gesellschaft bedeckte sich mit Hüten in den unglaublichsten Fassons, wobei es mehr auf Ruppigkeit wie auf Eleganz ankam, mit einem Mordspektakel wurde durch das ganze Lokal gezogen. Dann folgte allerlei Scherz, ulkige Gerichtsverhandlungen gegen Mitglieder, die etwas verkorkst hatten, komische Vorträge usw.; man kam dabei aus dem Lachen nicht heraus.
[7.18 Bierreisen von Sangesbrüdern, Arrest]
Zuweilen wurden aber auch Bierreisen nach den Übungen unternommen. Bei Gelegenheit einer solchen kam es zu einem Vorfall, den ich in meinen Erinnerungen nicht unerwähnt lassen darf, denn er führte dazu, daß ich »sitzen« mußte.
Am Schlusse einer solchen Bierreise traten wir Freunde vom Louisenkeller an der Louisenstraße gegen 1 Uhr nachts gemeinschaftlich den Heimweg an, der uns am Theaterplatz nach verschiedenen Richtungen trennte. Wir sagten uns gegenseitig [183] gute Nacht, mein Freund Schrader, den ich untergehabt hatte, rief noch zum Gruß an die entfernten Freunde laut über den Platz: »Na, gute Nacht, meine Herren.« Gleich darauf sprang ein Nachtwächter aus dem Gebüsch am Theaterplatz und faßte mich am Arm, um mich zu arretieren, weil ich durch Rufen die Nachtruhe gestört hätte, deshalb müsse ich mit ihm zur Polizei. Ich bestritt dies als nicht wahr, ebenso Schrader und zwei weitere Freunde, Louis Freyer und Wilhelm Feise, die dicht hinter uns herkamen. Der Cerberus ließ aber nicht locker und hielt mich fest. Ich verbat mir das und drohte ihm, daß ich ihn auf der Polizei wegen Ungehörigkeit zur Rechenschaft ziehen würde, wir würden ihm schon deshalb folgen, um ihm den Standpunkt gründlich klar zu machen.
Im Gefühl meiner Unschuld war ich überzeugt, daß Schrader für mich eintreten werde; ich wollte deshalb, als wir an der Osterstraße in der Nähe meiner Wohnung vorbeikamen, den weiten Weg nach der Polizei ersparen, und bat meine Freunde, deren Heimweg an der Polizei vorüberführte, den Irrtum des Nachtwächters aufzuklären. Aber das Auge des Gesetzes ließ sein Opfer nicht fahren; obgleich ich hoch und teuer versicherte, nicht gerufen zu haben, behauptete der Nachtwächter steif und fest, daß ich es gewesen sei, der zuletzt so laut gerufen hätte, er könne es beschwören. Freund Schrader erwiderte ihm darauf: »Watt, Sei willt swören – Sei könnt höchstens Flott lecken, aber nich swören!« – »Nu mütt Sei ook mit, dat is ’ne Beleidigunge, dei kann ick mek nich bieten laten,« entgegnete erregt der Nachtwächter.
Nun faßten wir die Sache von der gemütlichen Seite auf, hakten uns unter und folgten dem Wächter der Nacht; unterwegs machten wir ihm die Hölle heiß, wir würden ihn schon hineinlegen; daß uns etwas geschehen könne, daran dachte keiner – aber es kam doch anders!
Als wir auf dem Polizeibureau ankamen, wurden wir dem wachthabenden Schutzmann als Arrestanten überliefert, der die Aussagen des Nachtwächters zu Protokoll nahm. Wir [184] bestritten sämtlich die Anklagen des Nachtwächters und glaubten nun entlassen zu werden, umsomehr, weil Schrader und ich dem Schutzmann bekannt waren. Aber alles Protestieren von unserer Seite half nichts, der Schutzmann bedauerte sehr, uns nicht frei lassen zu können, er müsse alle Arrestanten ohne Ausnahme bis zum Verhör mit dem Polizei-Kommissar, das erst am andern Morgen stattfinden konnte, in Haft behalten. Ich beschwor ihn, mich frei zu lassen, weil ich am frühen Morgen mit meinem Chef eine Besprechung auf dem Terrain des neu anzulegenden Friedhofs hatte, zu der ich unbedingt erscheinen müsse – aber es war alles vergeblich, wir mußten bleiben! Die einzige Möglichkeit, am kommenden Morgen zeitiger entlassen zu werden, wäre die, den Kommissar zu veranlassen, daß er unser Verhör früher wie gewöhnlich vornähme.
Ich bat meine Freunde Freyer und Feise, zu meinem Bruder in der Osterstraße zu gehen, diesem meine Lage mitzuteilen und ihn aufzufordern, den Kommissar Bruns früh aufzusuchen und meine Freilassung zu erbitten. Beiden, bereitwillig, mir zu helfen, übergab ich den Hausschlüssel und beschied sie, wo das Zimmer meines Bruders lag, um ihn eiligst zu benachrichtigen. Die Braven machten sich sofort auf den Weg. Es war eine sehr gewagte Mission für meine Freunde, die in einem fremden Hause mitten in dunkler Nacht leicht für Einbrecher gehalten werden konnten. Zum Glück aber begegnete ihnen niemand im Hause, sie fanden das Schlafzimmer unverschlossen, in dem mein Bruder mit Vetter Louis gemeinschaftlich in einem großen zweischläfernen Bett schliefen. In der absoluten Finsternis mußten sie ein Streichholz nach dem andern durch Reiben am Hosenboden anzünden, um sich zurecht finden zu können. Als die Schlafenden durch das Geräusch und plötzliches Aufleuchten erwachten, erschraken sie furchtbar, richteten sich entsetzt auf und riefen, Diebe vermutend: »Was suchen Sie hier!« »Wir wollen zum Herrn Schmidtmann,« war die Antwort. »Der wohnt hinten am [185] Gang,« entgegneten die Geängstigten, die glaubten, daß ich der Gesuchte sei. »Nein, wir suchen den Bruder von dem, der auf der Polizei sitzt,« erwiderten meine Abgesandten, die schließlich erkannt wurden. Sie erzählten kurz von meinem Verhängnis das Nähere, richteten die Bestellung aus und entfernten sich dann wieder.
Die nicht ungefährliche Mission meiner Freunde war so weit gelungen, mein Vetter suchte frühzeitig den Kommissar auf und machte ihn mit meiner Lage bekannt, aber trotzdem, der Herr Kommissar kam her, und kam nicht – wenigstens nicht früher wie sonst auch.
Inzwischen befanden wir beiden Haftgefangenen uns im Wachtzimmer der Polizei. Schrader, der sich aus der ganzen Sache nichts machte, sie im Gegenteil von der scherzhaften Seite auffaßte, entwickelte einen wahren Galgenhumor; er suchte mich aus meiner Desparation herauszureißen. Schließlich sah ich auch ein, daß ich doch nichts erreichen konnte, fügte mich ins Unvermeidliche und wurde ruhiger. Auf meine Frage, wo wir uns schlafen legen könnten – denn auf den harten Stühlen des Wachtlokals die ganze Nacht hindurch zu hocken, könne uns doch nicht zugemutet werden – entgegnete der Schutzmann, daß das eigentliche Arrestlokal wohl eine Schlafstätte habe, aber die sei bereits besetzt. Ich bestand darauf, daß mir Gelegenheit zum Niederlegen gegeben werde, oder ich würde Beschwerde gegen die unwürdige Behandlung anständiger Menschen führen. Wenn keine weitere Schlafstätte da sei, möge der Arrestant, der doch schon die halbe Nacht – es war inzwischen ½ 3 Uhr – geschlafen habe, uns Platz machen.
Der Schutzmann fand unseren Anspruch berechtigt und ließ durch einen Kollegen den Arrestanten auffordern, für den Rest der Nacht uns das Feld zu räumen. Der Arrestant kam bald darauf in das Wartezimmer, es war aber eine »Sie« – eine gut gekleidete Dame mit Hut, Schleier, Krinoline und einem Sonnenschirm in der Hand, die wir mit [186] tiefen Bücklingen begrüßten; wir baten sie um Entschuldigung, daß wir sie in ihrer Nachtruhe gestört hätten und das Bett beanspruchten. Sie erklärte aber, daß sie das »Bett« gar nicht benutzt und auf dem Stuhle geschlafen habe; sie sei auch unschuldig verhaftet, weil sie aus Versehen etwas mitgenommen habe. Wir beklagten mit höflichen Worten ihr Geschick und trennten uns von unserer Schicksalsgenossin, die wie es uns schien, den Rest der Nacht sehr gern mit uns gemeinschaftlich durchgebracht hätte. Dann bezogen wir unser neues Quartier, eine größere Stube mit einem schmalen Vorzimmer, in dem ein Schutzengel zur Bewachung der Arrestanten auf einer Pritsche nächtigte.
Das eigentliche Arrestlokal war in stilvoller Schlichtheit mit nur wenigen »Möbeln« ausgestattet. Der Tür gegenüber stand ein etwa 2 Meter langer und ¾ Meter breiter glatter Kasten, daran war ein Holzdeckel nach der Wand zu mit Scharnieren befestigt, der in die Höhe geklappt werden konnte. Das war die Bettstelle. Die Einlage bestand aus einer Matratze mit Keilkissen von grobem Sackleinen, einem leinenen Bettlaken und einer ziemlich ramponierten wollenen Decke. An der Seite stand ein Tisch mit Stuhl – Form »Biedermeierstil –, auf dem Tisch ein irdener Krug und an der gegenüberliegenden Wand ein Eimer, der zu gewissen unaussprechlichen Zwecken als Retter in der Not sehr willkommen war.
Das einzige große Fenster hatte »schwedische Gardinen« die von außen in Form von Eisenstangen angebracht waren. Es war eben für alles gesorgt, besonders dafür, daß man nicht entwischen konnte. Das Bett machte einen so wenig einladenden Eindruck und war so schmal, daß ich es Schrader allein überließ. Ich machte aber meinem Herzen Luft und schimpfte auf Gott und die Welt, daß ich zur Duldung solcher schreiender Ungerechtigkeit verurteilt war. Der gutmütige Schutzmann, der gern noch weiter schlafen wollte, riet mir, doch zu versuchen, etwas zu ruhen.
[187] Schrader hatte indessen den Rock ausgezogen, sich auf das Bett geworfen und rühmte dessen vorzügliche Beschaffenheit; es schliefe sich auf den »Patentsprungfedern« herrlich, für mich sei auch noch Platz übrig, wenn wir uns auf die hohe Kante legten. Ich folgte schließlich seinem Locken und legte mich zu ihm. Von Schlafen war aber keine Rede, wir schüttelten uns vor Lachen über die komische Situation, in der wir uns befanden, und drehten uns verschiedene Male um, wenn uns die Knochen auf der einen Seite zu weh taten, oder wenn kleine seßhafte Ruhestörer, die im Bett ihr Unwesen trieben, uns belästigten; selbstverständlich mußte ich, der vorn liegende, jedesmal vorher aufstehen. Endlich übermannte uns der Schlaf, aber nach kaum einer Stunde rief Schr. mit lauter Stimme: »Köllnäär, zweimal Kaffee mit zwei weichgekochten Eiern!« Natürlich war nun alles wieder munter, ich schrak auf und ebenso der Schutzmann, der die Situation sofort klärte und sagte, daß wir um 8 Uhr ein Glas Wasser als Morgentrunk bekommen würden mit einem Brötchen dazu.
Weil inzwischen der Morgen graute, blieben wir nun munter, und auch der Schutzmann gab alle Versuche, weiter zu schlafen, auf. Ich machte zum ewigen Andenken in mein Notizbuch eine Skizze von unserem Zimmer, in dessen Mittelpunkt Freund Schrader, der genötigt war, mit dem ominösen Eimer in nähere Beziehungen zu treten, die allerdings etwas seltsame Staffage bildete.
So wurde es 7 Uhr, als es allmählich im Gebäude lebendig wurde und die diensttuende Schutzmannschaft einkehrte, die vor unserem Fenster vorbei passierte. Ein Teil derselben kannte uns – ich hatte in meiner baulichen Tätigkeit mehrfach Fühlung mit den Beamten. Die Polizisten waren sehr erstaunt, von uns aus dem Fenster hinter den Eisenstäben begrüßt zu werden, an denen Freund Schr., wie ein hungriger Bär in der Menagerie vor der Fütterung, seine Evolutionen an dem Gitter von einer Seite zur andern [188] machte und damit die größte Heiterkeit der heiligen Hermandad hervorrief.
Gegen 8 Uhr bekamen wir unseren »Morgenkaffee«, d.h. ein Glas Wasser mit Brötchen, und endlich gegen 10 Uhr wurden wir vom Polizei-Kommissar Bruns vernommen, der sein Bedauern ausdrückte über mein gehabtes Pech. Ich wurde sofort entlassen, ebenso Schrader, den ich zunächst mit in seine Wohnung begleitete, um ihn bei seiner Mutter zu entschuldigen, die in tausend Ängsten war, als sie am Morgen das Bett ihres Sohnes unberührt fand. Dann ging ich in meine Wohnung mit dem Gefühl eines Verbrechers, der aus dem Zuchthause entlassen ist; ich glaubte, jedermann müsse es mir an meinem ungewaschenen Gesicht ablesen können, daß ich »gesessen« hatte.
Nachdem ich meinen äußeren Adam wieder einigermaßen aufgefrischt hatte, ging ich mit beklommenem Herzen zum Stadtbauamt. Droste, der mich auf dem Bauplatz des Friedhofes früh morgens vergeblich erwartet hatte, empfing mich sehr ungnädig und fragte, warum ich nicht dort gewesen sei. Als ich ihm gestand, daß ich nicht kommen konnte, weil ich die Nacht im Polizei-Arrest verbringen mußte, nahm er eine entrüstete Miene an. Ich bat ihn, mich anzuhören, erzählte ihm den Vorfall und drückte mein Bedauern aus, daß er den weiten Weg habe vergeblich machen müssen. Meine Erzählung hatte das sonst so gute Einvernehmen mit dem alten Herrn wieder ins Lot gebracht, an meine Unschuld wollte er jedoch nicht recht glauben.
Aber dald darauf konnte ich den Beweis der Wahrheit antreten; meine Sache kam vor das Amtsgericht zur Aburteilung. Ich wurde freigesprochen, denn mein Kronzeuge Schrader beschwor, daß nicht ich, sondern er den lauten Ruf getan habe, auf den hin der Nachtwächter mich irrtümlich arretierte. Nach erfolgtem Freispruch, der dem Nachtwächter nicht zu behagen schien, trat dieser nochmals vor den Richter mit den Worten: »Ick hewwe noch wat extra.« Auf die [189] Frage des Richters, was das sei, antwortete er: »Dei Tüge hat meck beleidiget, hä hat eseggt, ick sülle Flott lecken.« – Darauf erfolgte allgemeines Gelächter und die Abweisung der Anklage durch den Richter. Ich war nun vor meinem Chef gerechtfertigt, und er war wieder der alte, gütige Herr gegen mich.
[7.19 Arbeiten am Friedhof Engesohder Berg]
Mit dem Bau der umfangreichen Friedhofsanlage am Engesohder Berg konnte nunmehr der Anfang gemacht werden, nachdem ich die Vorarbeiten auf dem Bauamte soweit fertig hatte. Über die geplante Anlage will ich hier einiges vorausschicken.
Die seitherigen Friedhöfe Hannovers lagen in den verschiedenen Stadtbezirken verteilt; sie waren nur von beschränkter Größe und nicht erweiterungsfähig, weil sie durch die mächtige Ausdehnung der Stadt schließlich inmitten angebauter Straßen zu liegen kamen. Die Stadtbehörde beschloß deshalb, diese Friedhöfe allmählich eingehen zu lassen und an Stelle der getrennt liegenden einen großen Zentralfriedhof weiter außerhalb des eigentlichen Stadtgebiets anzulegen. Das Terrain, welches hierzu bestimmt wurde, gehörte bereits der Stadt; es lag zwischen der alten Hildesheimer Straße, einer verlassenen Verkehrsstraße, und der Masch, den großen Niederungen an der Leine, und bildete durch die erhöhte Lage von etwa 5 Meter den sogenannten »Engesohder Berg«. Diese höhere Lage war Vorbedingung für die Anlage, um Grundwasser zu vermeiden.
Die Anlage beschränkte sich zunächst auf ein Areal von etwa 22–24 Morgen, war aber durch angrenzenden städtischen Besitz vergrößerungsfähig bis zum Döhrener Turm.
An der Eingangsseite der Anlage, parallel mit der etwa 200 Meter entfernt vorbeiführenden Hildesheimer Landstraße, einer schönen Lindenallee, war das Friedhofsgebäude projekiert. Die Mittelpartie des langgestreckten Gebäudes bildete eine Kapelle mit Durchfahrtshallen auf beiden Seiten. Hieran schlossen sich links und rechts große pavillonartige Bauten, [190] wovon einer die Räume des Leichenhauses, der andere die der Inspektor-Wohnung enthielt. Dann folgten nach jeder Seite je sechs überbaute Arkaden mit Gruftgewölben für angesehene begüterte Familien, den Abschluß bildeten Eckpavillons, konform den in der Mitte gelegenen.
Außer diesem umfangreichen Bauwerk waren die Einfriedigungen der großen Anlage mannigfachster Art, Futtermauern mit Sandsteinbalustraden, bastionenartige Terrassen mit durchbrochenem Mauerwerk u.a. Neben diesen baulichen Anlagen waren die gesamten Innenanlagen, Bodenregulierungen, Wege und Anpflanzungen, sowie die äußeren chaussierten Straßenbauten mit Trottoiren und Alleen meiner speziellen Leitung unterstellt; es bot sich also ein Arbeitsfeld, wie ich es mir nicht besser wünschen konnte.
Die Arbeiten auf der weit außerhalb der Stadt im freien Felde liegenden Baustelle erforderten eine Unterkunft für mich während der Bauzeit. Zu diesem Zwecke wurde eine Bauhütte mit Fachwerk gebaut, sie enthielt ein geräumiges Baubureau für mich und ein Stübchen für meinen Aufseher, davor lag ein kleiner Hausflur. Den geräumigen Dachboden hatte ich mir nutzbar gemacht zur Einrichtung eines Taubenschlags, auf dem ich mir weiße Pfauentauben hielt, die im Felde ringsum reichliche Nahrung fanden.
In der Nähe der Bauhütte wurde zunächst ein großer Brunnen von etwa 2 Meter Durchmesser angelegt, der das zum Bau erforderliche Wasser zu liefern hatte.
Bei der großen Entfernung meiner Baustelle von der Stadt, bezw. von meiner Wohnung, waren die weiten Wege für mich recht lästig; dieser Umstand nötigte mich, mir eine Wohnung in der Nähe zu suchen. Ich hatte bald eine solche gefunden, die mir geeignet schien, weil sie zwischen dem Bauplatz und der Stadt lag. – In »Bayers Garten«, einem Wirtschaftsetablissement, konnte ich ein geräumiges Zimmer mieten, verlangte aber die Instandsetzung des sehr verwohnten Raumes. Die Begriffe über Instandsetzung waren jedoch bei [191] meinem Vermieter andere, als bei mir, er ließ nur sehr wenig ausbessern und wollte mir alles andere selbst aufbürden. Ich verstand mich aber hierzu nicht und zog infolgedessen auch nicht ein.
Ich mußte nun anderweit mein Heil versuchen und wendete mich nach dem meiner Baustelle ebenfalls nahegelegenen »Döhrener Turm«, um dort nachzufragen. Mein guter Stern leitete mich dorthin; hier fand ich das, was ich suchte, ein Unterkommen und noch viel mehr – – – – – doch davon später!
[192] 8. Auf dem Döhrener Turm.
[8.1 Lage und Geschichte des Turms]
Hier klicken (→) für den Wikipedia-Beitrag über den Döhrener Turm.
Hier klicken (→) für einen Bericht mit einem Foto des Döhrener Turms vor dem Umbau durch Schmidtmann sowie mit Innenaufnahmen.
In der äußeren Grenze des Stadtgebietes zieht sich von Süden über Osten, nach Norden halbkreisförmig, in mehrere Stunden langer Ausdehnung die »Eilenriede« hin, ein schöner, mit Eichen, Buchen und Nadelholz bestandener Wald. Die Eilenriede, ein kostbarer städtischer Besitz, hat für Hannover etwa die gleiche Bedeutung, welche der Habichtswald für Cassel hat, nur daß jene in der Ebene liegt, dieser auf langgestreckten Bergeshöhen. Durchzogen mit gut gehaltenen Fuß-, Reit- und Fahrwegen, lockt die Eilenriede die Bewohner der Stadt aus der oft recht dunstigen Atmosphäre hinaus in die duftige frische Waldesluft, sie suchen Erholung in den vielen schönen Etablissements und Waldwirtschaften, die, außer dem Zoologischen Garten sämtlich der Stadt gehören und von dieser verpachtet sind. Unter ihnen ist einer der beliebtesten und angenehmsten Aufenthaltsorte in der Umgebung Hannovers der »Döhrener Turm«, außerdem eine sagenumwobene Stätte, die in der Geschichte Hannovers eine denkwürdige Rolle spielt. Im Mittelalter war nämlich der Döhrener Turm einer von den Warttürmen, die um die Stadt herum zum Schutze derselben errichtet waren. Die Historie erzählt von ihm, wie vor hunderten von Jahren, in der Zeit des Faustrechtes, wo die Städte zur Verteidigung ihrer Freiheiten, ihres Handels und Verkehrs, sich gegen fürstliche Herrschaftsansprüche verbündeten, auch die Stadt Hannover mit dem Herzog von Braunschweig in Fehde lag. Um die Stadt zu überrumpeln, hatte der feindliche Herzog seine Krieger in sogenannte Planwagen, d.h. Frachtwagen, bedeckt mit einem großen Leinen zum [193] Schutz gegen das Wetter, verborgen, um sie in diesem Versteck unbemerkt in die Stadt einzuschmuggeln und so die Bürgerschaft hinterlistig zu überfallen. Die Wachtmannschaft des Döhrener Turmes aber hatte von der Kriegslist des Herzogs Wind bekommen und griff die Wagen an, um sie am Weiterkommen zu hindern. Einer der ihrigen wurde als Bote in die Stadt geschickt, um diese von dem Überfall der Braunschweiger in Kenntnis zu setzen. Dieser Bote schlich sich durch den Landwehrgraben, der heute noch am Döhrener Turm vorüberführt, und gelangte ungesehen in die Stadt, deren Bevölkerung er sofort alarmierte. Die tapfere Besatzung des Wartturmes aber mußte der Übermacht des Feindes weichen, sie zog sich in den Turm zurück, ohne sich dem Feinde zu ergeben, und verteidigte sich mit Todesverachtung. Als die Braunschweiger sahen, daß die Belagerten sich nicht ergaben, legten sie ringsum den Turm Feuer an, so daß die eingeschlossene Heldenschar – es waren sieben Personen, die in der Geschichte Hannovers wegen dieser todesmutigen Tat als »Hannovers Spartaner« fortleben – elendiglich verbrennen mußten. Die inzwischen alarmierte Bürgerschaft der Stadt zog eiligst den feindlichen Kriegern entgegen und schlug sie in die Flucht; leider war es zu spät, die Besatzung des Wartturmes zu retten, die Tapferen hatten sich selbst geopfert, aber die Stadt war durch ihre Heldentat gerettet worden. Der innere überwölbte Raum des Turmes, in dem die treuen Bürger Hannovers ihren Tod fanden, ist heute noch vorhanden, er dient als Vorratsraum für Würste, Speck usw. An der Außenseite des Turmes ist später eine Gedenktafel angebracht, um der Nachwelt Kunde von dem hier bewiesenen Heldenmut und der Treue bis in den Tod zu erhalten.
[8.2 Begegnung mit Familie Buerdorf]
Der Döhrener Turm bildet mit seinen parkartigen Waldanlagen und schönen Baumgruppen das äußerste Ende der Eilenriede, an die sich in meilenweiter Ausdehnung die üppig grünenden Maschwiesen unmittelbar anschließen.
Außer den Gebäuden und den Gartenanlagen, die dem Wirtschaftsbetrieb dienten, gehörte noch eine große Fläche [194] Ackerland und Wiesen zu der Pachtung, sodaß neben der Wirtschaft noch Landwirtschaft betrieben werden mußte. Ferner gehörte die Erhebung des städtischen Oktroi mit zu den Obliegenheiten des Pächters. Der derzeitige Pächter, Christian Buerdorf, war schon eine lange Reihe von Jahren auf dem Döhrener Turm ansässig. »Vater Buerdorf«, wie er genannt wurde, erfreute sich durch seine liebenswürdige Bonhomie einer allgemeinen Beliebtheit in weiten Kreisen der Stadt. An seiner Seite stand seine tüchtige Hausfrau die mit Umsicht die Wirtschaft leitete und den Ruf einer vorzüglichen Küche, die den Döhrener Turm besonders auszeichnete, zu wahren verstand.
Beide, ein stattliches Paar, erfreuten sich einer größeren Kinderschar, dreier Töchter und ebenso vieler Söhne.
Hierher, nach dem Döhrener Turm, lenkte ich nunmehr meine Schritte, stellte mich, dort noch gänzlich unbekannt, dem Herrn Buerdorf als Bauführer der benachbarten großen städtischen Friedhofs-Anlage vor und fragte vorerst an, ob ich Mittagstisch haben könne. Ich bekam jedoch ablehnenden Bescheid, weil der Wirtschaftsbetrieb hauptsächlich nur für Nachmittag und Abend eingerichtet sei. Auf meine Bitte, ob es sich nicht doch einrichten lasse, weil ich unter keinen Umständen wieder nach Bayers Garten zurück wollte, ließ er sich dazu bewegen, mir Mittagstisch zu gewähren, unter dem Vorbehalt, daß ich mit dem fürlieb nehmen müsse, was auf den Familientisch käme. Ich erklärte mich sehr damit einverstanden, und war glücklich, auf diese Weise zunächst der Sorge, wo ich speisen könne, überhoben zu sein; das erste Mittagsmahl fiel denn auch so vorzüglich aus, daß ich sehr zufrieden sein konnte.
[8.3 Teilnahme am Familienleben]
Anfangs speiste ich allein in einem Zimmer; wenn Vater Buerdorf Zeit hatte, leistete er mir Gesellschaft und informierte sich über die geplanten Anlagen in seiner Nachbarschaft, die ihn sehr interessierten. Er erkundigte sich auch nach meiner früheren Tätigkeit; wie er hörte, daß ich das [195] Brauergildehaus geleitet hatte, sagte er, daß er durch Braumeister Ebert schon von mir gehört habe. Im Laufe der Unterhaltungen erfuhr ich von ihm, daß er vor seiner Verheiratung sieben Jahre lang in Paris gewesen war und dort als Haushofmeister bei dem hannoverschen Gesandten am Hofe Louis Philipps, Freiherrn v. Stockhausen, viel Interessantes erlebt hatte; u.a. hatte er die mit großem Gepränge stattgehabte Überführung der Asche Napoleons von St. Helena mitangesehen.
Die Frau des Hauses kennen zu lernen, dazu hatte sich noch keine Gelegenheit geboten; ich sah sie wohl mal im Vorübergehen und grüßte, jedoch ohne weitere Beachtung zu finden. Es schien mir so, als ob sie nicht recht damit einverstanden war, einen ständigen Mittagsgast in mir zu haben – sie hielt sich wenigstens reserviert.
Die Kinder, d.h. die drei Töchter und zwei Söhne, besuchten noch die Schule, ein kleines dreijähriges Söhnchen war noch zu Hause.
In der Mittagszeit blieben die beiden ältesten Töchter Emma und Sophie in der Stadt und aßen dort bei Freunden des Hauses; ich fand deshalb noch keine Gelegenheit, sie zu sehen. Das dritte Töchterlein, Dora, ein frisch blühendes, kräftiges Mädchen von zehn Jahren, mit kindlich treuherzigem Wesen, wagte es zuerst, mit ihrem Papa zu dem fremden Eindringling ins Zimmer zu kommen und ihm Gesellschaft zu leisten.
Nach etwa sechs bis acht Tagen machte mir Vater Buerdorf, der ganz allein zu Hause war – Frau und Kinder waren über Mittag in der Stadt geblieben – den Vorschlag, mit ihm zusammen im Familienzimmer zu speisen. Ich nahm diesen Vorschlag dankend an. Er wollte mir aber auch etwas ganz besonderes zugute tun und ließ mir ein Filet nach französischer Art auf Rost zubereiten, das schmeckte mir vortrefflich. Im Familienzimmer stand ein Rittmüllerscher Flügel, der aber nur selten gespielt wurde. Ich bat um die [196] Erlaubnis, meine noch freie Zeit nach dem Essen auszunutzen und auf dem Flügel etwas musizieren zu dürfen; es mache mir Freude, mal in die Tasten zu greifen, weil mir jetzt sehr wenig Gelegenheit zum Spielen geboten würde. Während meines Musizierens trat Mutter Buerdorf mit ihren beiden ältesten Töchtern ins Zimmer, die, aus der Stadt zurückkommend, mich allein im Zimmer überraschte und mich ganz erstaunt ansah. Ich stellte mich in aller Form vor und bat sehr um Entschuldigung, während ihrer Abwesenheit in das Familienzimmer eingedrungen zu sein, aber ich hätte die freundliche Einladung ihres Mannes nicht abschlagen können, ebenso hätte ich mir die Erlaubnis erbeten, auf dem Flügel spielen zu dürfen. Ich wurde ersucht, mich nicht stören zu lassen und nur weiter zu spielen; um aber nicht aufdringlich zu erscheinen, wollte ich mich lieber empfehlen. Vater Buerdorf, der inzwischen wieder auf der Bildfläche erschien und die Situation aufklärte, hielt mich jedoch zurück und bat mich, nun auch den Kaffee im Beisein seiner Frau und Töchter im Familienzimmer zu trinken, wozu ich natürlich gern bereit war. Nach einiger Zeit erschien die Mutter mit ihren Töchtern, die ihre Garderobe abgelegt hatten, wieder am Kaffeetisch, bewahrte aber mir gegenüber eine formelle Zurückhaltung, die erst allmählich einer traulichen Unterhaltuung Platz machte. Wieder einmal war es die Musik, die mir auch hier hilfreich zur Seite stand, um mich einzuführen, und die den Stoff zur Unterhaltung bot. – Ich sprach Frau Buerdorf meinen besten Dank aus für die Freundlichkeit, mich als Mittagsgast aufgenommen zu haben, womit ich ihr gewiß Umständlichkeiten bereitet hätte, dann empfahl ich mich nach dem Kaffee.
Am andern Mittag fragte mich Vater Buerdorf, ob es mir recht wäre, wenn ich, statt allein zu speisen, am Familientisch teilnehmen wolle. Niemand war erfreuter wie ich über dies freundliche Anerbieten, das ich mit Dank gern annahm.
Ich lernte auf diese Weise die ganze liebe Familie kennen und freute mich sowohl über die wohlerzogenen Kinder, wie [197] über den guten Ton, der im Hause herrschte, worauf Mutter Buerdorf streng hielt.
In der ersten Zeit war ich den heranwachsenden Töchtern noch eine Respektsperson, der gegenüber sie eine gewisse Zurückhaltung beobachteten. Allmählich aber freundeten sie sich mehr und mehr mit dem »Herrn Bauführer«, wie ich stets genannt würde, an, und der Verkehr wurde immer vertraulicher im Familienkreise.
[8.4 Einzug im Turm]
Eine passende Wohnung hatte ich noch immer nicht gefunden; um frühzeitig morgens an Ort und Stelle zu sein, mußte ich gegen 6 Uhr hinauswandern und kam erst spät abends oft todmüde wieder nach Hause; das konnte mir natürlich auf die Dauer nicht mehr behagen. Ich war deshalb genötigt, mich nochmals ernstlich nach einer der Baustelle näher gelegenen Wohnung umzusehen, und da wollte ich jetzt mein Heil, auf dem Döhrener Turm zu wohnen, versuchen. Auf meine Anfrage aber erhielt ich den Bescheid, daß die im Hause vorhandenen Wohnräume kaum für die eigene Familie ausreichten. Es war allerdings im Dachgeschoß ein großer freier Raum, der aber als Speicher benutzt wurde. Meinem Vorschlag, von diesem Raum einen Teil zur Einrichtung zweier Stuben herzugeben, wurde ohne Bedenken zugestimmt, es blieb mir aber überlassen, die nötigen Schritte dafür zu tun, daß der Magistrat den notwendigen Umbau genehmigte und die Kosten hierfür bewilligte.
Mit Hilfe meines Freundes und Kollegen Ratkamp, zu dessen Dienstobliegenheiten die Unterhaltung der städtischerseits verpachteten Gebäude gehörte, gelang es, beim Magistrat die Bewilligung zum Umbau gegen Verzinsung der entstehenden Kosten durchzusetzen; ich wurde selbst beauftragt, diesen meiner Baustelle nächstliegenden Umbau ausführen zu lassen. Binnen etwa zwei Monaten hatte ich durch breite, zweifenstrige Erkerausbauten, einen nach der Straßenseite, den andern nach dem Garten hin, zwei schöne, geräumige Zimmer herrichten lassen, von denen mir dasjenige nach dem Garten [198] zu eingeräumt wurde. So war denn die Wohnungsfrage für mich in glücklichster Weise gelöst, ich wohnte nahe bei meiner Baustelle und fand engen Anschluß an eine Familie, in der ich mich sehr wohl fühlte. Mit meinen Siebensachen siedelte ich alsbald nach dem Döhrener Turm über und richtete mir mein Zimmer sehr behaglich ein. Das Wohnen in der schönen freien Natur war mir etwas ganz Neues; seither hatte ich nur in geräuschvollen, verkehrsreichen Straßen der inneren Stadt gehaust und mußte reine, frische Luft sehr entbehren. Von meinem Zimmer blickte ich in den großen, mit hohen Bäumen bewachsenen, waldigen Garten mit herrlichen Durchblicken über die weiten, saftig grünen Maschwiesen nach dem langen Höhenzuge des Deisters. Ein eigenartiger Zauber lag über der Landschaft, die sich vor meinen Augen ausbreitete, dabei die reine, köstliche Waldluft, abends die himmlische Ruhe, nur unterbrochen von dem melancholischen Schlag zahlreicher Nachtigallen – alles dies wirkte ungemein wohltuend auf mich ein, und dazu kamen noch die lieben Menschen, denen ich mich jetzt näher anschließen konnte.
Sowohl den Eltern Buerdorf wie den Kindern, vor allem den Töchtern war ich bald kein Fremder mehr, ich wurde der Freund und Vertraute des Hauses. Um meine bevorzugte Stelle, die ich gegen andere, schon länger mit der Familie befreundete Gäste des Hauses einnahm, wurde ich sehr beneidet; mein zwangloser, gemütlicher Verkehr in der Familie wurde mit scheelen Augen angesehen. Das besondere Zutrauen der Eltern zu mir, ebenso die Zuneigung der Kinder versuchte man sogar durch ein anonymes Schreiben zu stören, das mich sehr in Erstaunen setzte, weil ich nicht wußte, wem ich ins Garn geraten war; vermutlich war es ein alter Onkel, der, seither täglicher Gast in der Familie, sich durch mich zurückgesetzt fühlte und mich als Eindringling betrachtete. Er mußte es aber selber mit anhören, daß der ihm vorgelesene Brief von Frau Buerdorf als eine lächerliche Anmaßung des Anonymus bezeichnet wurde, der besser täte, seine Nase in seine eigenen Angelegenheiten [199] zu stecken. Offenbar hatte diese Äußerung ihre Wirkung nicht verfehlt, denn der liebe, alte Onkel ließ sich von nun ab weniger in dem Familienzimmer blicken, und ich fühlte mich um so mehr zur Familie hingezogen.
[8.5 Die Buerdorf-Töchter]
Von den drei Töchtern des Hauses war Emma, die älteste, inzwischen konfirmiert worden und mußte der Mutter im Hause tüchtig zur Hand gehen. Sie war, gegen ihre beiden jüngeren Schwestern Sophie und Dora, ernster in ihrem Wesen; bei aller Freundlichkeit gegen mich wahrte sie, als angehende junge Dame, eine gewisse Förmlichkeit und hielt sich mehr zurück; unverdrossen ging sie ihren häuslichen Pflichten nach, die in dem großen Haushalt nicht leicht waren; sie war, sich stets gleich bleibend, eine liebe, herzensgute, treue Seele. Die zweite Tochter Sophie ging noch ein Jahr zur Schule. Heiter, frohgemut und dabei doch sinnig und herzlich, gewann sie bei ihrer natürlichen Bescheidenheit leicht die Herzen. Auch ich war durch ihr freundliches, zutunliches Wesen bald für sie eingenommen, ihre lieben, seelenvollen Augen hatten es mir angetan; sie dereinst ganz zu besitzen und als die Meine heimzuführen, war ein beglückender Gedanke, der in mir immer fester wurzelte, je mehr ich sie kennen lernte. Sie wußte, daß ich ihr gut war, und schenkte mir ihr Vertrauen; ich mußte ihr bei den Schularbeiten helfen, sie abhören und stand ihr hilfreich bei, so oft sie es verlangte. Meinen Verwandten, die mich aus Cassel besuchten, sagte ich damals schon: »Die Sophie wird einmal meine Frau, die ziehe ich mir heran« – und so kam es auch.
Dora, als Dritte im Bunde der lieblichen Töchter, war um beinahe 4 Jahre jünger wie Sophie, aber kräftiger entwickelt wie diese, so daß man den Altersunterschied nicht vermutete; Eltern und Geschwister nannten sie als Kind deshalb »Dickes«. Bei aller kindlichen Naivität besaß sie aber eine Selbständigkeit, mit der sie ihren Jahren bedeutend voraus war. Die beiden Schwestern mußten jeden Morgen sehr früh aufstehen, denn sie hatten bis zur Schule, die um 8 Uhr begann, [200] eine Stunde zu gehen, gleichviel welches Wetter es sein mochte. – Weil ich auch früh auf der Baustelle sein mußte, weckten mich die Kinder, damit ich mit ihnen gemeinschaftlich den Morgenkaffee trinken konnte.
Der Mutter Buerdorf lag die Erziehung der Töchter besonders am Herzen; ihr Ordnungssinn, ihr fleißiges Schaffen und Wirken im Haushalt, ihr strenges Halten auf Takt und gute Sitte leitete sie in der Heranbildung der jungen Mädchen für die Zukunft, und, ich kann es aus eigener Erfahrung bestätigen, mit Erfolg. Die Söhne waren mehr auf den Vater angewiesen, der aber in vielen Dingen bei seinem überaus gutmütigen Wesen Nachsicht statt Strenge walten ließ.
Ich fühlte mich jetzt wohlgeborgen im Kreise dieser Familie; alle freie Zeit, die mir meine Berufstätigkeit ließ, verbrachte ich im gemütlichen Verkehr mit den Angehörigen; ich kam oft wochenlang nicht in die Stadt. – –
[8.6 Archäologische Funde auf dem Friedhofsgelände]
Auf meiner Baustelle regte es sich nun mächtig, die Hochführung des langgestreckten Friedhofs-Gebäudes, das einem Maurermeister (Brauns) übertragen war, machte gute Fortschritte. Die umfangreichen Erdarbeiten wurden im Tagelohn unter meiner speziellen Leitung ausgeführt; zur Beaufsichtigung der Leute hatte ich einen Aufseher angestellt; die Auslöhnung meiner zahlreichen Arbeiter erfolgte jeden Sonnabend durch mich.
Eines Tages kam ich beim Kontrollieren der Arbeiten an eine Stelle, wo das hochliegende Terrain abgetragen wurde; in dem hellgelben Sandboden seitwärts daneben lag eine Anzahl schwarzer Scherben, vermischt mit verbrannten Knochenresten, die mir auffielen. Ich befragte meinen Aufseher, was das sei, worauf er mir erwiderte: »Wi hewwet uf emoh so’n swarten Pott funnen; wi glöwten, et sei’n Schatz inne und hewwen ’n kaput slahn, et waß aber wider nix inne, wie Knooken.« Über diese Eigenmächtigkeit meiner Leute sehr aufgebracht, machte ich meinem Aufseher den Kragen raus und befahl ihm aufs strengste, daß er sich das nicht wieder erlauben dürfe, ohne mich [201] vorher befragt zu haben. Der überraschende Fund lieferte mir den Beweis, daß es sich um eine heidnische Grabstätte handelte, die auf diese Weise aufgedeckt war. Ich sammelte nun die Scherben und suchte sie in meiner Bauhütte zusammen zu passen, um die Form des Aschenkruges zu erfahren, den ich als solchen erkannte.
Kurze Zeit darauf kam mein Aufseher, klopfte ans Fenster und rief: »Herr Bauführer, wi hewwet widder ’n Pott funnen!« Ich folgte ihm sofort und fand in dem hellen Sandboden, der mit der Stechschippe abgestochen wurde, die schwarze Stelle eines sichtbar werdenden Aschenkruges. Um denselben ganz zu erhalten, grub ich ihn selbst vorsichtig rings herum frei und nahm ihn mit beiden Händen auf, um ihn zu meinem Bureau zu tragen. Bei der flachen Form aber brach das Gefäß, das noch bis obenhin voll Sand gefüllt war, mitten entzwei und fiel mir in mehreren Stücken zu Boden. Ich nahm diese Stücke mit dem Inhalt von Knochenresten, zwischen denen sich einige Bronzegegenstände, durchlöcherte fünfeckige Plättchen befanden, zusammen und trug sie in die Bauhütte. Noch im Begriff, die Urne zusammenzusetzen, kam Scheldt, so hieß mein Aufseher, von neuem gelaufen, um mir den Fund eines weiteren Aschenkruges zu melden. Jetzt wurde ich in eine freudige Erregung versetzt, weil ich nun die Gewißheit hatte, einen größeren heidnischen Begräbnisplatz aufgefunden zu haben. Damit die jetzt sich zeigende Urne gut erhalten blieb, grub ich sie ebenfalls selber aus, nahm aber den Sand bis auf die Knochenreste heraus und stellte eine leere Zementtonne über die nun freistehende größere Urne, damit sie trocknete. Die Erdarbeiten an diesem Platze ließ ich dann einstellen und eilte schleunigst zur Stadt, um meinem Chef auf dem Stadtbauamte Mitteilung von der überraschenden Entdeckung zu machen. Droste, der über die Nachricht von meinem gemachten Funde sehr erfreut war, veranlaßte mich, die beiden Vorstandsmitglieder des »Naturhistorischen Vereins für Niedersachsen«, Senator Dr. Schläger und Archivrat Grotefend in einer [202] Droschke abzuholen und nach dem Friedhofsbau zu fahren, wo er sich auch einfinden wolle. Beide Herren traf ich persönlich an und fuhr mit ihnen hinaus. Senator Schläger, der mich schon durch Kirchwegers kennen gelernt hatte, beglückwünschte mich zu dem gemachten Funde, der nach meiner Beschreibung darauf schließen lasse, daß bei Hannover in altheidnischer Zeit schon eine größere Ansiedelung bestanden habe; in unmittelbarer Nähe der Stadt seien bisher derartige Funde noch nicht gemacht. Er meinte, ich sollte mir den Hergang der Entdeckung genau merken und eine Aufzeichnung von den gefundenen Urnen und ihrer Stellung zueinander machen, damit ich einen Vortrag im naturhistorischen Verein halten könne. Auf meine Entgegnung, daß ich nicht imstande sei, öffentlich zu reden, machte er mir Mut, es werde schon gehen, er habe auch auf ähnliche Weise reden gelernt. Zum Glück aber wurde nichts aus dem Vortrage; er konnte unterbleiben, weil der Verein später an Ort und Stelle bei den weiteren Ausgrabungen zugegen war.
Als ich mit den Herren auf der Baustelle eintraf, folgte gleich darauf Baurat Droste. Ich zeigte den Herren die beiden zertrümmerten Urnen, die ich notdürftig zusammengeflickt hatte, und ging dann mit ihnen an die Fundstelle, um die noch dort stehende, gut erhaltene Urne zu besichtigen, die inzwischen so getrocknet war, daß ich sie unversehrt in mein Bureau tragen konnte.
In Gegenwart der Herren ließ ich dann von einigen Leuten weiter Graben, und alsbald fand sich zu unserer großen Freude wieder eine Aschenurne, die ebenfalls von mir sorgfältig freigelegt wurde. Auf Wunsch der Herren aber mußte sie an Ort und Stelle stehen bleiben, geschützt durch eine leere Tonne; die beiden Herren erhoben Einspruch gegen weitere Ausgrabungen und baten um Einstellung im Interesse ihres Vereins, der zu einer Versammlung an Ort und Stelle eingeladen werden sollte, um bei der weiteren Aufdeckung des vermuteten größeren Begräbnisplatzes zugegen zu sein. Ich schlug [203] vor, eine obere Schicht von etwa 3 Fuß abtragen zu lassen, welche nach den bis dahin gemachten Erfahrungen ungefähr über den Urnen lagerte, was gebilligt wurde. Senator Schläger verfaßte einen Bericht über den interessanten Fund, der sofort in den Zeitungen veröffentlicht werden sollte.
Inzwischen fand ich Zeit, die Stücke der beiden zerbrochenen Urnen wieder zusammenzusetzen und die Risse auszubessern, so daß sie auf den Regalen, die ich mir in meinem Bureau zur Aufstellung der Aschenkrüge und etwaiger weiterer Funde herrichten ließ, mit zur Schau kommen konnten.
[8.7 Der Kronprinz interessiert sich für die Altertümer]
Am zweiten Tage darauf sah ich, an meinem Zeichenbrett sitzend, über das Bauterrain eine Kavalkade von drei Reitern in Uniform auf meine Bauhütte zureiten, in denen ich beim Näherkommen den Kronprinzen Ernst August mit seinem Adjutanten Rittmeister v. Klenk erkannte, gefolgt von einem königlichen Reitknecht.
Der Kronprinz und sein Adjutant saßen ab, übergaben dem Reitknecht ihre Pferde und kamen in mein Bureau. Ich verneigte mich vor Sr. Königlichen Hoheit dem Kronprinzen, der sich sofort in ein Gespräch mit mir einließ und sich nach dem auf der Baustelle gemachten wissenschaftlich wertvollen Funde erkundigte, der ihn sehr interessiere. In sehr lebhafter Weise fragte er mich über alles darauf Bezügliche aus, ich zeigte ihm die drei im Zimmer stehenden Urnen mit dem Inhalt, die er eingehend betrachtete, und führte ihn dann zur Fundstelle und zu der noch an ihrem Platze stehenden Urne.
Der Kronprinz war sehr angeregt, er ließ sich von mir einen Spaten geben, um selbst nachzugraben; v. Klenk und ich waren ihm dabei behilflich. Ein glücklicher Zufall fügte es, daß sich bald wieder eine schwarze Stelle im Sandboden zeigte, zur großen Freude des Prinzen, es war die fünfte Urne, die zum Vorschein kam. Er ließ mich allein weiter graben, weil ich, wie er meinte, das Geschäft besser verstände, und so wurde auch dies Exemplar freigelegt und mit einer Tonne geschützt. Ich bat um die Erlaubnis, eine Etikette an der Urne anbringen [204] zu dürfen mit der Inschrift: »Ausgegraben am .... von Sr. Königl. Hoheit dem Kronprinzen«, wogegen der Prinz nichts einzuwenden hatte; er verabschiedete sich dann und versprach, wieder zu kommen. Der Aufenthalt hatte längere Zeit gedauert, die Pferde wurden eiligst bestiegen und die drei Reiter trabten im flotten Tempo nach Hannover zurück, begrüßt von den Arbeitern und einer Anzahl Leute, die sich außerhalb des Bauplatzes angesammelt hatten.
Etwa eine Woche später versammelte sich der »Naturhistorische Verein« in zahlreicher Vertretung zu der offiziell stattfindenden Ausgrabung auf der Fundstelle. Unter den Mitgliedern war eine Anzahl bedeutender Männer Hannovers, darunter die berühmten Generäle Halkett und Jacobi; der erstere kommandierte eine Brigade der hannoverschen Armee in der Schlacht bei Waterloo, die dort heldenmütig mit großem Erfolge für den günstigen Ausgang der Schlacht kämpfte.
Mit einigen zuverlässigen Arbeitern ließ ich den Boden – das obere Erdreich war bereits abgetragen – in vorsichtiger Weise weiter fortnehmen und schaffte zur Freude des gespannt den Ausgrabungen folgenden Vereins eine größere Anzahl Urnen ans Tageslicht, die aber vorläufig sämtlich an ihrer Stelle verbleiben mußten. Wir fanden einige sehr große Urnen, in denen kleinere Gefäße, sogenannte Tränenkrüge, und flache Schalen enthalten waren. Oft standen die Urnen zu 4 bis 5 Exemplaren in verschiedenen Größen gruppenweise, anscheinend für Familienbegräbnisse, zusammen. Zwischen den verbrannten Knochenresten im Innern fanden sich mehrfache Bronzegegenstände, eine weitere Anzahl fünfeckiger durchlöcherter Plättchen, die mutmaßlich einen Schmuck bildeten, ferner Nadeln mit kugelig gehämmertem Knopf. Vor allem aber erschienen von besonderem Wert zwei bronze, ineinander gebogene, etwa 2 Zentimeter breite, abgerundete Armspangen, in denen die Armknochenreste noch vorhanden waren. Waffen und andere Geräte wurden leider nicht gefunden.
Das Ergebnis der Ausgrabungen, die sich auf mehrere Nachmittage erstreckten, wurde als ein außerordentlich günstiges [205] bezeichnet, besonders weil sich verschiedene Formen vorfanden, die man seither noch nicht kannte.
Die Ausgrabungen wurden erst eingestellt, nachdem sich auf weitere Entfernungen keine Urnen mehr vorfanden.
Über die Stellung der Urnen zueinander mußte ich eine genaue Aufnahme machen, ehe sie fortgenommen wurden, um sie in einem Situationsplan festzulegen. Ebenso machte ich von jeder Form eine Aufzeichnung nach einem kleineren Maßstabe.
Bis zur völligen Austrocknung der Urnen blieben sämtliche Funde in meinem Bureau. Ich mußte vorsichtig mit ihnen umgehen; die Wandungen waren nämlich aus einer mangelhaft geschlemmten, grobkörnigen Tonmasse hergestellt und nicht genügend gebrannt, so daß sich beim Trocknen feine Risse bildeten. Die Gefäße waren aus freier Hand gearbeitet, aber regelmäßig geformt; Verzierungen fanden sich nicht vor, nur mit den Fingern gemachte Eindrücke an dem oberen Rande; einzelne hatten henkelartige Erhöhungen an den Seiten zum Anfassen.
Offenbar stammten die Funde aus ältester vorgeschichtlicher Zeit, der auf die Steinzeit folgenden Bronzeperiode. – Das gänzliche Fehlen von Waffen und Arbeitsgeräten ließ darauf schließen, daß es sich hier um die Begräbnisstätte eines seßhaften Hirtenvolkes gehandelt haben mochte.
Mehrfache Dubletten von den gefundenen Gefäßen wurden an das »Germanische Museum« nach Nürnberg geschickt, von dessen Direktion ich ein anerkennendes Schreiben erhielt, mit dem Exemplar einer vom Germanischen Museum herausgegebenen Zeitschrift, worin der Fund geschildert und meiner Tätigkeit bei Aufdeckung desselben gedacht wurde. (Jahrgang 1862.)
Nach der Einverleibung der Urnen in das Hannoversche Museum wurde mir durch Senator Schläger der besondere Dank seines Vereins ausgesprochen, dessen Sitzungen ich von nun ab besuchen durfte, ich machte aber keinen Gebrauch von [206] der Einladung. In meinem Baubureau, das durch die Sammlung der prähistorischen Gefäße einem kleinen Museum glich. hatte ich täglich Gäste, die sich für die Funde interessierten. – Auch der Kronprinz, in Begleitung seines Adjutanten, beehrte mich wiederholt mit seinem Besuche und besah sich alle Funde eingehend. Er ließ sich auch die Projekte zur Friedhofsanlage vorlegen und durch mich erläutern, ich mußte ihm sogar einen Situationsplan zur Gesamtanlage mitgeben, und er stellte sich die Aufgabe, nach dem Flächeninhalt der verschiedenen unregelmäßig geformten Quartiere die Anzahl der Grabstätten herauszurechnen. Nach mehreren Tagen brachte er mir das Ergebnis seiner Berechnungen, das genau mit den festgestellten Zahlen stimmte. Bei diesem, seinem letzten Besuche, besah er auch meinen Taubenschlag, zu dem er auf der Leiter hinaufkletterte. Während er nachher wieder zu Pferde saß, bat ich um die Erlaubnis, ihm eine von den lithographisch vervielfältigten Zeichnungen zum Friedhofsgebäude überreichen zu dürfen. Beim Aufrollen des großen Blattes, das ich vorzeigen wollte, scheute das Pferd etwas, es schritt zurück und kam mit den Hinterfüßen bis dicht an den Rand des offenen Brunnens. Ich sprang erschrocken zur Seite, der Kronprinz aber parierte glücklich das Pferd, darauf empfahl er sich in leutseliger Weise und ritt mit seiner Begleitung von dannen, nachdem der Reitknecht die Zeichnung an sich genommen hatte.
An einem schönen Nachmittag, während ich auf dem Döhrener Turm noch beim Kaffee saß, kam einer meiner Leute atemlos angelaufen, um mir mitzuteilen, daß die ganze königliche Familie auf der Baustelle angefahren sei, um sich die gemachten Ausgrabungen anzusehen. Ich machte mich in der Eile etwas zurecht, damit ich einigermaßen anständig aussah, und stürmte sofort hinaus nach meinem etwa 10 Minuten entfernten Bau. Ehe ich diesen jedoch erreichen konnte, sah ich die allerhöchsten Herrschaften in zwei vierspännigen Hof-Equipagen wieder abfahren; ich war natürlich sehr ärgerlich, [207] nicht an Ort und Stelle gewesen zu sein. Mein Aufseher erzählte mir, daß die hohen Herrschaften die Urnen besichtigt hätten und darauf, ohne sich weiter aufzuhalten, wieder fortgefahren seien, ich hatte also das Nachsehen. – – –
[8.8 Schwierigkeiten beim Friedhofsbau]
Mit meiner Bauausführung hatte ich von nun ab vollauf zu tun; es war eine verhältnismäßig kurze Frist gestellt bis zur Fertigstellung; ich war deshalb Tagsüber sehr in Anspruch genommen. Neben den nicht geringen zeichnerischen und schriftlichen Arbeiten im Bureau, die ich ohne Beihilfe allein zu bewältigen hatte, wurde ich auf meinem ausgedehnten Bauterrain bald hier, bald dort in Anspruch genommen, mußte anordnen, Material abnehmen, Arbeiten kontrollieren u.a. Ich war allemal froh, wenn ich abends auf dem Döhrener Turm im Kreise der Familie oder lieber Freunde meine Erholung fand. Meine Freunde aus der Stadt veranlaßte ich zum öfteren Besuch, weil ich jetzt weniger Zeit fand, mit ihnen in der Stadt zusammen zu kommen. Darunter waren auch mehrere Landsleute, Schäffer, Holzapfel, Henkel, Peilert u.a., mit denen wir drei Casselaner in freundschaftlichem Verkehr standen. Wir trafen uns allwöchentlich zu gemeinschaftlichem Kegelschieben auf einer der Kegelbahnen am Döhrener Turm. Unsern »Hessenabenden« schlossen sich auch noch andere Herren an, mit denen wir sehr gemütliche, heitere Stunden verlebten.
Jeden Sonnabend hatten die Stammgäste des Döhrener Turmes, die in einem Klubzimmer täglich abends zusammenkamen, ein gemeinschaftliches Essen, bei dem durch anregende Unterhaltung immer eine sehr animierte Stimmung herrschte. Als Hausgenosse zählte ich natürlich mit zu den berechtigten Teilnehmern; es waren meist ältere, hochachtbare Herren, von denen einige mir, dem viel jüngeren, dauernd liebe Freunde geblieben sind, so lange sie lebten; jetzt, wo ich diese Zeilen niederschreibe, sind aber längst die meisten heimgegangen. – –
Im Herbst 1863 sollte die Friedhofsanlage nach den Intentionen des Magistrats fix und fertig hergestellt werden; hiernach hatte ich mich zu richten. Die gesamte Anlage war [208] auch so flott vorwärts gekommen, daß der Termin zur feierlichen Eröffnung festgesetzt werden konnte. Die Bauwerke waren bereits abgenommen; bei der Ausführung der inneren gärtnerischen Anlage aber stellten sich unerwartete Schwierigkeiten heraus, deren Beseitigung einen größeren Zeit- und Kostenaufwand erforderten und den festgestellten Termin in Frage stellten. Zur planmäßigen Einebnung der etwa vierundzwanzig Morgen großen inneren Fläche mußte das höhergelegene Terrain abgetragen werden, um die tieferliegenden Flächen damit aufzufüllen. Die geringe Ackerkrume, die sich im Laufe der Jahrhunderte gebildet hatte, kam durch diese Auffüllung auf die angewachsenen Flächen zu liegen. Es entstanden also Ungleichheiten im Boden, beim Abtragen kam kahler Sand zutage, bei der Auffüllung lagerte aufeinandergeschichteter, humusreicher, durchwachsener Boden. Der Ausbau der breiten Wege zwischen den Begräbnisquartieren und Anlagen machte bei der verschiedenen Bodenbeschaffenheit endlose Arbeit und Quälerei. Auf dem abgetragenen Teile mit bloßgelegtem Sandboden wurden die eben fertiggestellten Wege bei trockenem, stürmischem Wetter durch Flugsand wieder verweht, bei dem größeren Teile dagegen wucherte durch die bereits befestigten Wege in üppiger Fülle das Queckengras immer von neuem wieder hervor. Nach einigen Tagen Regenwetter waren die Wege ebenso grün wie die Quartiere, alles Abschürfen war vergeblich. Ich war rein verzweifelt, bei aller Mühe und Arbeit konnte ich die Anlagen nicht ordnungsmäßig herstellen. Ich mußte meinem Chef von den mißlichen Verhältnissen Mitteilung machen, denn durch die wiederholt vorgenommenen Arbeiten war der vorgesehene Etat bereits überschritten. Ohne eine Nachverwilligung für gründliche Beseitigung der Quecken konnte und wollte ich nicht fortarbeiten lassen. Die einzige Möglichkeit, die Quecken zu beseitigen, sah ich in dem gründlichen Herausreißen der den Boden durchziehenden Wurzeln, das aber mit der Hand geschehen mußte. Droste stimmte meinem Vorschlage zu und genehmigte, daß [209] ich das Übel auf diese Weise gründlich beseitigte; er wolle für die Notwendigkeit der erforderlichen Mehrausgabe eintreten. Ich schaffte nun eine Anzahl hölzerner flacher Mulden an, ein Teil der Arbeiter sammelte in diese die nach tiefer Umgrabung gelockerten, mit der Hand herausgezogenen Wurzeln, welche in Mengen auf einen großen Haufen zusammengetragen wurden. Die Arbeit war mühsam und zeitraubend, aber die Wege blieben danach rein, so daß die Anlage bei der Eröffnung einen guten Eindruck machte. Die durch diese Arbeiten verursachten Mehrkosten waren allerdings beträchtliche geworden. In einer öffentlichen Sitzung des Magistrats, in der die Verwilligung der erheblichen Überschreitung der Kosten für die Friedhofsanlage auf der Tagesordnung stand, wurde mir, dem Bauführer, alle Schuld in die Schuhe geschoben und der Vorwurf der Pflichtvergessenheit gemacht; mein Name wurde dabei in dem in den Zeitungen veröffentlichten Bericht über die Sitzung der städtischen Behörden genannt. Ich war über die mir hierdurch zugefügte Schmach außer mir, ich fühlte mich gebrandmarkt und wollte mich öffentlich rechtfertigen. Droste, der in der Sitzung nicht zugegen war, war ebenfalls empört über die durchaus unberechtigte, herabwürdigende Kritik, hielt mich aber zurück; er übernahm es, mich zu verteidigen, indem er die schwierigen, unvorhergesehenen Verhältnisse klarlegte und mit voller Verantwortung für mich eintrat.
Die Folge von dem Ärger und der inneren Erregung über die öffentliche, ungerechte Herabsetzung war, daß ich krank wurde und die Gelbsucht bekam. Alle meine Freunde, besonders die im Kongreß, suchten mir meine trüben Gedanken, die ich mir in den Kopf gesetzt hatte, auszureden, ich war eine Zeit lang förmlich menschenscheu und wagte mich in keine Gesellschaft.
Der Herzensgüte meines wohlwollenden Chefs habe ich es zu danken, daß der Alp, der auf meinem Gemüt lastete, mir wieder genommen wurde. Beim Eröffnungsessen, das zur Einweihung des neuen Saales auf dem Döhrener Turm, dessen [210] Umbau ich nebenher zu leiten hatte, stattfand, waren auch die städtischen Behörden vertreten, darunter der Stadtdirektor Rasch, mehrere Senatoren und Bürgervorsteher; außerdem nahmen teil Baurat Droste, einige meiner Kollegen vom Stadtbauamte und viele meiner Freunde. Ich selbst wollte mich meiner gedrückten Stimmung wegen fernhalten, befand mich auch schlecht und war gelb wie eine Zitrone. Droste aber bestand darauf, daß ich an dem Eröffnungsessen teilnahm; ich mußte mich ihm gegenüber setzen. Während der Tafel nahm Droste das Wort, er erwähnte, daß die Leitung des Saalumbaues neben der des Friedhofsbaues mir unterstellt gewesen sei und sprach sich als mein Vorgesetzter über beide Bauten anerkennend aus. Er kam in seiner Rede auf die Veröffentlichung in den Zeitungen, auf die ungerechten Vorwürfe, die mir gemacht seien, und trat mit warmen Worten für mich ein. Dann redete er mich persönlich an, ich möge mir die Sache nicht so zu Herzen nehmen und über das einmal Geschehene hinwegsehen; mit dem Gefühl, nur meine Schuldigkeit getan zu haben, möge ich für meine Widersacher beten lernen: »Herr, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun.« Nach dieser Rede, die mich tief ergriffen hatte, kamen die anwesenden Herren der städtischen Behörden sämtlich zu mir und drückten ihr Bedauern aus, ebenso beglückwünschten mich meine Freunde über die glänzende Rechtfertigung durch meinen Vorgesetzten. Droste hatte den Schluß seiner Rede eigens für mich niedergeschrieben und übergab mir das Schriftstück; ich dankte ihm für sein Vertrauen und das wohlwollende persönliche Eintreten für mich. Ich hatte diese Niederschrift früher stets gut verwahrt; später ist sie bei den vielen Umzügen abhanden gekommen, damit ist ein für mich wertvolles Erinnerungszeichen an den edlen Mann, dem ich so viel zu verdanken habe, verloren gegangen.
[8.9 Fertigstellung des Friedhofs, neue Bauten, Umzug]
Obgleich die unvorhergesehenen Mehrarbeiten an der Friedhofsanlage eine geraume Zeit in Anspruch genommen hatten, konnte doch die Eröffnung des Friedhofes im Herbst [211] 1863 erfolgen. Ich hatte nur noch die Abrechnung über die gesamte Anlage fertigzustellen, damit war meine Tätigkeit an diesem Bauwerk vollendet. –
Von nun an wurde ich wieder auf dem Stadtbauamte beschäftigt. Die nächste Aufgabe, die mir übertragen wurde, war die Durcharbeitung und Detaillierung der Pläne zum Neubau einer zweiten Mittelschule vor dem Klevertore. Die Baustelle dieser Schule grenzte unmittelbar an den Stadtbauhof, auf dem das Bureaugebäude des Stadtbauamtes lag. Eine besondere Bauführerstelle für diesen Bau war nicht vorgesehen, Kollege Ratkamp überwachte die Ausführung, die zeichnerischen Arbeiten lagen mir ob. Später hatte ich auch die Stadt-Töchterschule am Friederiken-Wall zu bearbeiten, außerdem eine Fülle laufender Arbeiten, sodaß ich über Mangel an Arbeit nicht zu klagen hatte.
Unter den veränderten dienstlichen Verhältnissen, die mich von nun ab dauernd an die Stadt fesselten, war ich leider genötigt, meine schöne Wohnung auf dem Döhrener Turm, mit ihren vielen Annehmlichkeiten, aufzugeben. Es wurde mir recht schwer, aus der behaglichen Häuslichkeit, dem frischen Waldesgrün, der friedlichen Ruhe, fern vom tosenden Getriebe der Stadt, scheiden zu müssen. Doch hatten sich meine Beziehungen zu den Bewohnern des Döhrener Turmes so herzlich gestaltet und befestigt, daß ich mich damals schon als ein Mitglied der Familie betrachten konnte, und deshalb von nun ab, auch nach dem Verziehen in die Stadt, meine Verbindung mit der Familie Buerdorf weiter dauernd fortsetzte. Ich pilgerte, wenn mich nicht anderweite Abhaltungen hinderten, abends und Sonntags nach dem Turm, es mochte wettern, stürmen, regnen oder schneien, ich mochte noch so müde und abgespannt sein, es zog mich hinaus, um einige Stunden in dem mir so lieb gewordenen Familienkreis zu verleben. Ich hatte stets einen weiten Weg von 1 ¼ Stunde und wieder zurück zu marschieren, so weit entfernt war mein neues Quartier von Döhrener Turm, das ich in der »Langenlaube« auf der entgegengesetzten Seite der Stadt bezog.
[212] 9. In der »Langenlaube«.
[9.1 Wohnung bei Familie Jansen]
Die »Langelaube«, die Verbindungsstraße zwischen dem Georgenwall in der Stadt und dem Georgen-Park, beziehungsweise Herrenhausen, hatte zu meiner Zeit eine laubenartig gehaltene, gleichmäßig in etwa 4–5 Meter Höhe geschnittene Linden-Allee, die später entfernt wurde; nur der Name erinnert noch an den früheren Zustand dieser Straße. Die Häuser standen meist getrennt von einander, umgeben von größeren Gärten. Eins dieser Häuser gehörte dem Rentier Jansen, einem Verwandten der Familie Tidow, mit dem ich in freundschaftlichen Beziehungen stand. Jansen, ein schon bejahrter Herr, bewohnte mit seiner unverheiratet gebliebenen Tochter Marie das Hochparterre in seinem Hause. Bei Gelegenheit eines Besuchs bei Jansens kam die Rede darauf, daß ich wieder in die Stadt ziehen und meine schöne Wohnung auf dem Döhrener Turm aufgeben müsse. Ich erkundigte mich, ob in der Langenlaube nicht eine Wohnung zu haben sei; in dieser Lage, mit dem Blick ins Grüne, würde ich mich wohler fühlen wie in der engen Stadt, weil ich durch mein Wohnen im Freien etwas verwöhnt sei. Fräulein Jansen meinte, es ließe sich einrichten, daß ich bei ihnen wohnen könnte; sie hätten immer schon den Wunsch gehabt, an einen jungen Mann von ihrer großen Wohnung etwas abzuvermieten, um nicht so ganz allein zu sein; ich würde ihnen als Hausgenosse sehr willkommen sein, weil sie mich schon kennen gelernt hätten. Ich nahm dies freundliche Anerbieten mit vielem Dank an und war glücklich, auch hier wieder Anschluß an eine nette Familie gefunden zu haben, und siedelte alsbald über. Mein Quartier bestand aus zwei [213] Räumen, einem Wohn- und einem Schlafzimmer, die durch ein Vorzimmer von der übrigen Wohnung getrennt waren; von diesem hatte ich den Blick in den Garten und auf die Straße. Die verhältnismäßig ruhige Lage – die Langelaube war keine eigentliche Verkehrsstraße –, die freie, luftige Umgebung entschädigten mich einigermaßen für das, was ich seither draußen auf dem Döhrener Turm gehabt hatte. Vater Jansen und seine Tochter waren feine, liebenswürdige Menschen, die in freundschaftlicher Weise mir den Aufenthalt in ihrem Hause möglichst angenehm zu machen suchten und mich gut verpflegten – ich hatte volle Pension –, sodaß ich mich bei ihnen wohl geborgen fühlte.
Das Wohnen in der Langenlaube war dadurch sehr interessant, weil man manches Schauspiel vom Fenster aus genoß, das man in anderen Straßen nicht in dem Maße haben konnte, wie hier. Der Verkehr zwischen Herrenhausen und der Stadt führte über diese Straße; alles, was mit dem königlichen Hofe zusammenhing, mußte auf dem Wege zur Stadt die Langelaube passieren. Ich sah die Majestäten und fürstliche Personen öfters und in allen möglichen Auffahrten Eine besondere Augenweide für die Anwohner war das schöne militärische Bild, das ihnen öfters geboten wurde beim Vorbeiziehen der Hannoverschen Garde du Corps. Die Kaserne dieser stolzen Elite-Kavallerie lag am Königsworther Platz vor dem Georgen-Garten, auf den die Langelaube ausmündete. Ich habe sie oft bewundert, diese stattlichen Gestalten, wenn sie vorbeiritten auf ihren ausgesucht schönen, wohlgepflegten Pferden, kräftigen, dabei doch feingliedrigen Tieren hannoverschen Schlags. Dem Regimente voran ritt die vorzügliche Garde du Corps-Kapelle auf herrlichen Rappen, wovon einer wie der andere ohne Abzeichen war. Auf diese Militär-Kapelle hielten die Hannoveraner besonders große Stücke, und das mit Recht; an ihrer Spitze stand der vorzügliche Stabstrompeter Sachse, eine der populärsten Persönlichkeiten der Stadt. Im Odeon, dem größten Konzertetablissement, [214] spielte die Kapelle abends unter der Leitung Sachses, der die vorkommenden Solis auf seiner silbernen Trompete in virtuoser Weise zum Vortrag brachte und damit jedesmal stürmischen Applaus erzielte. Sachse, besonders zu Pferde, eine reckenhafte Gestalt, ritt in seiner schmucken Uniform, die Brust voller Orden, seiner Kapelle voraus, sein Selbstbewußtsein mit einer gewissen Koketterie zur Schau tragend, und fiel zwischendurch mit seiner silbernen Trompete in die Musik ein. Eine Anzahl Märsche, die oft vor meinem Fenster vorbei geblasen wurden, habe ich mir gemerkt und spiele sie gern noch auf dem Klavier.
[9.2 Überarbeitung]
Der kommende Winter verlief ohne besonders bemerkenswerte Ereignisse. Tagsüber war ich reichlich in Anspruch genommen durch meine Beschäftigung auf dem Stadtbauamte; ich war während der Bureaustunden ununterbrochen zeichnerisch tätig und kam nur selten vom Zeichenbrett. Abends suchte ich meine Erholung auf dem Döhrener Turm im traulichen Kreise der Familie Buerdorf, oder ich kam mit lieben Freunden im Kongreß zusammen.
Wie alle meine Freunde kam ich fast nie vor Mitternacht nach Hause; ich kam mir ordentlich solide vor, wenn ich mal nachts vor 1 Uhr schlafen ging, meistens wurde es noch später. Hannover war nämlich, und ist es wohl noch immer, in Bezug auf das Nachtleben vielen anderen Großstädten voraus, es rangiert nahe hinter Berlin. Wenn ich vom Döhrener Turm gegen 11 Uhr nachts in die Stadt zurückkam, kehrte ich stets noch einmal hier oder da ein, wo ich noch Freunde und Bekannte zu finden wußte. Diese Lebensweise behagte mir gar nicht, mir war am andern Morgen, besonders nach einer größeren Kneiperei, oft jämmerlich zu Mute, aber ich mußte mit dem Strome schwimmen und mitmachen, wenn ich nicht als Philister erscheinen wollte, und dazu habe ich eigentlich nie das Zeug gehabt. Freilich mußte mein Allgemeinbefinden bei dieser Lebensweise Schaden leiden, ich fühlte mich nicht wieder so wohl wie vordem, ehe mich der [215] Ärger über die Friedhofsaffäre krank machte; ich sah blaß und angegriffen aus und wurde von meinen Bekannten, die mich nicht für recht gesund hielten, bedauert. Trotz alledem aber machte ich alles mit, was sich mir bot.
[9.3 Harzreise-Pläne]
Auch meinem Chef fiel mein dauernd schlechtes Aussehen auf, das sich seit dem erwähnten Vorfall kaum gebessert hatte. Er riet mir, mich von allen Vergnügungen und Aufregungen fern zu halten; aber wer dies am wenigsten fertig brachte, war ich. Daß die steten Arbeiten auf dem Bureau, wobei ich krumm vor dem Zeichenbrett sitzen oder stehen mußte, mir unter diesen Verhältnissen nicht gut bekamen, war begreiflich. Droste, dessen Güte und Wohlwollen ich mal wieder in hohem Maße erfahren sollte, riet mir dazu, mich einige Wochen auszuspannen und zu meiner Erholung ins Gebirge zu gehen, den Urlaub hierzu würde er bewirken. Ich mußte ihm aber erwidern, daß ich keine genügenden Mittel besäße, um mir diesen Luxus zu erlauben; da erklärte der herzensgute Mann, daß er mich mitnehmen wolle als Begleiter auf seiner mehrwöchentlichen Urlaubsreise, die er durch den ganzen Harz zu unternehmen beabsichtige; er wollte nur zu Fuß wandern, um an seiner Wohlbeleibtheit etwas zu verlieren. Das war ein Anerbieten, so überaus gütig, daß ich befangen war, es anzunehmen. Droste aber nahm keine Einwendungen an, er bestand darauf, ich mußte mit.
Es traf sich aber so, daß der Quartettverein-Kongreß zur selben Zeit vorhatte, eine Sängerfahrt in den Harz zu machen, die ich nicht aufgeben mochte. Schon lange wurde im Kongreß von dieser ersten gemeinsamen Vergnügungsreise geredet, die nun endlich fest bestimmt war. Ich teilte dies meinem Chef mit. Droste ging auch bereitwillig darauf ein, unsere gemeinschaftliche Reise so einzurichten, daß ich erst die Sängerfahrt mitmachen konnte, an die sich unsere Fußwanderung direkt anschließen sollte. Er machte einen Reiseplan derart, daß die Punkte, die ich mit dem Kongreß bereits besucht hatte, nicht zum zweiten Male besucht wurden. So hatte ich es der [216] opferbereiten Großmut meines Vorgesetzten zu danken, daß ich diese herrliche, mir stets unvergeßlich bleibende Reise in den Harz, der so reich ist an erhabenen Naturschönheiten, machen konnte. Über den Verlauf dieser meiner ersten größeren Reise will ich eine etwas ausführlichere Schilderung hier folgen lassen.
[9.4 In Musikerrunde nach Quedlinburg]
Wir fuhren im »Kongreß« zu etwa 16 Personen mit der Eisenbahn nach Quedlinburg. Unsere Zusammengehörigkeit wurde äußerlich kenntlich durch die gleiche Kopfbedeckung, wir trugen sämtlich grüne Garibaldi-Hüte, die damals sehr beliebt waren. Die Kongreßkapelle, bestehend aus acht Mitgliedern die ein doppelt besetztes Trompetenquartett der kleinen abgestimmten Leschhornschen Trompeten bliesen – ich hatte diese Instrumente für den Kongreß aus Cassel besorgt und das Blasen einstudiert – ging stets an der Spitze der Sängerschar, flotte Märsche blasend. Mit diesem ungewohnten, eigenartigen Musikkorps machten wir überall Furore und erweckten damit Heiterkeit, wohin wir kamen. In solcher Weise zogen wir auch in Quedlinburg ein und nahmen unser Quartier im »Hotel zum Bären«. Wenn schon auf der Fahrt hierher die ausgelassenste Stimmung herrschte, so kam doch jetzt, wo wir das erste Reiseziel erreicht hatten, der Übermut zur vollsten Geltung. Fidelere Gäste hatte das Hotel wohl selten gesehen, dazu unser vortrefflicher Männergesang, ulkige Vorträge unserer komischen Talente, an erster Stelle Heinrich Schrader, alles dies brachte uns und die Gäste in die heiterste Stimmung, die bis in die tiefe Nacht hinein anhielt. Der Höhepunkt war zum Schluß der Tanz der »wilden Männer« auf dem großen Korridor, an dem unsere Schlafzimmer lagen. In der warmen Sommernacht führte eine Anzahl von uns, völlig entkleidet, nur umgürtet mit Bettvorlagen, diesen improvisierten Tanz auf, der durch seine tollen Kapriolen zwerchfellerschütternd wirkte.
[9.5 Suderode, Stubenberg, Georgshöhe, Hexentanzplatz]
Am anderen Morgen, nach wenigen Stunden Schlafs, Fortsetzung der heiteren Scherze bei frohem Liederklange. [217] Beim Abschied vom Hotel und seinen Gästen trugen wir einige Quartette tadellos vor und marschierten, die Kapelle voraus, über Suderode nach dem Stubenberge. In Suderode verabschiedeten wir vor dem dortigen Hotel mit Sang und Trompetenklang einen Herrn aus Magdeburg, der sich angeschlossen hatte und den wohlriechenden Namen »Käsemacher« führte. Nach kurzer Rast gings zur Lauenburg, wo gefrühstückt wurde. Dort sang oben aus den Zweigen eines Lindenbaumes unser Heldentenor, Philipp Meyer, das schöne Solo zu dem von uns gern gesungenen Molkschen Quartett »Muntrer Bach, was rauschst du so« – solche Stimmen hört man jetzt nur noch selten! Dann gings über die Georgshöhe nach dem Hexentanzplatz! Eine größere Überraschung hatte ich bis dahin noch nicht erlebt, als ich, nach dem Marsch über die grünen Waldwiesen zwischen hohen dunklen Tannen hindurch, hinter dem Wirtshaus des Tanzplatzes hervortretend, plötzlich vor der jäh abstürzenden gigantischen Felsenschlucht des Bodetales stand, gegenüber die Roßtrappe. Diese grandiose Natur machte einen so gewaltigen Eindruck auf mich, der ich solche mächtige, turmhoch aufsteigende Felsengebilde noch nie gesehen hatte, daß ich vor Andacht hätte auf die Knie sinken mögen. Es war allseitig ein Aufruf des Staunens und der freudigen Bewunderung, als wir den ersten Anblick des wildromantischen Tales der tief unter uns wie ein silbernes Band sich hinschlängelnden Bode vor uns hatten, deren tosendes Rauschen wir hoch oben auf der Felsenhöhe des Tanzplatzes hören konnten, die Menschen dagegen mit dem bloßen Auge nur als kleine winzige Pünktchen erkennend. Eine heilige Stimmung muß jeden überkommen, der solch ein Bild zum ersten Male so zu sehen bekommt, wie ich es sah, diese malerische Wildheit der Felsen bei herrlichstem, klarstem Wetter, gebadet in goldigen Sonnenschein. So oft ich später den Tanzplatz besucht habe, selbst nach öfteren Besuchen der Schweiz und Tirols, jedesmal war ich von neuem begeistert, besonders durch die Erinnerung an diesen ersten überwältigenden Eindruck.
[9.6 Bodetal, »Schurre«, Roßtrappe]
[218] Nach längerem Aufenthalt an diesem herrlichen Punkt, gestärkt durch einen Mittagsimbiß, gings steil hinunter ins Bodetal zum »Waldkater«, ein Abstieg, der die Knie klapperig gemacht hatte, als wir unten angekommen waren. Wir erholten uns in der kühlen Luft des schattigen tales am Ufer der mit Getöse über mächtige Felsblöcke wild hinabstürzenden, schäumenden Bode, machten dann einen Gang bis zum Bodekessel und stiegen nachher die »Schurre« hinauf zur Roßtrappe, eine Arbeit, die uns den Schweiß aus allen Poren heraustrieb. Jetzt ist die »Schurre« durch ausgebaute Serpentinwege bis oben hin bequem zu besteigen; diese Wege bestanden aber damals noch nicht, es hieß, von einem Felsen auf den andern wohl über eine Stunde in die Höhe zu kraxeln, bis man erschöpft oben ankam. Es war eine tüchtige Leistung, diese Tour von Quedlinburg bis zur Roßtrappe, die ich bei meiner reduzierten Körperbeschaffenheit vorher kaum zu bewältigen glaubte. Aber die reine kräftige Gebirgsluft wirkte geradezu Wunder bei mir, ich fühlte mich so frisch und gestärkt, wie es lange Zeit nicht der Fall war. Im Hotel auf der Roßtrappe hatten wir Quartiere bestellt, sonst hätten wir kein Unterkommen gefunden, bis auf den letzten Platz war das Haus besetzt.
Bei einem vortrefflichen vorausbestellten Souper entwickelte sich nach den überstandenen Strapazen bald die altgewohnte Kongreßstimmung, die auch sehr anregend auf die vielen Gäste aus allen Weltgegenden einwirkte. Nach dem Essen setzten wir uns auf die Terrasse vor dem Hotel, von der man einen herrlichen Blick nach Thale und in die dahinter liegende Landschaft hat, und ließen stimmungsvolle Lieder erschallen. Die reine kräftige Höhenluft wirkte so günstig auf unsere Stimmen, daß wir sämtlich vorzüglich disponiert waren und tadellos sangen. Unsere Lieder in der herrlichen Gottesnatur riefen bei unseren Zuhörern eine wahre Begeisterung hervor, die stets in stürmischem Beifall zum Ausdruck kamen.
[219] Dem Gesang folgte ein drolliger Ulk, den Freund Schrader anregte und inszenierte. Wir improvisierten eine Vorstellung des Zirkus Renz, welcher derzeit gerade in Hannover längere Zeit seine equilibristischen Künste zur Schau brachte. An einer freien Stelle der Terrasse wurde eine Manege gebildet durch zwei Reihen Stühle für die Zuschauer, die kreisrund zusammengestellt waren. Schrader verteilte die Rollen, er selbst war der Direktor Renz, einige andere machten die vier in der Freiheit »frisierten Hengste«, Louis Jänecke war Schulreiter, er ritt die hohe Schule auf einem Besenstiel; Gesangfreund Menke, ein hübsch gewachsener Kerl mit glattem mädchenhaftem Gesicht, kopierte die berühmte Künstlerin »Miß Zephora«, einige machten Athleten usw. Wir Trompetenbläser bildeten das Orchester, die übrigen taten Dienste in der Manege mit Rechen und Besen. Der Wirt und einige Gäste beschafften uns die nötigen Requisiten, so daß die Vorstellung bald beginnen konnte, zu der die Gäste mit großem Spektakel marktschreierisch eingeladen wurden, auf den Stühlen Platz zu nehmen. Zuerst spielten wir zwei Musikstücke auf unseren kleinen Instrumenten, eine Leistung, die Staunen und Heiterkeit erregte; dann trat »Direktor Renz« in die Manege, bekleidet mit hohen Schaftstiefeln, enganschließender, weißer, baumwollener Unterhose, weißer Weste, in schwarzem Frack und Zylinder, in der Hand eine Peitsche, sich vor dem über die Erscheinung laut auflachenden Publikum verneigend. Auf einen Knall mit der Peitsche erschienen die vier in der Freiheit »frisierten Hengste«, die am Kopfe mit rotseidenen Schleifen geschmückt, in die Mariege geführt wurden und in allen Gangarten darin herumtrabten oder -galoppierten, über Bretter sprangen und Ronden gingen, je nach dem Kommando Schraders, der vorzüglich den Direktor Renz nachzuahmen verstand. Wenn eines der zweibeinigen Schulpferde nicht parierte, wurde ihm mit der Peitsche nachgeholfen, eine Mißhandlung, über die sich die »Schulpferde« nach der Vorstellung bitter beklagten. Dann kam eine Glanznummer – die hohe Schule [220] – die Freund Jänecke ebenfalls im Frack, Zylinder und weißer Unterhose auf dem Vollblut-Besenstiel ritt; schweißtriefend trat er nach wiederholten Hervorrufen der freudig erregten Zuschauer ab. »Miß Zephora« folgte dann. Freund Menke als solche tanzte, nur mit einer Krinoline bekleidet, oben tief dekolletiert, in weißen Strümpfen (solche wurden damals von allen Damen getragen) und Tanzschuhen auf dem Seile mit einer Balancierstange. Das Seil wurde dargestellt durch eine schwanke Bohle, die mit den Enden auf 2 Stühlen festgenagelt wurde. Auch diese Leistungen, wie die einiger Athleten, die mit leichten Gegenständen die größten Kraftanstrengungen nachahmten, wurden durch Beifall gewürdigt. Als Schlußnummer kam, wie im Zirkus Renz, der berühmte Löwenbändiger Batty mit seinen sieben Löwen. Batty gab seine Vorstellungen damals bei Renz in einem großen, ringsum vergitterten Wagen, der in die Marege gefahren wurde. Um diese Nummer ähnlich der im Zirkus darzustellen, wurde aus der Wagenremise des Hotels ein Omnibus in die Manege geschoben, in dem unsere Mitglieder saßen, die durch mörderisches Brüllen den Löwen nachahmten, was sie so vorzüglich fertig brachten, daß sie am anderen Tage völlig heiser waren. Wie der Wagen mit den Bestien in der Manege stand, kam »Batty Schrader«, völlig in Trikot, d.h. weiße Unterhose und Unterjacke, darüber eine rote anschließende Badehose, gekleidet, und mit einer Reitpeitsche in der Hand, öffnete den Wagenschlang und sprang tollkühn in den Wagen zwischen die Bestien, die er mit der Reitpeitsche verarbeitete, daß sie Au und Weh schrieen; dann ließ er sich eine Pistole geben, die mit Pulver geladen war, und knallte einen Schuß los; darauf verließ er, nachdem die Löwen infolge des Schusses plötzlich ruhig geworden, wie der Original-Batty unter dem stürmischen Beifall des herzlich lachenden Publikums den Omnibus-Käfig. Damit war die Vorstellung zu Ende.
Der Scherz war aber so sehr gelungen, daß die Gäste sich königlich amüsiert hatten; eine Anzahl Damen machte [221] aus zusammengesteckten Syringenblättern Kränze, die uns auf den Kopf gesetzt wurden. Der Wirt ließ die Terrasse mit Buntfeuer bengalisch beleuchten. Zum Andenken an den so köstlich verlebten Abend sammelten die Gäste ihre Visitenkarten, die uns mit einer Ansprache unter Versicherung des Dankes feierlich überreicht wurden. Über unsern Aufenthalt und den schönen Abend auf der Roßtrappe erschien in einer Zeitung ein Artikel, der, voll des Lobes sowohl über unsern trefflichen Gesang wie unsern Humor, einen Gruß an uns brachte; auch wurden uns Dankesbriefe nachgesandt.
Tags darauf, früh morgens, war alles wieder munter, aber wir hatten Not, unsere Stiefeln zu finden, die durch einen Schelmenstreich überall von den Türen verwechselt waren. Es war ein Hin- und Herrennen auf den Gängen im tiefsten Negligé, sogar einige Gäste mußten sich den Schabernack gefallen lassen. Unter Schimpfen und Fluchen kamen die Stiefel endlich an ihre Herren, den Gauner aber hatte keiner verraten.
[9.7 Blankenburg, Wernigerode]
Den Morgenkaffee genossen wir beim schönsten Wetter im Freien auf der Terrasse. Dann rüsteten wir uns zum Abmarsch, sangen noch einige Lieder und verabschiedeten uns mit einem musikalischen Hoch von den Gästen und der schönen Roßtrappe. Begleitet von den besten Wünschen der zurückbleibenden Gäste, besonders liebreizender Damen, zogen wir, die Musik voraus, einen Marsch blasend, von dannen und marschierten nach Blankenburg; dort trafen wir gerade ein, als die Kirche aus war – es war ein schöner Sonntagmorgen – ; wir wollten hier Frühstücksstation machen, vor allem aber uns rasieren lassen, um sonntagsmäßig zu erscheinen. Wir kehrten, wir immer, mit Musik in einem Hotel ein, das an einem etwas ansteigenden freien, gepflasterten Platze liegt, und ließen uns vor dem Hotel, in einer Reihe nebeneinander sitzend, einseifen und von mehreren Barbieren rasieren, ein Schauspiel, durch das sich die liebe Straßenjugend in Scharen vor unserem Hotel versammelte. Um den Kindern eine Freude zu machen, [222] kauften wir einen Posten Konfekt in einer benachbarten Konditorei. Zur Verteilung mußten die Kinder einen Zug zu zwei nebeneinander gehend, bilden, und dann in einer Polonäse unter Vormarsch unseres Trompeterkorps an Schrader vorbeiziehen, der jedem Kinde etwas Konfekt in die Hand drückte. Der Aufzug der Kinder lockte natürlich eine Menge Menschen vor unser Hotel, denen wir einige Lieder zum besten gaben. – Nach eingenommenem Mittagsmahl besahen wir uns die Stadt und gingen hinauf an das hoch über der Stadt liegende herzogliche Schloß, zu dem ein schön gepflasterter Fahrweg führt. Wir genossen von der Schloßterrasse den herrlichen Blick über die Stadt nach dem Regenstein, der Teufelsmauer und in die weitere Umgebung und ließen uns darauf gemeinschaftlich photographieren. (S. Abbild.)
[Zwischen den Seiten 222 und 223:]

Von links nach rechts.
Stehend: Conradi, Freyer, Hennies, Magnus, Molk, Knölcke, Jänecke, Schmidtmann, Feise, Spiegelberg, Harzführer.
Sitzend: Körtling, Meyer, Schomburg, Cohn. –
Liegend: Rangenier, Schrader.
In Blankenburg nahmen wir uns vier Wagen und fuhren nach Wernigerode, in das wir ebenfalls wieder mit Musik einzogen. Vor der Stadt wurde vor jedem der Wagen eines der Pferde bestiegen; so erregte der Einzug unserer lustigen Sängerschar auch hier, wie überall, freudiges Aufsehen. Wir fuhren vor dem »Hotel zum weißen Hirsch« vor und nahmen dort Quartier. Einige Touristen von der Roßtrappe waren schon vor uns im »Weißen Hirsch« eingetroffen und begrüßten uns. Unser Einzug hatte eine zahlreiche Gefolgschaft, die sich vor dem Hotel aufhielt, um uns singen zu hören. Nach heiterem Mahle, das wir im Freien einnahmen, wurde ein förmliches Konzert veranstaltet, es wurde im Chor und Solo gesungen und unser Trompetenprogramm heruntergeblasen, so daß dieser Abend sich dem vorhergehenden würdig anschloß. Der Bürgermeister von Wernigerode war unter den Gästen des Hotels, er gestattete, daß nach eingetretener Dunkelheit das gegenüber liegende Rathaus bengalisch beleuchtet wurde. Unsere kleine Schar brachte es bei der ausgelassenen Fröhlichkeit fertig, daß die zahlreichen Sonntagsgäste sich auf dem Rathausplatze in großer Menge ansammelten und mit ihrem Beifall nicht kargten.
[9.8 Mit dem Chef Droste ab Seesen nach Grund]
Am anderen Tage, dem letzten im Reiseprogramm, wurde zeitig aufgebrochen; wir fuhren nach Ilsenburg, machten einen [223] Abstecher ins Ilsetal und dann nach Harzburg; in Harzburg sollte Schluß gemacht werden. Ich konnte nur bis zur Ankunft daselbst mit meinen Freunden zusammen bleiben und mußte nich nun von ihnen trennen, um mit der Bahn nach Seesen zu fahren, wo ich, wie verabredet, mit meinem Chef zusammentreffen wollte.
Dieser erste Teil meiner Harzreise war nun abgeschlossen; Erholung hatte er mir nicht gebracht, nur stete, aber freudige Aufregung, verbunden mit Schlemmen und Kneipen, dabei wenig Schlaf. Ich war froh, von jetzt ab mit dem alten Herrn bei tüchtiger Bewegung in der kräftigen Gebirgsluft solider leben zu können.
Bald nach meiner Ankunft in Seesen traf auch der Zug von Hannover ein, mit dem ich Droste erwarten sollte; er freute sich, daß ich ihn empfing. Wir pilgerten, ein jeder sein Ränzel auf dem Rücken, sofort los nach Grund, der ersten Station unseres gemeinschaftlichen Nachtquartiers, das wir im »Hotel zum Rathaus« bezogen. Grund, heute ein besuchter Kurort mit schöner waldreicher Umgebung, war damals ein stilles Harzstädtchen, dessen Bewohner größtenteils als Bergleute in den benachbarten Erzgruben beschäftigt waren. Für Touristen waren die steil aus einer bewaldeten Bergkuppe in der Nähe der Stadt hoch hervorragenden Doppelfelsen, der »Hübichenstein«, sehenswert. In meinem Tagebuch, das ich mir für die Reise eingerichtet hatte, nahm ich eine Skizze von diesen Felsen auf.
Im Hotel bewohnten wir ein Zimmer mit zwei Betten; wir reisten zusammen wie Vater und Sohn, immer zusamenwohnend.
[9.9 Clausthal, Grubenbesichtigung]
Nach diesmal gründlich durchschlafener Nacht erhoben wir uns zeitig – Droste war ein Frühaufsteher – um unsern Marsch nach Clausthal in der Morgenfrische anzutreten. Wir kamen über verschiedene Hütten- und Pochwerke, worin die Blei- und Silbererze aus den Clausthaler Gruben verhüttet werden. In Clausthal fanden wir ein festliches Treiben vor, [224] Tags vorher war nämlich der »Ernst-August-Stollen«, ein großer gemauerter Wasserabzugsstollen, der die Gewässer aus den Clausthaler Gruben, von der Grube Caroline ausgehend, ableitet, fertiggestellt. Dieser Stollen war für die damalige Zeit ein ganz hervorragendes Bauwerk; in Gittelde, einem Dorfe bei Grund, mündete der gewaltige Stollen aus, ein architektonischer Bau, wie bei einem Tunnelportal, bezeichnete die Ausflußstelle, aus der das Gebirgswasser in der Stärke eines ziemlich bedeutenden Baches herausströmte und von einem Nebenflüßchen der Leine aufgenommen wurde; der Stollen ist mit einem Boot befahrbar. Von einem Berg-Ingenieur, den wir im Rathaushotel kennen lernten, wurden wir zur Befahrung der Grube Caroline eingeladen. Es gehörte eine gewisse Überwindung dazu, in die Tiefe hinabzufahren, ich wagte es, Droste blieb aber oben. Ich »fuhr« mit dem sogenannten »Kunstgestänge« hinab; dieses besteht aus zwei senkrecht nebeneinander herlaufenden Balkengerüsten, die durch mechanische Kraft sich abwechselnd herab und herauf bewegen. An diesen Gerüsten sind alle 3–4 Meter Trittbretter, für einen Mann ausreichend, angebracht, die nach außen mit einem Gitter eingefaßt sind, so daß man nicht herabfallen kann. Nach innen sind keine Gitter, so daß man von einem Brett auf das andere treten kann, wobei man sich an eisernen Griffen jedesmal festhält. Man braucht also nur von einem Brett allemal dann seitwärts zu treten, wenn das Trittbrett am anderen Gestänge mit diesem in gleicher Höhe ist; das Gestänge hält dabei einige Sekunden still. So fährt man ohne Anstrengung in die Grube, jedesmal 3–4 Meter tiefer den Platz wechselnd, umgekehrt steigt man in gleichem Tempo in die Höhe. Die Bergmannslampe, die man vor der Brust befestigt trägt, liefert das Licht, das immer mit der Person verknüpft bleibt. – Wir fuhren hinab bis zu einem Stollen, der uns zum Festraum, einer saalartigen Erweiterung des Bergwerks, führte, der festlich dekoriert und bekränzt war; bis auf den Wasserspiegel des Ernst-August-Stollens hinab zu fahren, [225] nahm zuviel Zeit in Anspruch. Ich fuhr, nachdem ich noch einige Arbeitsstellen »vor Ort« besucht hatte, wo das helle Erzgestein mit Werkzeug abgesprengt wurde, wieder hinauf und war erfreut, das Tageslicht wieder zu erblicken. Der Betrieb in Erzbergwerken des Harzes ist weniger gefahrvoll wie in den Kohlenbergwerken, wo bekanntlich durch Ansammlung von Gasen Explosionen – »schlagende Wetter« – eine große Gefahr bilden. Das Bleierz, bekanntlich »Bleiglanz« genannt, ist ein festes Gestein, das erst in den Pochwerken zu feinem Sand zerkleinert wird und von hier in die großartigen Schmelzhütten kommt, die um Clausthal herum liegen. Der Transport der Erze zu den Pochwerken und Schmelzhütten erforderte damals ein kleines Heer von Fuhrleuten, die mit ihren Gespannen früh morgens auf die Hütten zogen. Wir wurden aus dem Schlafe früh aufgeweckt durch ein Peitschenkonzert von mehr als hundert Peitschen. Mit diesem eigenartigen Instrument knallten die Fuhrleute, wenn sie an der Berghauptmannschaft, die unserem Hotel gegenüber liegt, mit ihren trogähnlichen Kastenwagen vorbeifuhren, daß einem Hören und Sehen verging. Dieser Brauch war uralt, ob er heute noch besteht, weiß ich nicht.
Abends vorher hatten wir uns nach kurzem Aufenthalt in der erbauten Festhalle zeitig zu Bett gelegt; der nächste Tag sollte uns eine besondere Anstrengung bringen, wir wollten in einer Tour bis zum Brocken marschieren.
[9.10 Brocken]
In der frischen Morgenluft brachen wir auf und gingen tapfer drauf los bis zum Sonneberger Forsthaus, wo wir Rast machten und uns stärkten; viel aßen wir tagsüber nicht, noch weniger tranken wir, um durch Überladen des Magens nicht faul zu werden. Im Forsthaus Sonneberg gefiel es mir sehr gut, bei dem stillen Verkehr waren wir die einzigen Gäste, die von der reizenden Wirtstochter bedient wurden. Ich konnte es nicht unterlassen, mich mit dem bildhübschen Mädel zu unterhalten und ihr einige Artigkeiten zu sagen. Zugleich griff ich in die Saiten eines allerdings sehr verstimmten [226] Klimperkastens, wodurch ich meine Position verstärkte und eine kleine Umarmung wagte, gegen die sich das holde Kind nur wenig sträubte. Droste meinte aber, ich solle das Poussieren lassen, und so trennten wir uns bald, um jetzt den schwierigen Anstieg zunächst der Vorberge zum Brocken zu überwinden. Bis zum Forsthaus hatten wir bequemen ebenen Weg, jetzt aber kamen die Strapazen, die uns allerdings vorausgesagt waren. Wir marschierten nun über den Bruchberg, durch teils mooriges Gelände bis zum Torfhaus, rasteten dort wieder kurze Zeit und stiegen dann über den kleinen Brocken gegen die nun vor uns liegende gewaltige Bergkuppe des »Brockens« an. Fatal war es, die nicht unerhebliche verlorene Steigung über den kleinen Brocken machen zu müssen, wir mußten wieder tief ins Tal hinab und kletterten dann mit dem Aufgebot unserer letzten Kräfte auf den Vater Brocken wieder hinauf. Oben, spät abends schon in der Dunkelheit angekommen, wurden wir vom Wirt freundlich begrüßt, der uns in dem damals noch bescheideneren Brockenhaus unser vorher bestelltes Quartier anwies. Unsern mächtigen Appetit nach der strammen Tour bewältigten wir jeder mit einem großen Eierpfannkuchen mit Speck, bald darauf streckten wir unsere ermüdeten Glieder und gingen schlafen, um am andern Morgen früh den Sonnenaufgang zu genießen. Auf dies Schauspiel hatten wir uns sehr gefreut. Wir und die anderen Gäste wurden rechtzeitig geweckt, ungekämmt und ungewaschen kam alles hinaus ins Freie, eingehüllt in alle möglichen Schutzmäntel, Decken u.a. Der Aussichts-Turm wurde bestiegen, aber es lagerte eine halb durchsichtige Nebelhaube auf dem Brocken, die nicht weichen wollte. Man konnte wohl matt die Sonnenscheibe, nachdem sie aufgegangen war, durch den Nebelschleier scheinen sehen, aber das war alles, enttäuscht suchten wir alle unsere Lagerstätten wieder auf und schliefen uns noch möglichst aus. Beim Morgenkaffee drehte sich natürlich die Unterhaltung der Gäste um den mißglückten Sonnenaufgang, die aufliegenden Fremdenbücher aber gaben [227] ein beredtes Zeugnis davon ab, wie viele Besucher des Brockens schon dasselbe Pech wie wir hatten und ebenfalls auf diesen Genuß verzichten mußten. Eine Fülle von Stoßseufzern in Prosa und Poesie enthielten die Fremdenbücher, die uns eine amüsante Lektüre boten. Auch wir fanden uns mit unserem Mißgeschick ab und fügten, beim Einschreiben unserer Namen ins Fremdenbuch, einen weiteren Stoßseufzer hinzu.
[9.11 Bodetal, Rübeland, Treseburg, Alexisbad]
Inzwischen war es draußen klarer geworden, der Brocken hatte seine Nachtmütze abgelegt, zwischendurch ließ das leichte Gewölk unter uns einen Blick auf die bewaldeten Berge und in die weite Ebene frei; damit mußten wir uns begnügen. Wir schnürten unser Ränzel, stiegen hinab und marschierten in der Richtung nach Elbingerode. Wir wählten den Weg an den Wolfsklippen und den Hohneklippen vorbei über den Hohner Viehstall. Diese Gegend des Harzes zeichnet sich durch einen düsteren Charakter aus und ist deshalb von den Touristen weniger besucht. Die Wegeverhältnisse im Harz, die heute überall von bester Beschaffenheit sind, lagen derzeit noch sehr im Argen. Wir hatten in diesem unwirtlichen Gebiet, ohne Führer, den wir grundsätzlich nie gebraucht haben, Mühe, uns zurecht zu finden. Wenn wir Auskunft haben wollten, mußten wir einsame Waldarbeiter oder Köhler, die bei ihren Meilern in spitzen Hütten hausten, befragen, die uns dann beim öfteren Verlaufen wieder auf den rechten Weg wiesen. In Elbingerode, einem stillen Harzstädtchen, kehrten wir im Gasthaus zum »blauen Engel« ein.
Am nächsten Tage gings über Rothehütte, und von dort ab durchs Tal der Bode, die sich mit vielen Windungen zwischen den Bergen hindurch schlängelt, nach Rübeland. Hier beabsichtigten wir uns die Marmorindustrie zu besehen und die Baumannshöhle zu besuchen. Außerdem war in dem Städtchen größeres Leben, es war »Schüttenhoff«, so wurde das Schützenfest genannt. Wir quartierten uns im »Hotel zum goldenen Löwen« ein und verbrachten einen gemütlichen Tag; das festliche Treiben wirkte auch auf uns ein, mein Chef [228] spendete abends noch eine »gute« (?) Flasche Wein, wir gingen recht vergnügt in die Klappe. Wahrscheinlich wirkte die etwas abweichende Lebensweise, besonders die »gute« Flasche, aufregend auf mich ein, denn in der folgenden Nacht machte ich bei lebhaftem Träumen dummes Zeug. Unsere Betten standen längs vor einander an einer Wand, das meine stieß mit dem Kopfende an das meines Chefs. Mitten in der Nacht fing ich an zu nachtwandeln und kletterte über das Kopfende meines Bettes in das meines Schlafnachbars, der im festen Schlaf lag. Auf dem Fußende des Bettes sitzend, ziehe ich Droste die Bettdecke herab, der aufschreckend mich anrief, was ich denn wolle. Ich erwiderte ihm träumend, daß ich die Gegend skizzieren wollte; Droste, bemerkend, daß ich im schlaftrunkenen Zustand mich befand, zog die Decke wieder über sich und entgegnete, daß ich an seinem Bauch keine architektonischen Studien machen könne, und suchte mich munter zu machen, sodaß ich wieder in mein Bett zurückstieg. Am andern Morgen erzählte mir Droste lachend meinen nächtlichen Streich, von dem mir einiges noch erinnerlich war; die »gute Flasche« fühlte ich allerdings noch stundenlang im Kopfe. Unser nächstes Reiseziel war Treseburg, wir schlugen den Weg durch das Bodetal ein. Die Bode wird in Tresenburg durch den Zufluß der Luppbode verstärkt. Wie immer, wurden wir vom schönsten Wetter begünstigt, der Weg an den vielen Windungen der Bode entlang war recht interessant. In Treseburg stiegen wir im Hotel »zum weißen Hirsch« ab und machten es uns gemütlich. Alle die Orte, in denen wir Quartier nahmen, hatten derzeit nur einfache Gasthäuser mit entsprechend billigen Preisen. Der zunehmende Wohlstand, der Aufschluß des Harzes durch bessere Wege, besonders die Anlage des Eisenbahnnetzes durch den ganzen Harz hat dazu beigetragen, daß jetzt an allen Plätzen großartige Hotels entstanden sind, mit größtem Komfort ausgestattet, allerdings müssen auch drei- und vierfach höhere Preise bezahlt werden. In Treseburg fand ich mal wieder Gelegenheit, ein gut gestimmtes [229] Klavier zu spielen und die Gäste, die sich in der großen Wirtsstube zusammenfanden, etwas zu unterhalten.
Von Treseburg pilgerten wir anderen Tags zur Viktorshöhe, genossen hier von dem hölzernen Aussichtsturm den herrlichen Blick und marschierten nach kurzer Rast weiter über Mägdesprung nach Alexisbad, unserem nächsten Nachtquartier.
[9.12 Auerberg, Stolberg, Kyffhäuser]
Am folgenden Morgen gingen wir bis Harzgerode bei drückender Hitze; die langweilige Chaussee, die von hier außerhalb der schattigen Wälder nach Stolberg, unserem nächsten Tagesziel, führte, reizte meinen Chef nicht zum Fußwandern in der sonnigen Glut. Wir benutzten deshalb von Harzgerode bis zum Auerberg eine Postchaise; dies war aber auch die einzige Strecke auf unserer Rundreise durch den Harz, die wir nicht zu Fuß durchwanderten.
Am Auerberg stiegen wir aus und gingen hinauf zur Josephshöhe, um von dem dortigen Aussichtsturm den schönen Blick auf die waldigen Berggruppen des Unterharzes zu genießen. Von dort gings hinab nach Stolberg; das lieblich gelegene Städtchen, Residenz der Grafen Stolberg-Stolberg, deren Schloß hoch oben über der Stadt thront, machte einen angenehmen Eindruck, wir fanden auch hier gutes Unterkommen. Der nächste Tag führte uns aus dem Harz heraus, hinauf zum »Kyffhäuser«, zu dem wir über Uftrungen, Rottleberode und Kelbra eine langweilige, staubige Chaussee wandern mußten. Der alte Herr hatte sehr unter der Hitze zu leiden, auch mir klebte die Zunge am Gaumen. Die Landstraße war mit Obstbäumen bepflanzt, darunter befanden sich volltragende Kirschenbäume, deren reife Früchte in strotzender Fülle herabhingen. Ich konnte der Versuchung nicht widerstehen, wenn ich unter einem solchen Kirschenbaum herging, mir jedesmal einige Früchte abzupflücken und meinen Durst mit den saftigen Kirschen zu löschen. Meinem alten Herrn behagte es nicht, daß ich mir auf diese Weise fremdes Eigentum zu Gemüte führte, er verwarnte mich mehrmals. Aber [230] der quälende Durst und der Appetit, der nach dem Genuß der schönen Früchte erst recht rege wurde, ließ mich verstohlen noch weiter sündigen. Auf einmal sprang ein Bauer, den ich nicht gesehen hatte, aus dem angrenzenden Feld auf mich zu und beschuldigte mich des Kirschendiebstahls, ich müsse dafür Strafe zahlen und ihm sofort zum »Schulzen« folgen. Dem alten Herrn machte es sichtbar Freude, daß ich der gerechten Strafe für meine Missetat nicht entgangen war, er sagte, jetzt möge ich allein ausfressen, was ich mir eingebrockt hätte. Ich machte dem Bauer plausibel, daß doch gar kein Wert in dem viertel oder halben Pfund Kirschen stecke, die ich nicht in räuberischer Absicht, sondern nur, um den Gaumen zu erfrischen, gepflückt hätte, er blieb aber hart an meiner Seite bis zu einem Wege, der zum Dorfe – es hieß bezeichnend »Bösenrode« – sich von der Chaussee abzweigte. Um Droste nicht allein weiter gehen zu lassen, verhandelte ich jetzt mit einem Bauern und bot ihm fünf Groschen, womit die Kirschen dreifach bezahlt seien; er ließ sich aber nicht erweichen, erst als ich ihm das Doppelte anbot, ließ er von meiner Anzeige ab und steckte den Judaslohn in seine eigene Tasche. Auf dem weiteren Wege mußte ich für meinen begangenen Fehltritt noch eine Moralpredigt des alten Herrn mit in den Kauf nehmen, der seinem Unmut, an dem die Hitze sehr viel Schuld mit hatte, hierdurch etwas Luft machte.
[9.13 Beim Einsiedler Beyer auf der Rothenburg]
So kamen wir denn spät nachmittags am Fuße des Kyffhäuser an, um nun auf die Rothenburg hinauf zu steigen und dort zu übernachten. Der Fahrweg nach der Rothenburg zieht sich in einer Serpentine am Berge in die Höhe; ich benutzte, um rascher zum Ziele zu kommen, die steilen Fußwege und war längst auf der Burg, als Droste sehr ermüdet oben ankam. Er war über mich ungehalten, daß ich nicht mit ihm gegangen sei, die Laune hatte ich ihm so wie so schon verdorben.
Wir gingen nun zusammen durch die Ruine hindurch zu der Klause eines Einsiedlers namens Beyer, der über dem [231] Raum der Ruine, in dem er wohnte, unter einem Strohdache einige Betten stehen hatte, die er zum Nachtquartier an Touristen abgab. Zum Glück waren wir beide seine einzigen Gäste, die er mit Freuden aufnahm. Der Einsiedler, ein würdiger, körperlich noch sehr rüstiger Greis mit langem, wallenden, schneeweißen Kopf- und Barthaar, trug ein schlicht herabhängendes Gewand mit einem Gürtel umschlungen; barhäuptig kam er uns entgegen, hieß uns mit seiner sonoren Stimme herzlich willkommen und lud uns auf unsere Anfrage, ob wir bei ihm wohnen könnten, ein, in seine Klause einzutreten. Diese bestand aus einem größeren stubenähnlichen Raum mit einer anstoßenden Zelle, der Schlafstätte des Einsiedlers. Die Wände waren rauh beworfen und mit Kalk geweißt, die Decke hatte rauhe Bretterschalung, der Fußboden ebenfalls rauhe Dielen. In einer tiefen Mauernische befand sich ein offenes Herdfeuer, auf dem der Einsiedler sein karges Mahl bereitete. Der Vorratsraum befand sich unter der Klause, ebenso ein kleiner Stall mit einer Ziege. Neben der Klause stand ein Gerüst mit einer Glocke, die von dem Eremiten zu gewissen Tageszeiten in den stillen Wald hinein geläutet wurde. Im Freien standen einige rauh gezimmerte Tische und Bänke. Der würdige Mann führte uns in unser Schlafquartier, dem Bodenraum unter dem Strohdache. Das Mobiliar bestand aus zwei schlichten Betten mit sauberen weißen Bettüchern und wollenen Decken sowie einigen Bretterstühlen auf denen einfache Waschnäpfe standen, die Handtücher hingen über den Stuhllehnen; das war alles. Die Betten berührten nach der Außenseite das Strohdach, das ich, als ich im Bett lag, mit ausgestrecktem Arm in die Höhe heben konnte.
In dem unteren Raume, in dem wir uns mit dem Klausner aufhielten, stand in der Mitte eine längere Tafel mit mehreren Bretterstühlen, eine Bank, ein einfacher Schrank mit Geschirr und Gläsern usw., an der Wand eine Repositur mit Büchern.
Das frugale Mahl, welches uns der Einsiedler bieten konnte, bestand in Brot, Pellkartoffeln, Eiern und Wurst; an [232] Getränken gab es für gewöhnlich nur Kaffee, Milch und Wasser – der alte Mann bereitete alles selbst, er deckte den Tisch und trug die Speisen auf, nachdem Kartoffeln und Eier auf den offenen Herdfeuer von ihm gekocht waren.
Der Abend, den wir zu dritt auf dieser einsamen Bergeshöhe inmitten der romantischen Ruine verlebten, bleibt mir unvergeßlich. Mit unserem würdigen alten Wirt speisten wir zusammen; mitten auf dem Tisch stand eine irdene Schale mit dampfenden Kartoffeln, die uns mit Butter und Salz eine wahre Delikatesse waren nach der anstrengenden Wanderung, die wir hinter uns hatten. Beyer erzählte uns bei Tisch kurz aus seiner Lebensgeschichte, wie er zum Einsiedler geworden war; er war früher in der Nähe des Kyffhäuser ansässig gewesen und hatte viel Schicksal gehabt. Bei seinem Hang zur Romantik, seinem Sinn für die Natur hatte die schön gelegene Rothenburg immer eine besondere Anziehungskraft auf ihn ausgeübt. Hier hatte er in trüben Stunden Ruhe und Frieden gesucht und gefunden, hier hatte er seine Gedanken in tief empfundenen Gedichten niedergeschrieben; den Ansprüchen an das Leben hatte er völlig entsagt. Der Fürst von Sondershausen habe ihm gestattet, sich dauernd auf der Rothenburg als Einsiedler niederzulassen, und so hause er hier und freue sich, wenn er hin und wieder Gäste um sich habe, die sich bei ihm wohl fühlten. Das Leben im Freien hatte ihn vollständig abgehärtet, er hatte nur sein dichtes, wallendes Kopfhaar zur Bedeckung seines Hauptes, dabei frische rote Backen und ein kindlich heiteres Gemüt.
Nach dem Abendessen gingen wir hinaus ins Freie, er zeigte uns die Burgruine und ihre Umgebung und führte uns an eine Stelle, von der man ein wunderbares Echo von der gegenüber liegenden Höhe hervorrufen konnte. Mit einem großen Sprachrohr rief er ganze Sätze hinüber, die in tadelloser Klangreinheit wieder zurückkamen; wundervoll wirkte es, wenn man vier aufeinander folgende Töne durch das Sprachrohr sang, die dann zu einem Akkord vereinigt zurück schallten [233] und noch lange Zeit nachhallten. Nachher zogen wir uns wieder in die Klause zurück, nachdem Beyer den Tisch vorher abgeräumt hatte. Zu unserer Überraschung fanden wir beim Eintreten in die Klause statt des Tisches ein langes altmodisches Klavier, eine Art Spinett, vor; die Tischplatte, die vorher auflag, war abgenommen und stand an der Seite. Das war ein Fall für mich, ich setzte mich sofort an den Klimperkasten und spielte drauf los, so daß die alten Herren beide in eine lustige Stimmung kamen. Beyer holte aus einer verborgenen Ecke einige Flaschen Wein mit drei Gläsern heraus, der ihm von Freunden gespendet war; er erzählte, daß er nur selten zu diesem Genusse komme, und nur dann, wenn er ihn mit anderen in fröhlicher Stunde teilen könne. Durch unsere Anwesenheit fühle er sich so froh und vergnügt, daß er mit uns einige Flaschen trinken müsse. Wir waren auch keine Unmenschen und nahmen die gütige Spende mit Dank freudig an. Beyer setzte sich nachher selbst ans Spinett und begleitete sich einige launige Lieder, die er selbst gedichtet hatte. Es lag ein eigener Zauber über dem Bilde in der matt beleuchteten Klause, den alten weißhaarigen Greis an dem Instrument sitzen zu sehen, mit dem Gesicht nach oben blickend, bei schalkhafter Geberde seine Lieder singend; ich löste ihn ab und begleitete ihm einige damals übliche Volkslieder, bis wir zur Ruhe gehen wollten. Draußen im Freien hatte sich inzwischen das Bild auch geändert; es war tiefschwarze Nacht, kein Sternenhimmel sichtbar, nur die Johanniswürmchen flimmerten in dunklen Büschen als lichte tanzende Pünktchen; eine heilige Ruhe lagerte über dem dichten Walde, kein Blättchen rührte sich. Die Waldesstille wurde allein gestört durch unsere Stimmen, als wir uns gegenseitig gute Nacht wünschten; am fernen Horizont wetterleuchtete es.
Wir waren bald fest eingeschlafen, aber mitten in der Nacht wurden wir jäh aufgeschreckt durch einen mächtigen Donnerschlag, dem ein wolkenbruchartiger Regen, verbunden mit einem wütenden Orkan, folgte, der sich durch unser Strohdach [234] dach hindurch fühlbar machte. Helle, blindende Blitze durchzuckten leuchtend unser kleines Gemach, der Donner krachte unaufhörlich, und der Sturm raste in den mächtigen Baumwipfeln, von denen die Äste herunterbrachen und auf unser Dach schlugen. Es war uns beiden recht unheimlich zu Mute; wir waren beide munter, blieben aber im Bett liegen; ein solches Wetter unter so eigenartigen Umständen hatten wir beide noch nicht erlebt. Dicht neben unserer Klause ragte eine mächtige freistehende Giebelwand der Ruine in die Höhe; der Gedanke, daß diese Wand vom Sturm umgeworfen werden könnte, machte mich schaudern; wir wären wie die Mäuse in der Studentenfalle plattgeschlagen. Zum Glück zog das Wetter rasch vorüber, ohne uns Schaden zugefügt zu haben. Am folgenden Morgen war der Himmel völlig klar, die Luft von erfrischender Kühle. Das Glöckchen des Eremiten erweckte uns aus dem Schlafe, und wie wir in die Klause herunterkamen, stand der Kaffee schon dampfend auf dem Tische. Der rüstige Alte war schon früh auf den Beinen, er hatte seine Ziege schon gemolken, den Kaffee gekocht und alles behaglich in Ordnung gebracht. Wir sprachen über das Wetter in der Nacht, das für ihn nichts Außergewöhnliches gewesen war, denn solche Gewitter mit orkanartigem Sturm war er längst gewöhnt; wir fanden es allerdings grausig genug, besonders durch die nebenstehende Giebelwand, die Gefahr lief, über kurz oder lang durch Sturm umgeworfen zu werden – wenn ich nicht irre, ist sie auch inzwischen gestürzt – den Alten aber rührte die Gefahr nicht, er kannte keine Furcht.
Um den Marsch nach der Kyffhäuser-Ruine anzutreten, mußten wir uns von dem Eremiten verabschieden; er verweigerte die Annahme einer Zahlung für Nachtquartier und Essen; er gab aber einem jeden von uns ein rot gebundenes Buch seiner Gedichte zum Preis von einem Taler, in die er eine Widmung hineinschrieb; mit dieser Einnahme deckte er seine Unkosten. Wie so vieles aus damaliger Zeit ist mir auch dies Gedichtbuch leider abhanden gekommen.
[235] Der rüstige Alte gab uns noch auf eine Strecke Weg das Geleite, beschied uns, wie wir am besten zum Kyffhäuser gelangten, und dann trennten wir uns mit herzlichstem Danke von unserem liebenswürdigen Wirte. Es war eine Lust, in der frischen Waldesluft unter dem klaren, tiefblauen Himmel den bequemen Pfad zu marschieren, der uns nach dem sagenumwobenen Schlosse weiland Friedrich Barbarossas führen sollte. Keine Menschenseele begegnete uns, wir waren in frohester Stimmung, der alte Herr sang sogar Wanderlieder mit mir zusammen und erzählte Scherze; er hatte seine frohe Laune wiedergewonnen, die ihm tagsvorher abhanden gekommen war.
[9.14 Kyffhäuser, Kelbra, Nordhausen, Ellrich]
Nach 1 ½ stündigem Marsche erreichten wir die berühmte Ruine der alten Kaiserburg. Die alten Ruinenreste imponierten uns durch das solide, in regelrechten Schichten aufgeführte Quadermauerwerk, das in gutem Verband zusammengearbeitet war, im Gegensatz zur Rothenburg, deren Mauern mit wilden Bruchsteinen aufgeführt waren.
Von der umfangreichen Ruine hatten wir einen wundervollen Blick in die goldene Aue mit ihren wogenden Getreidefeldern. Nach Besichtigung der Ruine kehrten wir bei den »Burgfräuleins« ein, zwei alte Jungfern, die ähnlich wie der Eremit auf der Rothenburg in der Kyffhäuser-Ruine sich häuslich eingerichtet hatten und sich durch die Wirtschaft ihren Unterhalt verschafften. In einem mächtigen Torbogen der Ruine hatten sie einen Raum hergerichtet, der als Gaststube benutzt wurde; einige Räume dahinter dienten zu Wirtschaftszwecken und zum Schlafen. Die alten Burgfräuleins liefen keine Gefahr, verführt oder gar entführt zu werden, sie waren bildhäßlich, eine davon schielte mit dem linken Auge nach der rechten Schürzenschleife – Westentasche konnte man nicht sagen, denn sie hatte keine Weste. Für ein kleines Entgelt durfte man einen Blick in das geheimnisvolle Innere des alten Kaiserschlosses genießen. In einem Spalt im Bruchsteinmauerwerk konnte man nämlich durch ein Glas, wie in einem Guckkasten, [236] sehen, wie der alte Barbarossa mit Krone, Szepter und Schwert hinter einem Steintische saß, durch den sein bis auf die Erde herabwallender Bart hindurchgewachsen war, und dort schlief – bis zum Jahre 1871, wo er in Kaiser Wilhelm dem Großen – »Barbablanca« – einen Nachfolger fand, auf den die deutsche Kaiserkrone überging. Dem großen Hohenstaufen folgte aber erst nach Jahrhunderten der große Hohenzoller, der das nach Friedrich Rothbarts Zeit allmählich zerfallene und durch innere Kämpfe zerrüttete heilige römische Reich »deutscher Nation« in neuer, nie geahnter Pracht und Herrlichkeit wieder erstehen ließ – »ein deutsches Reich« deutscher Nation! Die Raben, die den Kyffhäuser umkreisten, sind jetzt durch Preußens Adler verscheucht, Barbarossa konnte zur Ruhe gehen; damals schlief er noch, die Sehnsucht des deutschen Volkes nach einem wieder geeinten deutschen Reiche war noch nicht gestillt. – Durch ein anderes Guckloch sah man einen Turnierkampf, der sich vor dem Kaiser, umgeben von seinen Rittern und Edlen auf einem Turnierplatze vor dem Schlosse abspielte. Beide Bilder hatten natürlich keinerlei künstlerischen Wert, sie machten aber gerade an dieser Stätte einen tiefen Eindruck auf den Beschauer; wir wurden dadurch angeregt, die Ruinen genauer zu besichtigen und einen Umgang durch dieselben zu unternehmen. Bei diesem Umgang wurde mir durch einen plötzlichen Windstoß mein Hut vom Kopfe geweht, er flog in die tiefer liegenden Kapellenruinen, zu denen ich herunterkraxeln und mir nicht ohne Schwierigkeiten meinen Hut wieder heraufholen mußte.
Nach eingehender Besichtigung der Ruine machten wir uns auf den Weg hinab nach Kelbra, rasteten dort, um uns zu stärken, pilgerten dann eine mehrere Stunden lange Chaussee nach Nordhausen, kamen dort in der Dunkelheit an und nahmen unser Nachtquartier im »Berliner Hof«. Sehr ermüdet von dem tüchtigen Fußmarsch, legten wir uns nach dem Abendessen bald zu Bett. Infolge des späten Essens hatte ich in dieser Nacht wieder mal genachtwandelt und Dummheiten [237] gemacht, von denen mir Droste am andern Morgen erzählte; ich wußte aber nichts davon.
In Nordhausen besuchte ich meinen Freund Fritz Kirchner, der uns die Sehenswürdigkeiten der Stadt zeigte und uns durch das Gehege – eine städtische Anlage – auf den Weg nach Neustadt unter dem Hohnstein geleitete. Den Hohnstein, eine umfangreiche Schloßruine, besichtigten wir und machten Skizzen davon; dann marschierten wir nach kurzer Rast in Neustadt weiter nach Ellrich. Unterwegs passierten wir das Dorf Niedersachswerfen, das tagsvorher zum größten Teil niedergebrannt war; wir sahen die riesige Rauchwolke auf unserem Wege nach Nordhausen, wußten aber nicht, was brannte. Es war ein ergreifendes Bild des Jammers; zwischen den noch glimmenden und rauchenden Trümmern hatten die Abgebrannten ihre Habe zusammengetragen und klagten über ihr Schicksal; wir spendeten einigen Kindern eine Unterstützung und beflügelten unsere Schritte, um aus dem stinkenden Brandgeruch von der Stätte des Unheils in die reine Luft zu kommen. Es dauerte einige Zeit, bis wir die traurigen Eindrücke überwunden hatten.
Unseren Nachtaufenthalt nahmen wir in Ellrich. Nächsten Tages führte unsere Wanderung zunächst nach Walkenried, einem Ort, der durch die herrliche Ruine einer im Bauernkriege zerstörten frühgotischen Abtei ein besonderes Interesse für uns hatte. Wir studierten die sehr gut erhaltene malerische Ruine und machten uns verschiedene Skizzen. Auf dem Wege dorthin kamen wir an mehreren Seen, den sogenannten Zwerglöchern, vorbei. Nach mehrstündigem Aufenthalt gings weiter über Sachsa, einem damals wegen seiner Wilddieberei berüchtigten stillen Städtchen, hinauf nach dem Ravenskopf, der dominierenden Höhe in weitem Umkreise, von dessen Aussichtsturm man einen prachtvollen Überblick über den waldbedeckten Unterharz genießt. Wir übernachteten dort und fanden gutes Quartier bei guter Verpflegung.
[9.15 Durchs Ockertal nach Goslar, zurück nach Hannover]
Mit dem Ravenskopf hatten wir den letzten Höhepunkt auf unserer Harzreise erstiegen. Von jetzt ab verlief unsere [238] Wanderung ohne besondere Anstrengung, auch ohne bemerkenswerte Begebenheiten. Die letzten Tage führten uns über Lauterberg nach Andreasberg, dort blieben wir über Nacht, dann anderen Tages über Altenau nach Romkerhall im Ockertal, unserem letzten Quartier inmitten des Harzes. Den Schluß unserer Wanderung machten wir durchs Ockertal, das uns nochmal alle Schönheiten des Harzes so recht eindringlich vor Augen führte. Wir konnten uns nicht satt genug sehen an all den romantischen malerischen Bildern, die gerade das herrliche Ockertal dem Auge des Wanderers darbietet. Beim Austritt aus dem Ockertal wird dem Genuß der reinen kräftigen Harzluft leider ein plötzliches Ende bereitet durch die giftigen Gase, die den Schmelzwerken der unmittelbar an der Straße liegenden Messinghütte bei Ocker entströmen. Wir ließen uns aber nicht abhalten, die Werke unter Führung eines Angestellten zu besichtigen.
Unseren letzten Aufenthalt nahmen wir in Goslar, wo wir uns im »Hotel Kaiserworth« einlogierten. Droste suchte dort einen seiner früheren Schüler auf, der umgesattelt hatte und Offizier geworden war – einen Hauptmann namens Meyer, der als Kompagniechef beim Goslarschen Jäger-Bataillon stand. Ich wurde mit ihm bekannt gemacht und lernte in ihm einen überaus liebenswürdigen Herrn kennen, der Droste ebenfalls hoch verehrte. Er war sehr erfreut, daß sein früherer Vorgesetzter ihn aufgesucht hatte, und veranlaßte uns, einen Tag länger in Goslar zu bleiben, um sich in seiner dienstfreien Zeit uns widmen zu können. Durch den längeren Aufenthalt in dieser interessanten Stadt fand ich Gelegenheit, eine Anzahl architektonisch wertvoller Bauwerke in mein Tagebuch zu skizzieren, darunter das Rathaus, die spätromanische Kirche zum Kloster Neuwerk, die Kaiserpfalz – damals noch ein Fruchtmagazin – und unser Hotel »Kaiserworth«. Am ersten Abend hatte Droste Hauptmann Meyer in unser Hotel eingeladen, am nächstfolgenden Abend waren wir bei Meyer zu Gaste, an beiden Abenden ging es sehr gemütlich her.
[239] Mit Goslar hatten diese schönen, mir stets unvergeßlich gebliebenen Tage ihr Ende erreicht, und so kehrte ich, dank der Opferwilligkeit meines väterlichen Vorgesetzten frisch und gesund nach Hannover wieder zurück. An die täglichen weiten Fußwanderungen über. Berg und Tal hatte ich mich so gewöhnt, daß ich sie sehr entbehrte. Ich blieb einigermaßen in der Übung durch meine täglichen Spaziergänge nach dem Döhrener Turm und in die Eilenriede.
Während meiner Abwesenheit war in der Familie Buerdorf ein freudiges Familienereignis eingetreten; Vater Buerdorf überraschte mich durch die Mitteilung von der glücklichen Geburt eines vierten Töchterchens, das später auf den Namen Paula nach einer ihrer Taufpaten, meiner ältesten Schwester Marie Pauline, getauft wurde.
[240] 10. In Hannover bis zum Kriege.
[10.1 Architekten- und Ingenieurfest in Bremen]
Bald nach der Rückkehr von meiner Harzreise fand in Bremen das deutsche Architekten- und Ingenieurfest statt, an dem ich mich mit mehreren befreundeten Kollegen beteiligte. Die Stadt Bremen hatte den Architekten und Ingenieuren aus allen Gauen unseres deutschen Vaterlandes einen großartigen Empfang bereitet. Es war das erste größere Fest dieser Art, welches ich mitmachte; die hannoverschen Architekten, an der Spitze die Professoren des Polytechnikums und höhere Baubeamte, waren besonders stark vertreten. Wir jüngeren Elemente machten ausgiebigen Gebrauch von dem, was uns die gastliche Stadt bot. Das Festmahl im Schützenhof, von der Stadt gegeben, übertraf alles, was ich bis dahin gesehen bezw. genossen hatte. In der Rede, womit der Senator Gildemeister beim Festmahl die Gäste begrüßte, brachte er zum Ausdruck, daß die Stadt Bremen, obgleich eine Republik, es sich nicht nehmen lasse, ihre Gäste »königlich« zu bewirten. Auf der Tafel prangte der kostbare Tafelschatz der Stadt; es gab die auserlesensten Speisen, die besten Weine und die feinsten Zigarren; sogar der berühmte Wein aus der »Rose« im Ratskeller wurde kredenzt und in deutschen Schützenbechern, die von den Bremensern auf dem deutschen Bundesschießen »erschossen« waren, herumgereicht. Von diesem uralten edlen, oder besser »teuersten« aller Weine, wovon der Tropfen, wie ein Rechenkünstler ausgeklügelt hat, einen Dukaten kosten soll – das behaupteten wenigstens die Bremenser – leistete ich mir auch einen Schluck. Mein Nachbar aber nahm mir den herumkreisenden Becher etwas zu rasch vom Munde, und ein Teil des edlen Stoffes lief auf meine [241] Hemdfalten – ich habe das Hemd lange Zeit nicht waschen lassen und als kostbares Wertstück scherzhaft gezeigt; leider konnte ich den Wert des vergossenen Weines nicht in bare Münze umsetzen, sonst hätte ich viele hundert Dukaten für dasselbe lösen können. Wenn ich sagen soll, wie mir der Wein geschmeckt hat, so will ich es hier verraten – wie Tinte! Nach aufgehobener Tafel wurden die feinsten Zigarren herumgereicht, von denen die meisten zum Füllen der Zigarrenetuis verwendet wurden – es war ja da!
Der gute Wein, die schweren Zigarren, die Aufregung durch das festliche Treiben verfehlte denn auch schließlich nicht seine Wirkung – von den jungen Leuten hatte sich jeder seinen Rausch geholt, und ich hatte mir auch einen »eingewickelt« – am anderen Tage wußte ich nicht, wie ich in mein Quartier gekommen war.
Der folgende Tag führte die Festteilnehmer in Sonderzügen nach Geestemünde-Bremerhaven. In Geestenmünde wurden die neuen großen Lagerhäuser der zollfreien Niederlage besichtigt; in einem derselben war ein großes Frühstück zubereitet, das ausschließlich nur aus Gerichten, die das Meer liefert, bestand: Hummer, Kaviar, Krebse, Heringe, Sprotten, Stör usw.; es war ein Katerfrühstück im besten Sinne des Wortes, denn sehr viele – wir jungen Leute sämtlich hatten vom Abend vorher einen Kater mit auf den Weg genommen. Das vortreffliche Frühstück brachte uns aber wieder hoch und belebte die festliche Stimmung.
Nach diesem Aufenthalt in Geestemünde zog die gesamte Festgemeinde mit Musik nach dem festlich geschmückten Bremerhaven. Dort war auf dem Marktplatz ein hoher Mastbaum aufgerichtet, auf dem, wie ein aufgespannter Regenschirm, ein riesengroßer Hut angebracht war. Unter diesem Hut waren alle deutsche Staaten, mit ihren Wappen und Landesfarben durch Embleme bezeichnet, symbolisch unter einen Hut gebracht. Von diesen waren die Embleme von Schleswig-Holstein und Kurhessen mit einem Trauerflor umgeben, [242] geben, beides Staaten, die unter ihren politischen Kämpfen so viel zu leiden hatten. Die Idee, sinnbildlich die Einigung der deutschen Stämme unter einem Hut darzustellen, erweckte eine große Begeisterung, es wurden patriotische Reden in allen Mundarten geschwungen und mächtig erschallte das Lied: »Was ist des Deutschen Vaterland« und »Schleswig-Holstein meerumschlungen«.
Als der Festakt an dieser Stelle vorüber war, zogen wir zur Landestelle der transatlantischen Dampfer des Norddeutschen Lloyd. Dort sah ich zum ersten Mal über die endlose Wasserfläche ins weite Meer hinaus, ein Anblick, der wie auf jeden, so auch auf mich einen mächtigen Eindruck machte. Wir bestiegen einen der Dampfer – ich hatte bis dahin noch kein Dampfschiff gesehen – und fuhren mit diesem eine Strecke in die Wesermündung hinaus und wieder zurück. Alsdann wurde vor uns ein Taucher mit seiner Ausrüstung in die Tiefe herabgelassen, der nach längerer Zeit wieder an die Oberfläche kam. Die Bremer Dampfer in damaliger Zeit waren noch Raddampfer, große Schraubendampfer schaffte der Lloyd erst später an; auch kannte man noch keine Schnellfahrten, die heute das reisende Publikum in den schwimmenden Palästen in wenigen Tagen nach Amerika befördern; die derzeit viel kleineren, bescheiden, ohne übertriebenen Komfort eingerichteten Raddampfer brauchten mindestens ein paar Wochen zu ihren transatlantischen Fahrten. – Mit dem Ausflug nach Bremerhaven hatte das schöne Fest ein Ende. Abends fuhren wir wieder nach Hannover zurück. –
[10.2 Hannoversche Diebesgeschichte]
Bald nachher passierte mir eine Diebesgeschichte, die ich wegen ihres eigenartigen Verlaufs erzählen will: Aus dem Vorraum meiner Wohnung wurde mir eines Abends, als ich eben nach Haus gekommen war und auf meiner Bude ewas Klavier spielte, mein Überzieher, Garibaldihut, seidener Regenschirm und zwei Stiefeln gestohlen; es waren alles tadellose Sachen, die ich mir kurz vorher neu angeschafft hatte. Ich war nicht schlecht erschrocken, als ich meinen [243] Überzieher nicht mehr an seinem Platze vorfand, hatte auch keine Ahnung davon, wer die Räuber gewesen sein konnten. Das besondere Pech, das ich bei der fatalen Geschichte hatte, bestand darin, daß die Spitzbuben mir von meinen beiden guten Stiefelpaaren die linken Stiefel, die zufällig zusammenstanden, gemaust hatten; es verblieben mir also nur zwei rechte Stiefeln, der eine mit rotem, der andere mit grünem Leder in den Schäften; mit denen allein konnte ich aber nichts anfangen; ich hatte also den Verlust von zwei Paar Stiefeln zu erleiden. Ich war scheußlich ärgerlich und machte sofort Anzeige bei der Polizei. In meinem Überzieher steckte noch eine Kollektion Harzansichten, die ich auf der Harzreise gekauft hatte; es waren zwölf Lithographien und ein farbiges Bild vom Brockenhaus; bei der Beschreibung der gestohlenen Gegenstände führte ich dies mit an. Es vergingen Monate, ohne daß man eine Spur der Diebe fand, und ich gab alle Hoffnung auf, meine Sachen wieder zu bekommen. Da erschien eines Morgens ganz früh, als ich noch schlafend im Bett lag, ein Schutzmann, der mich aufforderte, schleunigst mit ihm zu gehen, man sei den Dieben auf der Spur. Ich folgte ihm sofort; unterwegs erzählte er mir, wie man auf diese Spur gekommen sei. Zwei Straßendirnen in einer verrufenen Gasse hatten sich nämlich gezankt; dabei warf die eine der andern vor, daß die Bilder, die sie von ihrem Zuhälter bekommen habe, gestohlen seien. Das Gespräch hatte ein Schutzmann mit angehört; dieser erkundigte sich danach, was das für Bilder seien, und erfuhr, daß es kleine, mit Goldleisten eingerahme Bilder waren, die von dem Zuhälter, einem Glasergesellen, seiner Geliebten geschenkt waren und eine Stubenwand derselben schmückten. – Ich sollte jetzt mit in die Wohnung der Dirne gehen, um festzustellen, ob es die Bilder seien, die in meinem Überzieher steckten; wenn es der Fall sei, möchte ich ihm unauffällig zunicken. In der Gasse lag noch alles im tiefen Schlummer; es war früh gegen 6 Uhr, als wir an dem Hause ankamen, in dem das Weibsbild [244] hauste. Der Schutzmann klopfte mächtig an die Tür; eine kreischende Stimme – es war die der Wirtin – fragte von innen, wer da sei und was man wolle. Der Schutzmann meldete sich und verlangte im Namen der Polizei sofortigen Einlaß; darauf öffnete sich die Tür – die Frauengestalt flüchtete in ein Zimmer und fragte ängstlich, zu wem wir denn wollten. – Der Polizist beruhigte sie und sagte, daß wir eine ihrer Insassen, die er mit Namen nannte, überraschen wollten, sie möge uns deren Zimmer zeigen. Das Weib warf rasch ein paar Kleidungsstücke über und führte uns zwei steile, dunkle Treppen hinauf bis an die Tür des Zimmers, die unverschlossen war. Wir traten leise ein, der Schutzmann voraus und ich klopfenden Herzens hinterher; das Zimmer war noch dunkel, die gelben Gardinen vor den Fenstern, die noch zugezogen waren, zog der Schutzmann auf; in diesem Augenblick erwachte die Bewohnerin des Zimmers, erhob sich erschrocken im Bett, das in einer dunklen Ecke stand, und rief, den Schutzmann erkennend, mit zitternder Stimme, was wir bei ihr wollten. Der Schutzmann erwiderte, das solle sie gewahr werden, sie müsse sofort aufstehen. Sie weigerte sich aber, in unserer Gegenwart aufzustehen; der Mann des Gesetzes hauchte sie aber energisch an, eine Person wie sie, könne sich auch in unserer Gegenwart anziehen; wir würden uns so lange herumdrehen und die Bilder an der Wand ansehen, sie möge sich sputen, sonst müsse er nachhelfen. – Ich hätte laut auflachen mögen, wie ich nun in den sauber eingerahmten Bildchen die ganze Kollektion meiner Harzansichten erblickte; das bunte Brockenbild in der Mitte, nahmen die Bildchen die ganze Wand über dem Sofa ein. Mit einem Kopfnicken bestätigte ich dem Schutzmann, daß es meine gestohlenen Bilder waren. Inzwischen hatte sich das Weibsbild notdürftig angekleidet; der Schutzmann fragte, von wem sie die Bilder habe – die seien ihr geschenkt, wurde erwidert; ob sie gestohlen wären, was der Schutzmann behauptete, könne sie nicht wissen Letzterer nahm nun die Bilder von der Wand, legte sie aufeinander [245] und verschnürte sie mit Bindfaden. Dann ließ er sich alle Schubladen einer Kommode aufziehen, um nach weiteren Sachen zu suchen, und schließlich kam er auch an das Bett; erstaunt sah er, daß noch jemand in dem Bett lag, was wir vorher in der Dunkelheit nicht bemerkt hatten. Er zog die Bettdecke hoch und rüttelte einen Menschen auf, der sich schlafend zu stellen suchte und zu schimpfen anfing, daß man ihn wecke. Zugleich fing auch ein Hund an zu bellen, ein Teckel, der neben dem Kerl an der Wand unter der Decke lag. Auf Befragen des Schutzmanns, wer der Beischläfer sei, erwiderte das Frauenzimmer, es sei ihr Bräutigam; die weitere Frage, ob sie auch die Bilder von ihm bekommen habe, bejahte sie. Der Kerl mußte nun heraus aus dem Bett, wurde aber gegen den Schutzmann brutal und weigerte sich, die Kleider anzuziehen. Darauf öffnete der Beamte das Fenster und rief einen Kollegen, der in Reserve mitgegangen und vor dem Hause stehen geblieben war, herauf. Die Situation wurde für mich jetzt unheimlich; ich empfahl mich deshalb und ging nach Hause. Jansens, die von ihrem Mädchen gehört hatten, daß mich ein Schutzmann früh morgens aus dem Bette geholt habe, waren in großer Aufregung um mich; sie hatten ja keine Ahnung davon, um was es sich handelte, und waren froh, von mir Aufklärung zu erhalten. Nach einiger Zeit kam wieder ein Polizeimann, der mir eine Vorladung zum Polizeibureau brachte, der ich alsbald Folge leistete. Dort fand ich zu meinem Erstaunen auf einem Tische liegend meine Bilder und daneben meinen Überzieher, meinen Hut und meine Stiefel, alles aber in stark verschlissenem Zustande. Die Schutzleute erzählten mir, daß der verdächtige Glasergeselle ein Bewohner des Lister Armenhauses sei, in dem früh morgens ebenfalls eine polizeiliche Visitation stattfand, wobei auch meine andern gestohlenen Sachen aufgefunden wurden. – Auf die Annahme der wiedergefundenen Sachen verzichtete ich selbstverständlich und überließ sie der Polizei zu anderweiter Verwendung. An demselben Tage, während ich abends [246] auf dem Polytechnikum eine Vorlesung beim Professor von Kaven mit anhörte, wurde an die Tür des Lehrsaales geklopft; nach dem Hereinrufen trat ein Schutzmann ein, der, einen Schirm in der Hand haltend, mich zu sprechen wünschte. Von Kaven war über die Störung der Vorlesung sehr ärgerlich, und ich noch viel mehr. Ich sprang sofort auf, ging mit dem Schutzmann auf den Korridor und machte ihm Vorwürfe über die unerlaubte Störung. Verdutzt erklärte mir der Beamte, er habe es gut gemeint, mir den von ihm aufgefundenen Schirm zu überbringen; statt des erwarteten Trinkgeldes mußte er aber einen Rüffel über sein ungehöriges Auftreten in die Tasche stecken. Beim Wiedereintreten in den Lehrsaal erklärte ich kurz den Sachverhalt, und damit war die Angelegenheit erledigt. Meine Sachen hatten sich nun binnen 24 Stunden alle wiedergefunden; der Schirm allein aber war unbeschädigt, nur eine kleine silberne Platte, auf der ich meinen Namen hatte eingravieren lassen, war von den Spitzbuben entfernt worden. So endete diese Diebesgeschichte.
[10.3 Stellensuche bei Kasseler Bahnen]
Im laufenden Sommer war meine Schwester Marie mehrere Wochen lang zu Besuch bei mir und wohnte bei Jansens auf deren Einladung. Während ihres Aufenthaltes fand die Taufe der kleinen Paula bei Buerdorfs statt, deren Gevatterin, wie schon erwähnt, meine Schwester wurde.
In meiner beruflichen Tätigkeit trat nach Ablauf des Sommerhalbjahres eine Änderung ein, ich mußte meine Stelle am Stadtbauamt aufgeben, weil eine genügende Beschäftigung für mich nicht mehr vorhanden war, ich war aber schon auf das Eingehen meiner Stelle vorher aufmerksam gemacht worden. Ich hatte nun in Erwägung zu ziehen, ob ich noch in Hannover bleiben oder mich anderwärts nach einer Stelle umsehen wollte. Droste riet mir, mich nach Cassel zu wenden, dort wären die Aussichten für Baubeflissene jetzt günstig, weil die Ausführung zweier neuer Bahnlinien, der Bebra-Hanauer und der Halle-Casseler Bahn, vorläge, die viel technisches Personal verlangte; ich, als Casselaner, würde gewiß leicht [247] Anstellung finden. Seinem Rat folgend, reiste ich nach Cassel, um mich dort an der Bebra-Hanauer Bahn um eine Stelle zu bemühen. Ein Zeugnis, das mir Droste ausstellte, und meine Zeichnungen, für die ich mir ein großes Rollenfutteral machen ließ, nahm ich mit mir zum Nachweis über das, was ich zu leisten vermochte. – Der bauleitende Ober-Ingenieur war Bolte, ein Bekannter meines Vaters; ihn suchte ich auf und unterbreitete ihm mein Anliegen. Bolte fragte mich, ob ich das kurhessische Baueleven-Examen gemacht hätte, was ich verneinte; wenn dies aber erforderlich sei, glaubte ich imstande zu sein, das Examen nachholen zu können, wenn ich mich darauf vorbereitete; mehrere meiner Bekannten hätten das Examen bestanden, von deren Schlauheit ich keine besondere Meinung hatte, es schiene mir also keine großen Schwierigkeiten zu machen. Bolte riet mir aber entschieden davon ab, ich würde mich so viel besser stehen, denn selbst wenn ich das Examen bestände, wäre ich einer mehr von den über 100 zählenden Baueleven, die noch auf Anstellung warteten; es ginge, wie er sich drastisch ausdrückte, rein nach der Ochsentour, einer nach dem anderen, dem Alter nach, ich könne warten, bis ich blau würde, ehe ich an die Reihe käme. Er selbst sei noch kurhessischer Baueleve und nur kommissarisch mit der Oberingenieurstelle betraut. Wenn ich gern zur Eisenbahn übertreten wollte, sollte ich versuchen, an der Halle-Casseler Bahn anzukommen, dort würde es mir eher gelingen, anzukommen, weil die Bahn nicht vom Staat, sondern von einer Gesellschaft gebaut würde. Ich ging nun zum Oberingenieur Bramer von der Halle-Casseler Bahn, um dort mein Heil zu versuchen. Dieser sagte mir, daß das Bahnprojekt noch im Vorbereitungsstadium sich befinde – damals war die Trace noch über Großalmerode und nicht übr Münden geplant – er wolle mich aber vormerken und dem obersten Bauleiter, Baurat Garke in Magdeburg, mein Gesuch melden; es könne aber noch länger wie ein halbes Jahr darüber hingehen; während dieser Zeit, riet er mir, auf dem Hannoverschen [248] Polytechnikum Vorlesungen über Eisenbahn-, Straßen- und Brückenbau zu hören.
[10.4 Weiterbildung in Hannover, neue Anstellung]
Mit dieser Aussicht auf eine Anstellung im Eisenbahnfach reiste ich nun wieder nach Hannover zurück und belegte im Wintersemester einige der mir empfohlenen Vorlesungen bei Baurat v. Kaven. – Ich nahm zugleich beim Architekt Otto Götze eine Stelle an, die er mir schon vorher, ehe ich mich in Cassel bewarb, angeboten hatte. Götze nahm damals neben Architekt Oppler eine führende Stelle in Hannover ein; seine Bauten, u.a. Röpkes Tivoli, die Georgshalle in Kastens Hotel, das Palais des Grafen Grote, waren baukünstlerische Leistungen, die als sehr beachtenswert anerkannt und gewürdigt wurden. Ich teilte mich in die Ausarbeitung seiner Projekte mit Götzes Schwager Hansen; außerdem waren noch Hilfszeichner beschäftigt. Während meiner Zeit kamen mehrere reiche Villenbauten zur Ausführung, Villa Mummy auf der Burg bei Hannover, Villa Arnold Böninger in Duisburg und Villa Zimmermann in Chemnitz, an denen ich mit tätig war. Götz verlangte viel von uns, oft mußte bis in die Nacht hinein geschafft werden; aber ich lernte flotter arbeiten, wie ich überhaupt Götze, mit dem ich sehr gut stand, manches in meiner Ausbildung zu verdanken habe.
[10.5 Freimaurer]
In dieser Zeit erfüllte sich ein Wunsch, den ich schon lange gehegt hatte, ich meldete mich zur Aufnahme in die Loge, der eine Anzahl meiner Freunde bereits angehörte. Meine Aufnahme in der Loge »zur Ceder« erfolgte am 17. November und zwar gemeinschaftlich mit einem spanischen Westindier, namens Machado, der sich als Literat zur Erlernung der deutschen Sprache in Hannover aufhielt. Diesem Umstand verdanke ich während der letzten Jahre meines Aufenthaltes in Hannover freundschaftliche Beziehungen zu einem liebenswürdigen, hochgebildeten Manne, der bestimmt war, in der Geschichte seines Heimatlandes, der Insel Cuba, eine hervorragende Rolle zu spielen, er wurde später Präsident der dortigen Nationalversammlung. Als ein [249] Zeichen seiner freundschaftlichen Gesinnung sandte er mir, als er kurz vor mir Hannover verlassen hatte, aus Paris ein architektonisches Werk, betitelt »Les maisons les plus remarquables de Paris«, das er mir mit einer Widmung zum Geschenk machte; dieses Andenken an Machado wird sich unter meinen Architekturwerken noch vorfinden. Später habe ich persönlich nie wieder etwas Näheres von ihm erfahren. Was ich in der Loge suchte und fand, entzieht sich einer eingehenden Erörterung; ich kann nur sagen, daß ich mich glücklich fühlte, nun dem weltumspannenden Bruderbunde anzugehören, in ihm verlebte ich unvergeßliche Stunden, alles, was mir das Logenleben neues bot, machte auf mein empfängliches Gemüt einen tiefen Eindruck; die Erinnerung an die »Ceder« mit allen lieben Freunden, die ihr angehören, an der Spitze Freund Jänecke, dem jetzt langjährigen Meister vom Stuhl, werde ich stets hochhalten.
[10.6 Mühsame Reise nach Magdeburg]
Nach Ablauf des Wintersemesters hielt ich es für geboten, mich wegen meiner Anstellung an der Halle-Casseler Bahn nun ernstlich zu bemühen, ich wollte mich deshalb gleich an die rechte Schmiede wenden und reiste nach Magdeburg, direkt zum Baurat Garke, versehen mit meinem Zeugnis und dem großen Futteral mit Zeichnungen.
In Magdeburg angelangt, hörte ich, daß dort die Cholera ihr unheimliches Wesen trieb; in dem Hotel »zum Fürsten Blücher«, das in einer engen Straße liegt, wollte ich wohnen. Die schlechten Gerüche in der engen Gasse flößten mir aber solchen Widerwillen, besonders bei dem Gedanken an die Seuche, gegen das Hotel ein, daß ich mich dort gar nicht einlogierte, sondern umkehrte und in einem der ersten Hotels, »Erzherzog Stephan«, die eine Nacht wohnte. Mein Besuch beim Baurat Garke am anderen Morgen hatte leider keinen Erfolg; der Herr bedauerte, daß ich die Reise vergeblich gemacht hatte, ich hätte erst schriftlich anfragen sollen, dann würde er mir mitgeteilt haben, daß das Bauprojekt der Bahn in ein neues Stadium getreten sei, weil die Linie nicht [250] über Großalmerode, sondern über Münden gelegt werden solle, mit der Ausführung habe es noch gute Wege. Also wars wieder mal Essig!
Die Rückfahrt nach Hannover war eine sehr mißliche, einesteils durch meine Stimmung, die sehr herabgesunken war, andernteils durch die über Nacht ebenfalls sehr gesunkene Temperatur. Bei ziemlich mildem Wetter, ohne besonders warm gekleidet zu sein, war ich von Hannover abgefahren, das Wetter schlug aber in der Nacht um, es war wieder Frost eingetreten, der sich schon empfindlich fühlbar machte, so lange ich noch in Magdeburg war. Aber auf der Fahrt nach Hannover, in einem Personenzug, der an allen Stationen hielt, in einem Wagenabteil dritter Klasse – hui – habe ich da aber erst gefroren! Ich war allein im Coupé, hatte weder Überzieher noch Reisedecke, die damals noch nicht eingeführt war, Heizung in den Wagen gab es damals auch noch nicht, die Wände im Innern waren sogar mit Reif überzogen. Ich sprang wie ein Besessener im Wagen herum, schlug mit den Armen und pustete in die Hände bei klappernden Zähnen, um mich nur einigermaßen warm zu erhalten, aber es half nicht viel, ich glaubte tatsächlich, ich würde erfrieren oder mir wenigstens eine schwere Krankheit holen. Endlich, spät abends, in Hannover angekommen, kroch ich mit meinen steif gefrorenen Gliedern aus dem Wagen und rannte, was ich konnte, durch die Bahnhofstraße nach der »Zauberflöte«, meinem Stammlokal, in der Packhofstraße und ließ mir vom »Vater Anton Scheele« einen heißen Grog über den anderen machen. Nachdem ich so etwa ein halbes Dutzend von diesem Heizmaterial im Leibe hatte, wurden meine Lebensgeister wieder angeregt, und ich konnte mit einem gehörigen Schwibbs nach Hause in die Langelaube taumeln.
[10.7 Bahnbau auf Java? Nein.]
Meine Pläne, zum Eisenbahnhochbaufach überzugehen, waren somit gescheitert. Aber beinah hätten sie sich doch noch verwirklicht, allerdings auf eine wesentlich andere Art. Eines Tages folgte ich einer Einladung zu Kirchwegers; dort wurde [251] ich einem holländischen Ingenieur aus Amsterdam, mit Namen Bernett, vorgestellt, der an Kirchweger empfohlen war. Bernett war von der holländischen Regierung beauftragt, für Staatskosten eine Eisenbahn auf der Insel Java zu erbauen. Er bereiste zu diesem Zwecke Deutschland, um dort Lokomotiven zu bestellen, und dieserhalb war er an Kirchweger verwiesen, außerdem wollte er auch Bau-Ingenieure anwerben. Da nun Kirchwegers wußten, daß ich bei meinem Versuch, zum Eisenbahnbau überzugehen, keinen Erfolg gehabt hatte, glaubten sie, daß ich vielleicht geneigt sei, mein Glück bei diesem Bahnbau zu versuchen, und veranlaßten durch meine Einladung eine Besprechung mit Bernett. Das Angebot, welches mir dieser Herr machte, war ein überaus verlockendes für mich. Ich hätte mich zunächst auf drei Jahre verpflichten müssen bei einem Gehalt, wenn ich mich recht entsinne, von 12.000 holländischen Gulden. Falls ich das Klima nicht vertragen konnte, war mir freie Rückfahrt und außerdem noch eine Entschädigungssumme zugesichert. Zu meiner Bedienung würde mir eine Anzahl Kulis zur Verfügung gestellt werden, ferner eine größere Fläche Land zur eigenen Ausnutzung. Mir schwindelte bei dem glänzenden Anerbieten, das mir gemacht wurde, ich bat mir einige Tage Bedenkzeit aus, nach denen ich Bernett, der über Hannover nach Holland zurückreiste, Bescheid sagen wollte. – Vor innerer Erregung konnte ich in den nächsten Nächten keinen Schlaf finden, ehe ich zu einem Entschluß kam. Ich ließ mich zunächst von Dr. Elwert untersuchen, der in gesundheitlicher Beziehung keine Bedenken fand, den Schritt zu wagen. Dann erkundigte ich mich bei einem Herrn, der jahrelang in Java gelebt hatte; dieser war allerdings als reicher Mann zurückgekehrt, hatte aber seine Gesundheit geopfert. Selbstverständlich schrieb ich auch meinem Vater alles und bat um seine Ansicht. Mein Vater antwortete mir in dem Sinne, daß er nicht dagegen sein würde, mein Heil in Java zu versuchen, wenn mir seither mein Glücksstern etwa nicht hold gewesen wäre; das sei aber durchaus [252] nicht der Fall, im Gegenteil hätte mich das Glück bis jetzt so begünstigt, wie selten einen. Es wäre ein Schritt ins Ungewisse, den ich tun würde, die Aussichten möchten noch so glänzend sein; meine Gesundheit setzte ich aufs Spiel; ich sollte ferner erwägen, was ich alles entbehren müsse, daß ich allein zwischen halb wilden Menschen zu leben hätte usw., er könne mir also nur abraten. Durch diesen Brief meines Vaters kam ich zu dem Entschluß, im Lande zu bleiben; ich schrieb Bernett ab, der, wie ich erfuhr, auch sonst wenig Erfolg gehabt hatte, nur ein Ingenieur aus Deutschland war seiner Werbung gefolgt. In späterer Zeit teilten mir Kirchwegers mit, daß Bernett nach wenig Jahren seines Aufenthaltes auf Java dem Klima erlegen sei, und wer weiß, wo meine Knochen jetzt bleichten, wenn ich dem verlockenden Rufe gefolgt wäre. Mein Entschluß wurde von meinen Bekannten, vor allem von Buerdorfs, sehr gebilligt, und ich war selbst froh, mit mir ins reine gekommen zu sein, und dachte bald nicht mehr daran.
[10.8 Weitere Aufträge, Umzug an den Theaterplatz]
Ich trachtete nun aber danach, mich baldmöglichst selbständig zu machen und meine abhängige Stellung aufzugeben. In Cassel mich selbständig zu machen, war nach den damaligen traurigen Verhältnissen gänzlich ausgeschlossen, ich mußte also weiter auf mein Glück in Hannover bauen; es war mehreren meiner Kollegen gelungen, geschäftlich in Gang zu kommen; auch mir bot sich ein guter Anfang. Vom Besitzer des Viktoria-Hotels, Hipp, wurde mir der Anbau eines Speisesaales und der Neubau eines mit dem Hotel verbundenen Hauses an der Windmühlenstraße übertragen, für Julius Schneemann, Jäneckes Schwager, in dessen Hause ich eingeführt war, projektierte ich eine Veranda. Mit diesen Aufträgen war ich zunächst zufrieden.
Meine Wohnung bei Jansens gab ich nun auf und bezog eine größere Wohnung in der Sophienstraße, Eckhaus am Theaterplatz – jetzt Monopol-Hotel –, die ich mit einem meiner besten Freunde aus dem Kongreß, Hermann Cohn, der im Bankhause Ezechiel Simon, dem ersten Bankgeschäft [253] Hannovers, mit einem hohen Gehalt angestellt war, gemeinschaftlich mietete. Es war eine schöne Zeit, die ich dort verlebte, wir beiden Freunde standen sehr gut zu einander. Hermann Cohn war der Sohn eines Rabbiners aus Nordhausen; durch seine wundervolle lyrische Tenorstimme, seine musikalische Veranlagung und seine hervorragenden gesellschaftlichen Talente war Cohn in allen Kreisen, in denen er verkehrte, eine sehr gern gesehene, beliebte Persönlichkeit; wir trieben natürlich fleißig Hausmusik. Meinen Mittagstisch nahm ich von nun ab laut Übereinkommen mit Hipp im Viktoria-Hotel ein. Unter den Tischgästen sah man als Abonnenten u.a. auch mehrere Mitglieder des Königl. Hoftheaters, darunter Kapellmeister Fischer, Winkelmann und Albert Niemann, den gefeierten Günstling des hannoverschen Publikums. Es war ein großer Unterschied, diesen gottbegnadeten Künstler auf der Bühne zu sehen, wo er durch seine schöne Erscheinung, seine Stimme und sein vollendetes Spiel zur Bewunderung hinriß, oder bei Tische im Hotel; durch sein rücksichtsloses Verhalten gegen die übrige Tischgesellschaft ließ er oft manches zu wünschen übrig, er konnte damals den früheren Schlossergesellen noch nicht immer verleugnen. –
Das Jahr 1865 verlief ohne besondere bemerkenswerte Ereignisse. Durch Arbeiten war ich nicht überbürdet, die Bautätigkeit hatte im allgemeinen nachgelassen. Bei der vielen freien Zeit, die mir zu Gebote stand, fand ich jetzt öfter Gelegenheit, schon nachmittags meine Besuche auf dem Döhrener Turm zu machen und dort glückliche Stunden in der Familie Buerdorf zu verleben. Auch Freund Cohn mit mehreren seiner Kollegen vom Bankhause Ezechiel Simon waren durch mich in der Familie eingeführt und waren dort gern gesehene Gäste.
[10.9 Geldsorgen und neue Projekte]
Meine geschäftlichen Einnahmen blieben infolge der unzureichenden Aufträge wesentlich hinter meinen Erwartungen zurück; ich kam oftmals in große Verlegenheit, wenn keine Zahlungen erfolgten. In solchen Fällen mußte ich bei meinem [254] Freund Cohn einen Pump anlegen, um die notwendigsten Auslagen bar bestreiten zu können; er war auch stets bereit, mir hilfreich unter die Arme zu greifen. So lange ich noch mein festes Gehalt bezog, konnte ich auch alles regelmäßig bezahlen, jetzt aber mußte ich zu meinem Leidwesen manches schuldig bleiben und vertröstete meine Lieferanten auf zu erhoffende bessere Einnahmen. Aber sie wollten nicht kommen, ich war sogar einige Zeit beschäftigungslos und mußte mich mit einem Verdienst behelfen, den mir ein Sangesbruder aus der Union, Tapetenfabrikant Stolberg, zuwies; ich hatte für ihn Tapetenmuster zu entwerfen, die er gut bezahlte. Ich wurde ihm aber zu produktiv, und er wurde mir zu wählerisch, so daß ich diese Tätigkeit nach einiger Zeit wieder einstellte. Bald darauf bekam ich einen größeren Auftrag von einem Getreidehändler namens Steinberg, der den Eckplatz zwischen den damals über das Terrain des alten Packhofs neu angelegten Straßen – der verlängerten Packhof- und verlanger ten Andreästraße – gekauft hatte und auf diesem einen großen Neubau errichten wollte. Außerdem übertrug mir der kaiserlich russische Hofrat Meyer den Umbau seines Hauses an der Hildesheimerstraße, dem dann ein Auftrag zu einer Doppel-Villa an der Weinstraße folgte.
[10.10 Verlobung mit Sophie Buerdorf]
Jetzt blühte wieder mein Weizen, ich war vollauf beschäftigt, weil ich allein ohne zeichnerische Hilfe die mir übertragenen Projekte ausarbeitete. – Ich schmiedete nunmehr schon Pläne für die Zukunft; mein sehnlichster Wunsch ging in Erfüllung, ich verlobte mich an ihrem 16. Geburtstage mit Sophie Buerdorf, die inzwischen zur lieblichen Jungfrau herangewachsen war. – Ihr Geburtstag folgte einen Tag nach dem meinen, ich hatte am 22. Februar 1866 mein 24. Lebensjahr zurückgelegt und der 23. Februar war unser Verlobungstag und Sophiens Geburtstag. Daß Mutter Buerdorf diesen Herzensbund gern sah, darüber war ich nicht im Zweifel; Vater Buerdorf jedoch war nicht recht damit einverstanden, daß sich seine Tochter schon so früh verlobte, aber [255] er hatte es längst gemerkt, daß wir beide uns gern hatten, und willigte schließlich auch ein. So wurde das wahr, was ich erstrebt hatte, wir waren nun Brautleute und ich fühlte mich überglücklich, das liebe, herzige Mädchen jetzt ganz die Meine nennen zu können. Daß noch einige Jahre darüber hingehen mußten, ehe wir uns heiraten konnten, war selbstverständlich; meine Braut war noch zu jung, und ich hatte noch kein Einkommen, um eine Frau ernähren zu können. Doch ich vertraute meinem Glücksstern und hoffte, nach einigen Jahren so viel zu verdienen, daß ich meine Sophie heimführen und mir einen eigenen Hausstand gründen konnte.
[10.11 Ausbleibende Zahlungen, Prozeß]
Bald nach meiner Verlobung aber traten ernste Sorgen an mich heran, die einen trüben Schatten auf mein junges Liebesglück warfen. Die Einnahmen für meine architektonischen Arbeiten, auf die ich sicher gerechnet hatte, blieben nämlich aus. Nachdem ich monatelang an den Projekten für Steinberg gearbeitet und diese an meinen Auftraggeber abgeliefert hatte, verlangte ich von diesem eine Abschlagszahlung. Er zählte mir darauf 25 Taler auf den Tisch; ich erklärte ihm, daß ich eine größere Zahlung von mindestens 100 Talern beanspruche, weil ich seit Monaten nur für ihn allein gearbeitet habe. St., der mich mehrmals besucht hatte, wußte dies auch, ich war deshalb sehr erstaunt, wie er über meine Forderung aufbrauste. Ich entgegnete ihm, daß ich ein Honorar von 400 Talern, ja sogar mehr, zu fordern berechtigt sei; kalt lächelnd erklärte er mir, es sei zwischen uns nichts Bestimmtes abgemacht, er wolle nun überhaupt gar nichts zahlen; das aufgezählte Geld strich er wieder ein und sagte, ich möge ihn verklagen. Über diese schmähliche Handlungsweise Steinbergs, den ich seither für einen anständigen Mann gehalten hatte, war ich natürlich sehr aufgebracht und erklärte sofort, ihm den Prozeß machen zu wollen.
Ich nahm meine Zeichnungen wieder an mich und ging zu Baurat Droste, um dessen Rat zu hören; dieser riet mir, ohne weiteres klagbar gegen St. vorzugehen und eine Forderung [256] von mindestens 400 Talern zu stellen, die er für meine Arbeiten als durchaus angemessen bezeichnete; er bot sich an, mir als Sachverständiger mit einem Gutachten beizustehen, den Prozeß müsse ich nach seiner Ansicht zweifellos gewinnen.
Auf anderem Wege zu meinem Gelde zu kommen, war ausgeschlossen, ich mußte also klagen. Man kann sich denken, in was für einer Gemütsverfassung ich damals war; seit Monaten fast ohne Einnahme, mußte ich noch obendrein einen Prozeß führen – eine Sache, von der ich bis dahin kaum eine Ahnung gehabt hatte. Einem mir bekannten Advokaten, dem Rechtsanwalt Dr. Schnell – er war in Sangeskreisen als lyrischer Tenor eine gesuchte Persönlichkeit – vertraute ich mich an und übertrug ihm die Klage gegen Steinberg. Zum Klagen aber gehört bekanntlich zunächst Geld, um die nötigen Kostenvorschüsse zu leisten; die wenigen Mittel, die ich noch zusammentreiben konnte, reichten nicht aus, ich mußte eine Anleihe machen, zu der sich mein Freund Hermann Cohn bereit fand.
Es waren trübe Zeiten, durch die ich mich nun hindurchringen mußte; aus der Notlage, in die ich unverschuldeterweise hineingeraten war, machte ich kein Hehl, ich mußte mich wieder mal aufs äußerste einschränken, um nicht immer tiefer in Schulden hineinzugeraten. – Aber ich fand wieder gute Menschen, die mich unterstützten, zunächst meine nunmehrigen Schwiegereltern, bei denen ich mich wenigstens etwas durchfüttern durfte, dann aber war mein väterlicher Freund, Baurat Droste, derjenige, der mir in meiner bedrückten Lage wieder mal beistand; er bot mir an, bei ihm zu wohnen, er hatte im neuen Packhofsgebäude eine geräumige Dienstwohnung. Sein einziger Sohn Louis war kurz vorher nach Amerika ausgewandert, um dort sein Glück zu versuchen; dessen Zimmer stellte er mir zur Verfügung. Dies überaus freundliche Anerbieten nahm ich natürlich dankbar an und kündigte meine seitherige Wohnung. Ich hoffte, nach dem glücklichen Ausgang meines Prozesses mich auf irgend welche Weise erkenntlich zeigen zu [257] können. Leider erfüllte sich meine Hoffnung nicht; allerdings fiel der Prozeß günstig für mich aus, ich gewann ihn infolge des Gutachtens der Sachverständigen, Baurat Hase und Baurat Droste. Steinberg aber zahlte nicht, er suchte in der zweiten Instanz am hannoverschen Obergericht mir meine Forderung streitig zu machen, aber auch hier gewann ich den Prozeß, Steinberg war zur Zahlung von 400 Talern verurteilt und hatte die sämtlichen Kosten zu tragen.
Ich war jetzt glücklich und glaubte mich aus allen Sorgen heraus, aber es war eine bittere Täuschung, Geld bekam ich immer noch nicht. – Wie die Sache schließlich auslief, werde ich später noch erzählen. –
[10.12 Zwist zwischen Österreich und Preußen]
Inzwischen hatten sich am politischen Horizont Wetterwolken zusammengezogen, deren Entladung über kurz oder lang erfolgen mußte. Das Verhältnis zwischen den beiden deutschen Großmächten, Österreich und Preußen, wurde nach der gemeinschaftlichen Besitzergreifung der von Dänemark eroberten Elbherzogtümer Schleswig und Holstein ein immer gespannteres. Die Nachrichten über politische Vorgänge drangen aber damals nur spärlich in die Öffentlichkeit, das große Publikum erfuhr nur wenig von dem, was sich in der hohen Politik hinter den Kulissen abspielte, was aber heutzutage brühwarm durch den Telegraph oder Telefunken sofort über den ganzen Erdball verbreitet wird.
Man wußte wohl, daß vieles faul im deutschen Bunde war, daß die deutsche Einigkeit, die ja immer nur ein Phantom war, über kurz oder lang ganz in die Brüche zu gehen drohte. Die damaligen Zustände in unserem, durch seine Kleinstaaterei zerrissenen Vaterlande wurden immer unhaltbarer; man war sich darüber klar, daß es demnächst zur Entscheidung kommen müsse, wem von den beiden Rivalen, Österreich oder Preußen, die Oberherrschaft im deutschen Reiche zufalle. Die deutschen Fürsten hatten sich in zwei Lager gespalten; diejenigen, die dem Drängen der Nation Rechnung trugen und dazu bereit waren, im Interesse einer einheitlichen, machtvolleren Gestaltung [258] des deutschen Reiches einen Teil ihrer Herrschaftsrechte zu opfern, hielten zu Preußen, die andern, die von ihrer Souveränität nichts opfern wollten, die in ihrer Verblendung ihre eigene Machtstellung bei weitem überschätzten, hielten zu Österreich, und zu diesen gehörte der König Georg von Hannover und mein eigener Landesvater, der Kurfürst von Hessen. Der größte Teil des deutschen Volkes, voran das protestantische Deutschland, stand unentwegt zu Preußen, dessen großer Staatsmann Bismarck mit fester Hand die Geschicke Preußens leitete. Zielbewußt allein die zukünftige Größe Deutschlands sich vor Augen haltend, ging er unbeirrt seinen Weg; er wußte, daß das Heil und die Einigung Deutschlands nicht durch das vielsprachige Staatengebilde Österreich, sondern nur durch die kerndeutsche Großmacht Preußen zu erlangen war. Österreich mußte gezwungen werden, seine Machtstellung im deutschen Bunde aufzugeben, darauf war Bismarcks ganze Politik gerichtet. Daß dieses Ziel nicht auf diplomatischem Wege zu erreichen war, hatte Bismarck, der die österreichischen Ränke als Bundestagsgesandter in Frankfurt kennen gelernt hatte, vorausgesehen. Er wußte, daß Deutschlands Einigung und die Wiederherstellung des deutschen Reiches nicht anders als durch »Blut und Eisen« erkämpft werden konnte. Mit diesen Worten, die er in der Zeit des Konfliktes mit der preußischen Volksvertretung den Mut hatte, offen auszusprechen, hatte er, infolge vollständiger Verkennung seines Strebens, tiefen Unwillen im deutschen Volke hervorgerufen; er, der vermeintliche preußische Junker, war der »bestgehaßte« Mann, Mordbuben trachteten ihm sogar nach dem Leben. Aber unentwegt setzte Bismarck seine ganze Persönlichkeit dafür ein, »Deutschland in den Sattel« zu heben; in einer Zeit, wo alle Welt gegen ihn war, wußte nur sein König, was er an ihm hatte. Dem Genie dieses gewaltigen Staatsmannes vertraute der König, der Staatskunst Bismarcks gelang es, gegen den Willen der Volksvertretung die Heeresreorganisation Preußens im Bunde mit Roon und Moltke durchzusetzen, und so Preußens Armee auf [259] eine Stufe zu erheben, daß sie in der Welt unübertroffen dastand. Bismarck erkannte auch, daß die schleswig-holsteinische Frage zum Heile Deutschlands nur durch die Vereinigung der eroberten Landesteile mit Preußen zu lösen sei. Mit preußischem Blute und unter schweren Opfern war die Befreiung der Elbherzogtümer durch den siegreichen Sturm auf die Düppeler Schanzen und den Übergang nach der Insel Alsen erkauft. Als leitender Minister konnte Bismarck deshalb seinem König niemals dazu raten, diese teuer errungenen Landesteile einem Thronprätendenten, dem Erbprinzen Friedrich von Augustenburg, als reife Frucht in den Schoß fallen zu lassen. Hierhin zielte die Politik Österreichs, das den Erbprinzen zum Herzog über die geeinten Elbherzogtümer eingesetzt wissen wollte; zu den vielen Kleinstaaten wäre dann noch ein weiterer hinzugekommen. Preußen aber wollte außerdem seine Besitz- und Hoheitsrechte, die ihm für Holstein bereits eingeräumt waren, auf keinen Fall aufgeben; so sah sich denn der König von Preußen genötigt, Österreich vor den Kriegsfall zu stellen, wenn es das preußische Mitbesitzrecht in den Herzogtümern nicht achte.
[10.13 Hannover beim Herannahen des Krieges]
Der Krieg nahte unvermeidbar heran, das fühlte man allgemein aus den Berichten heraus, die über den Stand der schleswig-holsteinischen Frage in die Öffentlichkeit drangen. Alle Bundesstaaten machten sich kriegsbereit und rüsteten; auch in Hannover herrschte eine fieberhafte Tätigkeit, um die Ausrüstung der Armee zu vervollständigen. Von meiner Wohnung im Packhofsgebäude, das unmittelbar an die Bahnhofsanlage grenzte, konnte ich beobachten, was sich auf dem Bahnhofe abspielte; ununterbrochen, Tag und Nacht wurden Militär-Effekten aller Art verladen, die an die Garnisonplätze im Lande versandt wurden. Gegen Ende Mai kamen Extrazüge mit preußischem Militär durch Hannover; man wunderte sich sehr darüber, man glaubte darin ein günstiges Zeichen zu erblicken, daß Hannover neutral bleiben würde. Auch gab man sich der Hoffnung hin, daß es gar nicht zum Bruderkriege in [260] Deutschland kommen werde, daß aus dem Säbelgerassel schließlich doch kein Ernst gemacht und wieder abgerüstet werde; leider aber täuschte man sich.
Die Gärung in Hannover wuchs von Stunde zu Stunde; die beiden hannoverschen Kammern waren zusammenberufen; in der zweiten Kammer traten die liberalen Abgeordneten, an der Spitze Rudolf von Bennigsen, energisch dafür ein, daß Hannover sich für den Kriegsfall zwischen den deutschen Großmächten neutral verhalte, und beschlossen eine Petition an den König.
In diesen aufgeregten Tagen hatte man für nichts anderes Sinn, wie für politisches Kannegießern, an Arbeiten war nicht zu denken. Mit Freunden und Bekannten saß man in den Kneipen. Dort konnte man immer das Neueste direkt erfahren; wir Freunde hatten unser Hauptquartier in Hartmanns Biertunnel. Dorthin wurde alles berichtet, was der eine oder andere in Erfahrung gebracht hatte; ein alarmierendes Gerücht folgte dem andern.
Am 11. Juni kamen die Österreicher, die sich aus Holstein nach dem Einrücken der preußischen Truppen zurückgezogen hatten, mit Extrazügen über Hannover. Es war die Brigade Kalik, der man durch ihre rühmliche Auszeichnung in früheren Feldzügen den Ehrennamen »die eiserne Brigade« beigelegt hatte. In der Nacht folgte der Oberkommandeur, Feldmarschallleutnant von Gablenz; die Österreicher wurden auf dem Bahnhof von hannoverschen Offizieren empfangen und jubelnd begrüßt.
Drei Tage darauf beschloß die deutsche Bundesversammlung in Frankfurt auf Antrag Österreichs die Mobilisierung des Bundesheeres nebst Reserven, ausschließlich Preußens; Hannover und Kurhessen stimmten dafür. Preußen erklärte infolgedessen seinen Austritt aus dem Bunde und richtete sofort ein Ultimatum an Hannover, in welchem Abrüstung und Neutralität gefordert wurde; der König aber lehnte das Ultimatum ab. Darauf erfolgte die Kriegserklärung Preußens [261] an Österreich am 16. Juni, zugleich auch die Kriegserklärung an Hannover. Jetzt sollte das Schwert über die Geschicke Deutschlands entscheiden; was früher für unmöglich gehalten wurde, traf ein: es kam zum Bruderkampf.
[10.14 Kriegserklärung, Hannover auf Seite Österreichs]
Etwa acht Tage vorher waren auf dem Döhrener Turm Verwandte aus Hamburg, die Cousinen meiner Braut – Helene Buerdorf und Lina Möhrken –, beide jung verheiratet, zu Besuch eingetroffen, deren Männer nach einigen Tagen kamen, um sie abzuholen. Wir wollten am 16. einen gemeinschaftlichen Ausflug nach Herrenhausen unternehmen und gingen ahnungslos, ohne von der inzwischen eingetroffenen Kriegserklärung etwas zu wissen, zur Stadt. Die Kriegserklärung war eben bekanntgegeben und an den Straßenecken angeschlagen, an denen sich die Massen angesammelt hatten; alles war in fieberhafter Erregung. Unter diesen Umständen hielten es die Hamburger für geraten, ihren Aufenthalt in Hannover abzubrechen; wir erkundigten uns sofort am Bahnhof nach dem Abgang der Züge und erfuhren dort, daß auf der Bahnstrecke nach Hamburg die Schienengleise aufgebrochen seien, die einzige Strecke, um nach Hamburg zu kommen, sei die über Magdeburg, aber auch diese könne zerstört werden. In größter Eile kehrten die Hamburger nach dem Döhrener Turm zurück und rüsteten sich zur schleunigen Abreise von Hannover, die an demselben Nachmittag noch erfolgte.
Ich blieb nun in der Stadt und in steter Fühlung mit dem, was sich vor dem Bahnhof abspielte. Nach kaum einer Stunde marschierten schon mehrere Bataillone der hannoverschen Infanterie zum Bahnhof, vor dem sich eine große Volksmenge angesammelt hatte, um die Truppen abfahren zu sehen. Ich begab mich in meine Wohnung und fand dort die beste Gelegenheit, vom Fenster herab das wilde Haften und Treiben in der Straße vor dem Packhof, die auf die Verladegeleise des Bahnhofs führte, ungestört zu beobachten. Jetzt wurde aus dem Zeughaus Wagen auf Wagen des Armeetrains zur Bahn gefahren und mit ihren Bespannungen in die Eisenbahnwagen [262] verladen. Es war ein wirres Durcheinander, ein wüstes Schreien, Schimpfen und Kommandieren, daß einem Hören und Sehen verging. Zwischendurch kamen Leiterwagen, vollbeladen mit Waffen, uniformen, Stiefeln und Lederzeug, dann ein Artilleriepark mit Kanonen und Munitionswagen, alles drängte und staute sich unter unsern Fenstern, Leute eilten hin und her, kunterbunt wurde alles in die Waggons geschafft, wenn diese voll beladen waren, wurden die Züge einer nach dem andern abgelassen – es war alles eine wilde Flucht, die mir unvergeßlich in der Erinnerung geblieben ist.
In der folgenden Nacht, die ich mit meinen Freunden bei Hartmann verbrachte, – an Schlaf war nämlich nicht zu denken – wurde die Nachricht verbreitet, daß eine Deputation der städtischen Körperschaften, unter Führung des Stadtdirektors Rasch, nach Herrenhausen gefahren sei, um den König in letzter Stunde dringend zu bitten, die Stadt und das Land nicht zu verlassen, seine Neutralität zu erklären und damit dem Lande die Segnungen des Friedens zu erhalten. Der König aber verhielt sich entschieden ablehnend und brauchte am Schluß seiner Entgegnung die bekannten Worte, daß er »als Christ, Monarch und Welf« nicht habe anders handeln können. – Kurz darauf, nachdem die Mitglieder der Deputation zurückgekommen waren, kamen auch schon königliche Hofequipagen zum Bahnhof gefahren, mit der nächsten Umgebung des Königs. Ihnen folgte alsbald der König mit dem Kronprinzen, der unerkannt im geschlossenen Wagen durch die Menge fuhr. Als der König abgefahren war, folgte eine große Anzahl königlicher Wagen, einige enthielten die Schätze der Silberkammer, dann kamen die edelsten Pferde aus dem königlichen Marstall, die mit den nächsten Zügen Hannover verließen. Eine ernste, gedrückte Stimmung bemächtigte sich aller derer, die in dieser Nacht bei dem traurigen Abschied des Königs aus seiner Residenz auf dem Bahnhof und in dessen nächster Umgebung zugegen waren, viele Leute weinten. Auch [263] wir gingen nach der Abreise des Königs erst am Morgen auseinander, die meisten mit dem wehmütigen Gedanken, daß »Schorse« in seine Residenz wohl kaum mehr zurückkehren werde.
[10.15 Mobilisierungwirren, Preußen rücken ein]
Am folgenden Tage glich der Bahnhofsplatz einem Feldlager, er war voll besetzt mit Truppen, die nacheinander verladen wurden. Gegen Mittag kam ein Regiment hannoverscher Husaren – wenn ich nicht irre, waren es die Verdener Garde-Husaren – durch die Stadt über den Georgenwall, die der Armee in der Richtung auf Göttingen in Eilmärschen folgten. Das Treiben vor dem Packhofsgebäude war womöglich noch toller, wie am Tage vorher, der Janhagel beteiligte sich jetzt am Transportieren der Militäreffekten aus dem Zeughause. Weil es an Gespannen fehlte, wurden die beladenen Wagen von Personen – besonders waren es halbwüchsige Jungen – gezogen, deren Inhalt von diesen in die Waggons verladen wurde. Dabei würde vielfach gestohlen; Droste und ich haben mit angesehen und uns gegenseitig darauf aufmerksam gemacht, wenn der Pöbel Kleidungsstücke, darunter besonders Drelljacken und Hosen, die mehrfach übereinander angezogen wurden, oder wollene Decken u.a. beiseite schaffte – comme à la guerre – es krähte weder Huhn noch Hahn danach!
Durch die beispiellose Kopflosigkeit, die sich überall zeigte, weil keine einheitliche Leitung von oben herab vorhanden war, waren wir alle sehr aufgebracht; jedermann machte seinem Unwillen Luft in Verwünschungen, weniger gegen den bedauernswerten blinden König, wie gegen dessen unfähige Ratgeber, welche das Land ohne Grund in Unruhe und schwere Verluste gestürzt hatten. Es wurde später auch bekannt, daß das Offizierkorps sehr erbittert darüber war, daß die Truppen, ohne genügend zum Kriege gerüstet gewesen zu sein, die Hauptstadt verlassen mußten; es fehlte eben an allem, was zum Kriegführen erforderlich war, besonders an Munition. Eine sehr große Menge vorzügliches, nagelneues [264] Kriegsmaterial, das nicht mehr fortgeschafft werden konnte, fiel den Preußen in die Hände, die bereits am Abend unter General Vogel v. Falkenstein in Hannover einrückten, gerade als die letzten hannoverschen Truppen noch auf dem Bahnhof eingeladen wurden. Drei preußische Husaren, die mit gespanntem Karabiner als Aufklärungspatrouille plötzlich auf dem Bahnhofsplatz erschienen, aber gleich wieder umkehrten, kündeten zum Glück das Eintreffen der Preußen in der Stadt an, so daß der Militärzug schleunigst abdampfen konnte, sonst hätten die letzten hannoverschen Truppen noch zu Gefangenen gemacht werden können. Zugleich mit dem Eintreffen der Preußen wurde eine Proklamation des Generals Vogel von Falkenstein an allen Straßenecken angeklebt, worin derselbe die Okkupation des Landes und seine Ernennung zum Generalgouverneur ankündete und beruhigende Erklärungen für die besorgte Bevölkerung abgab.
Am 18. Juni rückte durch das Steintor, von Westfalen kommend, die Brigade Goeben in die Stadt ein. – Ich ging schon vormittags hinaus nach dem Döhrener Turm, wo ich sehnsüchtig erwartet wurde, um Näheres über die Vorgänge in der Stadt zu berichten. Bald nach mir kamen preußische Truppen, die ersten, die auf der Hildesheimerstraße am Döhrener Turm vorbeizogen, es waren die Halberstädter Kürassiere, die in den Dörfern Döhren, Wülfel und Latzen Quartier bekommen sollten. Das Kavallerie-Regiment hatte eine gewaltige Strecke in den letzten beiden Tagen fast ohne Unterbrechung in Eilmärschen zurückgelegt. Pferde und Reiter waren über und über mit Staub bedeckt, man sah allen die Ermüdung durch die großen Strapazen an. Wir standen mit unseren Damen in der Haustür, um die Truppen ankommen zu sehen; dem Regiment voraus sprengte ein stattlicher Kürassier, anscheinend ein zum Quartiermachen beorderter Vize-Wachtmeister, der vor dem Döhrener Turm anhielt, um sich bei uns nach den Wegen zu den genannten Dörfern zu erkundigen. Er hielt so lange an, bis das Regiment [265] herangekommen war, und unterhielt sich wärenddessen einige Minuten mit uns; wir konnten aus der Unterhaltung und seinen guten Manieren entnehmen, daß es ein fein gebildeter Mann war. Beim Eintreffen des Regiments schloß er sich der Spitze desselben an, nachdem er sich höflich verabschiedet hatte.
In ernster, ruhiger Haltung ritt das Regiment an uns vorüber, die meisten Offiziere grüßten zuvorkommend; am Schluß des langen Zuges folgten Reservepferde, Lazarettwagen, eine Feldschmiede, mehrere Fouragewagen und schließlich ein Markadenterwagen. Wir waren erstaunt über die komplette kriegsmäßige Ausrüstung dieses Regiments; alles dies hatte man bei den hannoverschen Truppen völlig vermißt. Der Eindruck, den diese ersten preußischen Truppen auf uns machten, war, was wir uns nicht verhehlen konnten, ein äußerst vorteilhafter, aber auch zugleich ein beklemmender, denn das wurde uns allen klar, daß die hannoversche Armee, die mit total unfertiger Ausrüstung ins Feld gezogen war, diesen kriegsgeübten, vorzüglich ausgerüsteten Truppen keinen dauernden Widerstand leisten könne.
Gleich darauf, nachdem das Kavallerie-Regiment auf der Hildesheimerstraße vorübergezogen war, sahen wir vom Garten aus über die Masch hin mächtige Infanteriekolonnen auf einer anderen Straße jenseits der Leine andauernd nach dem Süden marschieren.
[10.16 Einquartierung im Döhrener Turm]
Am Nachmittag stellte sich der stattliche Kürassier auf dem Döhrener Turm wieder ein und meldete sich für die nächste Nacht als Einquartierung an. Er war ein Reservist, der durch die Mobilmachung eingezogen war, und seines Zeichens Gutsbesitzer. Mit seiner reckenhaften Figur imponierte er beisonders den jüngeren Familienmitgliedern, denen gegenüber er scherzhaft bramarbasierte und u.a. mit seinem großen Pallasch aus den Steinplatten des Hausflurs Funken schlug; er wollte damit nur den Feind markieren, meinte es aber durchaus nicht böse; nichts weniger wie feindlich gesonnen, war [266] er im Gegenteil ein Mann von größter Liebenswürdigkeit, der seinen Abscheu gegen den bevorstehenden Bruderkampf unverhohlen aussprach; in früher Morgenstunde des folgenden Tages war er schon wieder verschwunden mit samt seinem Regiment.
Nach dem Durchzug der preußischen Truppen, die nur eine geringe Besatzung in Hannover zurückgelassen hatten, war man in der Stadt völlig im Ungewissen; alle möglichen Gerüchte gingen um; es hieß, die Hannoveraner hätten sich mit den Kurhessen vereinigt, dann wieder sollte die hannoversche Armee kapituliert haben; man war über das Schicksal derselben sehr in Sorge – wie dies schon so rasch über die Armee hereinbrach, ist bekannt.
[10.17 Pyrrhussieg bei Langensalza]
Eine Vereinigung mit kurhessischen Truppen kam nicht zustande; der hannoversche Befehlshaber, General v. Ahrentschild, rechnete mehr auf die Hilfe der Bayern, zögerte aber zu lange mit dem Marsche ihnen entgegen, so daß die Preußen Zeit fanden, den Weg nach Süden den Hannoveranern zu verlegen. Bei Langensalza konnte der Weitermarsch nur durch einen Kampf gegen die von allen Seiten heranziehenden Preußen erzwungen werden. Ehe es aber zum Kampfe kam, versuchte Preußen in letzter Stunde nochmals eine Einigung herbeizuführen. Hans Blum berichtet darüber in seinem Werke über »Fürst Bismarck und seine Zeit« wie folgt: »Noch jetzt hätte der König Georg Land und Krone retten können, wenn er Bismarcks bescheidene Forderung – in einem Telegramm vom 22. Juni – genehmigt hätte, für die Waffenruhe der Hannoveraner Garantien zu geben und Preußens Bündnis anzunehmen. Der König aber herrschte den preußischen Unterhändler, Oberst von Döring, als dieser auf des Königs Frage, in wessen Auftrage er komme, Bismarcks Namen nannte, mit den Worten an: ›Was will der Mensch? Ach was, Bündnis!‹ usw. Nicht nur sein Auge, auch sein Geist war verblendet. So scheiterten denn all diese noch mitten im Waffengang fortgesetzten friedlichen Verhandlungen.«
[267] Die Preußen, obgleich numerisch bedeutend schwächer wie die Hannoveraner, griffen diese an – es kam zur »Schlacht bei Langensalza«, in der die Hannoveraner bekanntlich siegreich blieben. Leider aber konnten sie ihren Sieg nicht ausnutzen, sie wurden inzwischen auf allen Seiten von überlegenen feindlichen Streitkräften umstellt und mußten am 29. Juni die Kapitulation abschließen. Die Munition und das Kriegsmaterial wurde den Preußen übergeben, die Mannschaften wurden entwaffnet und nach Hause entlassen, die Offiziere mußten sich verpflichten, im gegenwärtigen Kriege nicht gegen Preußen zu dienen, der König und der Kronprinz erhielten die Erlaubnis, ihren Wohnsitz außerhalb Hannovers zu nehmen, wo es ihnen beliebe; sie begaben sich zu ihrem Verbündeten nach Österreich. – Hannover sahen sie nicht wieder.
Die Nachricht von der blutigen Katastrophe bei Langensalza wirkte zuerst niederschmetternd auf die Bewohner, von denen eine große Anzahl Angehörige, besonders viele Offiziere unter den ausgezogenen Truppen sich befanden. Ein trauervoller Ernst bemächtigte sich aller; es war ein Jammer, mit anzusehen, wie die bekümmerten Anverwandten die Post und Zeitungsexpeditionen umlagerten, um Nachricht über die Verwundeten oder Gebliebenen zu erhalten. Ich sah Personen schluchzend und händeringend aus dem neben dem Packhof liegenden Postgebäude herauskommen, die einige von den Ihrigen auf den dort ausgehängten Verlustlisten verzeichnet fanden.
Zugleich mit der ersten Nachricht traf der Notschrei vom Kriegsschauplatz ein, daß es überall mangele, um den vielen Verwundeten die nötige Hilfe zu gewähren. Diese Mitteilung setzte die Bevölkerung ganz besonders in Aufregung. Es wurden öffentliche Aufrufe erlassen, die zur schleunigen freiwilligen Beschaffung des Notwendigsten, vor allen Dingen von Verbandzeug, aufforderten. Es gingen binnen kürzester Zeit Extrazüge ab, welche die reichlich eingehenden Gaben an Verbandzeug, Strohsäcken, Matratzen und Nahrungsmitteln den [268] Bedrängten zuführten; mit diesen Zügen fuhr auch eine Anzahl Personen, darunter auch mehrere meiner Freunde, die sich dem Dienst der freiwilligen Krankenpflege widmen wollten. Am zweiten Tage nach der Schlacht trafen schon die ersten leichtverwundeten Offiziere in Hannover ein, denen bald darauf die Mannschaften folgten. Die Rückkehrenden boten einen traurigen Anblick, ein Teil trug noch die zerrissenen oder zerschossenen. Uniformen. Bei allen, wohl ohne Ausnahme, herrschte das Gefühl der Erbitterung darüber, daß die Armee so nutzlos geopfert war.
[10.18 Hannover und Kurhessen werden preußisch]
Die Schlacht von Langensalza war entscheidend für das Los Hannovers und seines Königs, der sein Land und seine Krone einbüßte; Hannover hörte auf, ein selbständiges Königreich zu sein. Der König von Preußen ergriff mittels Patents vom 20. September 1866 vom Königreich Hannover Besitz, das fortan eine Provinz des preußischen Staates bildete. Ebenso vollzog sich das Geschick meines engeren Heimatlandes – Kurhessen ging auch in den Besitz der Krone Preußens über. –
Es fiel den Bewohnern der Stadt Hannover, der seitherigen königlichen Residenz, schwer, sich mit der neuen Ordnung auszusöhnen; man befürchtete allgemein, daß die Stadt als nunmehrige Provinzialstadt an Ansehen verlieren und in ihrer Entwickelung sehr benachteiligt werde. Namentlich der hannoversche Adel vermochte sich gar nicht mit der preußischen Herrschaft zu befreunden, er verzog infolge dessen zum größten Teil aus der Stadt. Ebenso hielt die Beamtenschaft zum größten Teil noch treu zu ihrem König und fügte sich nur widerstrebend in die neuen Verhältnisse. Zu denen, die sich mit diesen Verhältnissen gar nicht abfinden konnten und wollten, gehörte Baurat Droste; er war ein erbitterter Gegner Preußens bis an sein Lebensende. Auch der uns von Frankreich aufgedrungene Krieg im Jahre 1870 vermochte in seiner feindlichen Gesinnung gegen Preußen nichts zu ändern. Bei Gelegenheit eines Besuches im Sommer desselben Jahres machte er mir gegenüber seinem Herzen Luft, er konnte den Haß gegen Preußen in seinen Worten nicht zügeln und machte [269] aus seiner Sympathie für Frankreich kein Hehl. Sein sehnlichster Wunsch war der, daß Frankreich in diesem Kriege Sieger bleibe und dann den König von Hannover in sein ihm geraubtes Land wieder einsetze; das war bekanntlich die Hoffnung aller Welfen. – Mein Versuch, eine nationale Saite bei ihm anzuschlagen, mißlang vollständig; ich bedauerte, nicht mit ihm in ein Horn blasen zu können; es kam zu erregten Auseinandersetzungen über unsere politischen Ansichten, die schließlich dazu führten, daß wir unfreundlich von einander schieden. Die Entfremdung, die zwischen uns nach diesem Auftritt eintrat, blieb leider eine dauernde, wir sind uns nie wieder näher getreten; Droste schied unversöhnt mit der Neugestaltung unseres großen Vaterlandes aus dem Leben. Wie hochgeachtet dieser edle Mann dennoch bei seinen Mitbürgern stand, beweist das auf seinem Grabe ihm errichtete Denkmal; – was ich ihm verdanke, habe ich geschildert; bei mir bleibt sein Andenken hoch in Ehren!
[10.19 Geldsorgen, Rückkehr nach Kassel]
Doch zurück zum Jahre 1866.
Nach der vollzogenen Annektion des Königreichs Hannover durch Preußen war die Stimmung in der Stadt Hannover zunächst eine sehr gedrückte, der Pessimismus trieb überall seine Blüten. Man fragte sich: »Was wird aus Hannover werden ohne seine glanzvolle Hofhaltung mit allem, was drum und dran hängt? Aus einer prunkvollen Residenz eine minderwertige Provinzialstadt!« – Alle diese Sorgen wirkten natürlich lähmend auf die Erwerbsverhältnisse, besonders aber auf die Bautätigkeit ein, die mit einem Mal völlig darniederlag. Ich persönlich hatte gar nichts mehr zu tun, meine einzigen Einnahmen erwartete ich von Steinberg, der noch immer nicht bezahlt hatte. Mein Anwalt Dr. Schnell hatte nach erfolgloser Beitreibung der eingeklagten Schuld die Exekution beantragt, die aber auch keinen Erfolg hatte; Steinberg behauptete, nichts zu besitzen. Infolge dessen war ihm der Manifestationseid auferlegt, den er an einem dazu bestimmten Termin leisten sollte. Ich war natürlich in einer steten Aufregung über die schuftige Handlungsweise, die ich [270] diesem Manne niemals zugetraut hätte. An dem festgesetzten Termin, zu dem ich mich eingefunden hatte, wurde Steinberg mehrmals aufgerufen, ohne jedoch zu erscheinen; dagegen kam ein Mann von Steinbergs Kontor, der die überraschende Mitteilung machte, daß Steinberg am Tage vorher abgereist sei, ohne seine Adresse angegeben zu haben. Der Schurke hatte alle verfügbaren Barmittel, die er schon tagelang vorher einkassiert hatte, mitgenommen – es war nichts mehr in der Kasse. – Über das Geschäft des Geflüchteten wurde der Konkurs erklärt, eine große Anzahl Gläubiger hatten dadurch bedeutende Verluste zu erleiden, einige davon waren völlig ruiniert, sogar von einem durch den Zusammenbruch Steinbergs veranlaßten Selbstmord wurde berichtet. Jetzt war für mich in Hannover nichts mehr zu erhoffen, meine Stimmung war eine verzweifelte, ich konnte nicht mehr in Hannover bleiben. Meine mißliche Lage war allen meinen Freunden bekannt, auch den Geschäftsleuten, denen ich noch viel schuldete. Meinen Schwiegereltern erklärte ich, daß mich nun keine zehn Pferde mehr in Hannover halten könnten; ich wollte zunächst zurück nach Cassel und dort bessere Zeiten abwarten. Die einzige bauliche Arbeit, die erst vor kurzem begonnen war – die Villa Meyer an der Weinstraße – blieb vorläufig auch liegen, mich hielt also nichts mehr. Mit schwerem Herzen schied ich nun aus der Stadt, in der ich so glückliche Zeiten verlebt hatte, von meinen vielen lieben Freunden und von der trauten Familie, der ich nun ganz angehörte, vor allem von meiner geliebten Braut; ich ging schuldenbeladen einer ungewissen Zukunft entgegen. Die Forderungen meiner Gläubiger beliefen sich auf 400 Taler, nach damaligen Verhältnissen eine drückende Schuld, die ich allmählich abzutragen versprach. Von allen wurde mir Vertrauen geschenkt, sie ließen mich ohne weiteres abreisen. Meinen Eltern teilte ich meinen Entschluß nach Cassel zurückzukehren, mit, und nachdem ich mein Besitz tum, bestehend in Pianino, Bett, Schrank, Kommode, einigen Stühlen und Zeichenrequisiten, expediert hatte, trennte ich mich von meinen Lieben und Dampfte »ab nach Cassel«.
[271] 11. Wieder in Cassel.
[11.1 Neue Dynamik unter preußischer Herrschaft]
Gegen die Mitte des Monats August siedelte ich mit Sack und Pack wieder in meine Vaterstadt über und kehrte ins Elternhaus zurück; dort konnte ich zunächst abwarten, wie sich die Verhältnisse gestalteten.
Mit Cassel war seit meinem letzten Besuche eine auffallende Veränderung vorgegangen. Mit dem Einmarsch der Preußen war zugleich eine hoffnungsfrohe Zuversicht auf bessere Zeiten eingekehrt, im Gegensatz zu Hannover, wo eine allgemeine Mutlosigkeit vorherrschte. Die Casselaner hatten sich größtenteils rasch in den Wechsel der Herrschaft gefunden. Wenn auch der Verlust der Selbständigkeit unseres Kurstaates in manchen Kreisen beklagt wurde, so mußte man sich doch sagen, schlechter wie es seither war, kann es kaum werden. Dem unpopulären Landesfürsten, der als Kriegsgefangener in Stettin interniert war, wurde keine Träne nachgeweint; das Los, welches ihn betroffen, hatte er selbst verschuldet, er war das Opfer seines eigenen Starrsinnes.
Die Preußen verstanden es, sehr bald sich das Vertrauen der Bürgerschaft zu erwerben. Eine der ersten Taten, womit sie einen langgehegten Wunsch der städtischen Körperschaften erfüllten, der beim Kurfürsten nie Gehör fand, war die Niederlegung der Stadttore. Das holländische Tor wurde zuerst binnen kurzer Zeit abgebrochen, ihm folgten nacheinander die anderen, so daß nach einigen Monaten sämtliche Tore verschwunden waren. Die seither durch Mauern eingeengte Stadt konnte sich Luft schaffen, sie gewann jetzt freien Raum, um sich nach außen hin zu erweitern.
[11.2 Nebelthau und das Verhältnis zu Preußen]
[272] Der Oberbürgermeister Nebelthau, dessen einstimmige Wahl schon zwei Jahre vorher erfolgt, aber vom Kurfürsten wegen der liberalen Gesinnung, mit der jener in der Ständeversammlung zur Oppositionspartei gehörte, nicht bestätigt worden war, wurde durch das preußische Gouvernement alsbald bestätigt.
Kurze Zeit nach der Besitzergreifung unseres Kurstaates durch Preußen reiste eine Abordnung der städtischen Körperschaft unter der Führung Nebelthaus nach Berlin zum König Wilhelm, von dem sie eine Audienz erbeten hatte; diese fand am 27. August statt. In dieser Audienz bemerkte Nebelthau in seiner Ansprache, wie die Nationalzeitung berichtete, u.a., daß die Deputation entsandt sei, um Se. Majestät ehrfurchtsvoll zu bitten, der Stadt Cassel und deren Bürgerschaft seine Huld und Gnade zuzuwenden. Die städtische Bevölkerung sei mit Bereitwilligkeit in den neuen Gang der Dinge eingetreten in der Hoffnung, daß die Eigentümlichkeiten des Landes mit Schonung und die Anhänglichkeit der Bevölkerung an vielhundertjährige Institutionen mit Rücksicht behandelt würden; vor allem die Stadt Cassel verdiene die Aufmerksamkeit Sr. Majestät, sie bitte, daß Se. Majestat der Stadt ein gütiger und gnädiger Herr sein wolle.
In seiner Erwiderung hob der König besonders hervor, daß die Ereignisse ihm selbst unerwartet eingetreten seien; er habe die Entwickelung der Dinge vor dem Kriege als Werk eines halben Jahrhunderts betrachtet, die Geschichte der letzten Wochen habe in gewisser Weise einen Verlauf wider seinen Willen genommen. Es schmerze ihn, gegen ein verwandtes und seit Jahrhunderten verbündetes Fürstenhaus so verfahren zu müssen, wie er es getan, aber die nationalen Aufgaben Preußens und Deutschlands duldeten es nicht anders. Er hoffe, daß die Bevölkerung sich mit den neuen Verhältnissen bald aussöhnen und ihm in der Verfolgung der nationalen Ziele beistehen werde. Er werden die Eigentümlichkeiten des Landes mit größter Schonung behandeln und Cassel die Prärogative [273] einer Residenz als Hauptstadt der neuen Provinz erhalten, in der die höheren Militär- und Zivilorganisationen ihren Mittelpunkt haben würden.
In seiner Entgegnung bemerkte der König, daß er erstaunt sei, die Deputation schon so früh bei sich zu sehen; es mochte ihn wohl eigentümlich berühren, daß des angestammten Landesfürsten gar nicht gedacht wurde.
Im Volke wurde dies übereilte Vorgehen nicht überall gebilligt; ob es politisch klug gehandelt war, erschien sehr fraglich, durch eine größere Zurückhaltung in der Annäherung an Preußen wäre vielleicht mehr erzielt worden.
Hannover, das nicht, wie hier, mit fliegenden Fahnen in das preußische Lager überging, stand sich in vieler Beziehung besser wie wir; es bekam u.a. die Hofhaltung des Prinzen Albrecht von Preußen, das königliche Welfenschloß für die technische Hochschule und vieles andere mehr. Auch für Cassel wäre eine Hofhaltung sehr erwünscht gewesen, ebenso die Erhaltung unserer polytechnischen Schule; beides ging der Stadt leider verloren.
[11.3 Kassel, Sitz der Provinzialregierung]
Bei alledem aber ließ sich nicht verkennen, daß die Maßnahmen der preußischen Regierung darauf gerichtet waren, die Stadt Cassel zu heben und ihr den ersten Platz in der neuen Provinz als Sitz der Provinzialregierung zu belassen. An die Spitze dieser Provinzialregierung wurde als erster Oberpräsident der seitherige Zivil-Administrator des Kurstaates, v. Möller berufen, der mit dem Militär-Gouverneur General v. Werder den Übergang in die neuen Verhältnisse eingeleitet hatte; beides Persönlichkeiten, die sich bei der Bevölkerung durch ihr korrektes, wohlwollendes Verhalten in dieser schwierigen Periode einer allgemeinen Beliebtheit und Anerkennung zu erfreuen hatten.
Oberpräsident v. Möller war eine stattliche, gewinnende Erscheinung mit ernstem, aber dabei doch mildem Gesichtsausdruck, ein Mann mit weitem Blick und wohlwollendem Herzen, der auch besonders ein offenes Auge für unsere schöne [274] Umgebung hatte. Er verstand es wie kein zweiter, die ihm unterstellte Prorinz, besonders die Provinzialhauptstadt Cassel, durch weise Fürsorge immer mehr für Preußen zu gewinnen. Handel, Gewerbe und Industrie fanden in ihm einen eifrigen Förderer; die Firma Henschel u. Sohn z.B. hat ihm viel zu verdanken; Cassel bekam eine Kommandite der Reichsbank in Berlin, wodurch für die Geschäftswelt eine wesentliche Erleichterung im Geldverkehr geschaffen wurde. Unter v. Möllers Verwaltung entwickelte sich die Bautätigkeit in unserer Stadt mächtig, blieb aber in soliden Bahnen. Das öffentliche Verkehrsleben wurde gehoben, alte Beschränkungen in demselben wurden beseitigt. Die Gemäldegalerie und das Museum, beides Kunstsammlungen von höchstem Werte, die seither dem Publikum unzugänglich waren, wurden geöffnet; an bestimmten Tagen in der Woche wurde der freie Besuch gestattet. Der Bequemlichkeit des erholungsbedürftigen Publikums wurde Rechnung getragen, es wurden in der Aue, am Friedrichsplatz, der Bellevue usw. Ruhebänke aufgestellt. Auf Anregung des Oberbürgermeisters Nebelthau unter Protektion des Oberpräsidenten wurde der Verschönerungsverein gegründet, der zunächst die sich vorfindenden Wüsteneien beseitigte, für Verbesserung der Wege sorgte und an vielen Stellen durch gärtnerische Anlagen und Anpflanzungen das innere Stadtbild zu heben sich bestrebte. – Wie dieser Verein seit seiner Gründung fortdauernd die Verschönerung der Stadt sich zur Aufgabe machte, ist bekannt. Unterstützt durch reiche Zuwendungen hochherziger Söhne unserer Stadt, errichtete er eine Anzahl Kunstdenkmäler, an erster Stelle den von Konsul Schmidt in Paris gestifteten monumentalen Löwenbrunnen. Auch in der weiteren Umgebung der Stadt bewirkte er mannigfache Verbesserungen, erschloß Aussichtspunkte, erbaute dort Schutzhütten und Aussichtstürme, darunter den Elfbuchenturm.
[11.4 Bedauerliche und erfreuliche Veränderungen]
Durch den Fortfall der Hofhaltung mit seinem Gepränge und der Auflösung der hessischen Regimenter ging der [275] Stadt zum lebhaften Bedauern der Casselaner eine altgewohnte reiche Staffage verloren, die Wachtparaden zogen nicht mehr täglich auf, die zahlreichen militärischen Wachtposten mit ihren rot-weißen Schilderhäusern vor den öffentlichen Gebäuden verschwanden, und damit fielen auch die Torwachen fort; man konnte wieder ungehindert auf den Straßen rauchen. Durch das vom Kurfürsten – der selbst nicht rauchte – verfügte Verbot des Rauchens in den Straßen der Oberneustadt und Wilhelmshöhe war nämlich Cassel besonders in der Außenwelt geradezu anrüchig geworden. Wenn jemand es wagte, vor einem Wachtposten vorüberzugehen mit einer Zigarre im Munde, dann hatte der Posten das Recht, das Rauchen zu verbieten; unsere derben Vaterlandsverteidiger taten dies mit den höflichen Worten: »Zigarre us em Mulle.« Man erzählte sich damals, daß der französische Gesandte, der diese höfliche Aufforderung entweder nicht verstand oder nicht beachten wollte, und weiter rauchte, vom Posten arretiert wurde und bis zur Ablösung im Schilderhaus verbleiben mußte.
Die größte Errungenschaft, die unsere Stadt der eigensten Initiative unseres Oberpräsidenten v. Möller zu verdanken hat, war die Freilegung der Bellevue – jetzt »Schöne Aussicht« benannt – und die Herstellung einer direkten Verbindung mit der Karlsaue und dem Weinberg; später erhielt die Bellevue durch die Erbauung der neuen Gemäldegalerie ihren schönsten Schmuck. An dieser herrlichen Straße wohnend, verbrachte v. Möller nach seinem Scheiden aus dem Staatsdienste – er war zuletzt Oberpräsident von Elsaß-Lothringen – als Ehrenbürger unserer Stadt hier seine letzten Lebensjahre; sein schlichtes Denkmal steht, den Blick in unsere herrliche Landschaft gerichtet, vor der Gemäldegalerie. – –
So stand es um unser liebes Cassel, als ich wieder heimgekehrt war, und für mich entstand nun die Frage: »Was beginnen?«
Um meine Zeit nicht müßig zu verbringen, beschäftigte ich mich zu Hause mit den Projekten zu zwei Neubauten auf [276] meinem elterlichen Grundstück, um ein Bild davon zu haben, wie dasselbe dermaleinst ausgenutzt werden konnte. Meinem Vater standen weder die Mittel zu solchen Bauten zu Gebote, noch trug er Verlangen nach solchen Zukunftsplänen, für die er nur ein Achselzucken übrig hatte, wenn ich mit ihm darüber redete.
[11.5 Arbeit an Kasseler Bauprojekten]
Ich versuchte mich nebenher mit den Casseler Verhältnissen wieder etwas anzufreunden, aus denen ich ganz herausgewachsen war. Mein Vater konnte es gar nicht vertragen, wenn ich mir eine Kritik über dies und jenes erlaubte und Vergleiche mit Hannover anstellte; er meinte oft, ich wollte zu hoch hinaus und würde wohl damit kein Glück haben; möge mich nach der Decke strecken, wie er und andere Leute in Cassel es auch tun müßten; es war aber nicht leicht, meinen Vater von einer einmal gefaßten Meinung abzubringen.
Zunächst suchte ich mir neue Bekanntschaften zu erwerben; dazu fand ich die beste Gelegenheit in der »Loge zur Eintracht und Standhaftigkeit«, der ich mich anschloß. Mit dem Eintritt der neuen Verhältnisse war es auch der Loge gestattet, ihren Tempel wieder zu öffnen, was ihr unter der Regierung des Kurfürsten versagt war, der unbegreiflicherweise landesverräterische Absichten hinter der Freimaurerei vermutete. – Mir wurde seitens der Loge die Einrichtung des eigenen Lokals übertragen, für das im Hause des Arbeiter-Fortbildungsvereins an der Holländischen Straße eine Etage gemietet wurde; man betraute mich damit, weil ich ähnliche Einrichtungen in Hannover kennen gelernt hatte. Später erbaute ich für die Loge ein eigenes Heim an der Sedanstraße. Unter den Mitgliedern der Loge, mit denen ich nun in nähere Beziehungen getreten war, befand sich auch der Kriegsbaumeister Liegemann; an diesen wendete ich mich gelegentlich mit der Anfrage, ob er für mich auf dem Garnisonbauamte Beschäftigung habe, was er verneinte. Ich klagte ihm mein Leid, daß es mir so schwer falle, als Architekt eine Tätigkeit zu finden; Liegemann riet mir, mich doch einmal [277] an die Direktion der Bebra-Hanauer Bahn zu wenden, welche, wie er gehört habe, noch Architekten einstellen müsse. Ich wendete dagegen ein, daß ich dort wohl nicht ankommen würde, ich sei schon früher auf mein Ansuchen abschläglich beschieden, weil ich das kurhessische Baueleven-Examen nicht abgelegt hatte. Liegemann aber meinte, ich solle es doch versuchen, die Verhältnisse seien jetzt andere.
[11.6 Anstellung bei der Bahn]
Ich folgte auch seinem Rat und begab mich schon am anderen Tage auf das Zentralbureau der Bahn, das sich im Schollschen Hause an der Bahnhofstraße befand. Ich wurde dort an den Ober-Ingenieur Bolte verwiesen, dem ich vor zwei Jahren schon mal einen vergeblichen Besuch gemacht hatte. Bolte empfing mich sehr freundlich; ich brachte ihm mein Anliegen vor und vernahm von ihm zu meiner großen Freude, daß ich ihm jetzt sehr willkommen sei, er könne mich sofort anstellen. Er fragte mich nach den Gehaltsansprüchen, die ich machen würde; ich überließ es aber seinem Ermessen, die Höhe meines Gehaltes zu bestimmen; er fragte, ob ich mit dem Monatsgehalt der Sektions-Ingenieure von 75 Talern bezw. 2 ½ Talern Tagegelder einverstanden sei, dem ich natürlich mit Freuden zustimmte. Ein solches Angebot hatte ich nicht erwartet; ich war sehr froh, keine Forderung gestellt zu haben, denn diese wäre viel bescheidener gewesen. Ich beeilte mich, meinem Vater Mitteilung von diesem günstigen Erfolge meiner Bemühungen zu machen, die nach seiner Ansicht doch nur vergebliche sein würden. Skeptisch, wie er war, schien er trotzdem noch kein rechtes Vertrauen in meine Angaben zu setzen; erst als der uniformierte Bureaudiener Klotzbach einige Tage darauf das Anstellungsreskript brachte, konnte ich es schwarz auf weiß nachweisen. Mein Vater mochte wohl innerlich erfreut darüber sein, daß ich so gut angekommen war, er machte aber weiter keine Worte darüber, sondern nahm nur stillschweigend Kenntnis von meinem Reskript.
Nach den mancherlei Enttäuschungen, die ich im Laufe des Jahres erfahren hatte, war ich um so freudiger gestimmt [278] über die glückliche Wendung, die für mich mit meiner Anstellung eintrat; ich kam dadurch in die Lage, früher wie ich je geglaubt hatte, meine Schulden in Hannover abtragen zu können.
Die Arbeiten, die mir auf dem Zentralbureau der Bebra-Hanauer Bahn übertragen wurden, bestanden in der Ausarbeitung der Projekte für alle Bauten zu den Bahnhöfen in Salmünster und Steinau. Die Freudigkeit, mit der ich an diese Arbeit heranging, wurde leider sehr herabgemindert durch Streichungen, welche seitens der Direktion an meinen Projekten vorgenommen wurden, um die Bauten aus Sparsamkeitsrücksichten möglichst zu vereinfachen. Im übrigen aber herrschte unter uns Kollegen auf dem Hochbaubureau ein äußerst gemütlicher, kameradschaftlicher Ton; wir fanden neben unseren Arbeiten oftmals Zeit zu scherzhaftem Ulk, an dem teilzunehmen unsere Ober-Ingenieure nicht verschmähten, die sich sehr gern auf unserem Bureau zu schaffen machten.
[11.7 Reisen nach Hannover, Nebenprojekte]

Die Bahnhofstraße, Blick in Richtung Lutherplatz (von dem der Grüne Weg nach links abzweigt; aus einem Prospekt von 1908).*MA
Eine besondere Annehmlichkeit meiner jetzigen Stellung war die Gewährung freier Eisenbahnfahrt, die ich mir öfters zunutze machte. Ich konnte auf diese Weise alle vier bis sechs Wochen nach Hannover reisen, dort den noch fertigzustellenden Neubau für Hofrat Meyer kontrollieren und vor allem glückliche Stunden bei meinem lieben Bräutchen verbringen; allerdings stand mir nur die Zeit von Sonnabend nachmittag bis Sonntag abend zu Gebote, Montag mußte ich wieder auf dem Bureau sein.
Noch während meiner Anstellung an der Bebra-Hanauer Bahn wurde mir von meinem Onkel August Engelhardt die Projektierung von Wohnhäusern auf seinem vom Posthalter Nebelthau – unserem Oberbürgermeister – erworbenen Grundstück, an der Ecke zwischen Bahnhofstraße und Grünem Weg, übertragen. Auf diesem Grundstück stand bereits eine massive Scheune – die Postscheune – die zum Fruchtmagazin umgebaut werden sollte. Zur ersten Bearbeitung dieser Projekte blieb mir nur an den Abendstunden oder Sonntags freie [279] Zeit; ich wollte meine Stellung an der Bahn zunächst noch nicht aufgeben. Die Arbeiten wurden aber so umfangreich und mußten so beschleunigt werden, daß ich mich genötigt sah, meine Stelle im Monat März 1867 aufzugeben, um mich ganz dem mir gewordenen Auftrage widmen zu können.
Nach der Vollendung der Projekte für das Wohnhaus meines Onkels – jetzt das Markheimsche Haus an der Bahnhofstraße Nr. 4 – und dem Umbau des zugehörigen Magazin-Gebäudes am Grünen Weg übertrug derselbe die Ausführung aller Maurer- und Steinhauerarbeiten meinem Freunde Georg Seidler, der das väterliche Geschäft von seiner Mutter übernommen hatte, und bedingte dabei, daß ich am geschäftlichen Nutzen zu einem gewissen Teil partizipieren sollte. Durch diese Beteiligung sollte mir zugleich die Gelegenheit geboten werden, die geschäftlichen Verhältnisse näher kennen zu lernen, was mir natürlich sehr erwünscht war.
[11.8 Meisterprüfung]
Mit dem Aufblühen der Bautätigkeit in Cassel gestalteten sich die Verhältnisse gegen frühere Jahre wesentlich günstiger. Ich faßte deshalb den Entschluß, jetzt dauernd in Cassel zu bleiben und mich als Architekt, Maurer- und Steinhauermeister zu etablieren. Um zu diesem Ziele zu gelangen, war ich genötigt, vorher eine Meisterprüfung abzulegen und ein Meisterstück anzufertigen, was von allen zünftigen Meistern verlangt wurde. Damals bestand nämlich noch die wohllöbliche Maurer- und Steinhauerzunft, in der ich nun mit dem Meistertitel die höchste Staffel erklimmen wollte. Ich meldete mich also beim früher kurfürstlichen, nachher königlichen Oberzunftamt zur Aufnahme als Maurer- und Steinhauermeister an und hatte bald danach zunächst eine mündliche Meisterprüfung vor den damaligen Zunftmeistern Koch und Losch und dem Kreis-Bauinspektor Wolf in der Wohnung des letzteren abzulegen. Während etwa 4–5 Stunden gaben sich die Herren Mühe, mir nach allen Richtungen in meinem Fach auf den Zahn zu fühlen, um schließlich mir die Fähigkeit zum Meister zuzuerkennen. Nach meiner bestandenen Prüfung wurde mir [280] die Aufgabe zur Anfertigung eines Meisterstücks gestellt; man wollte davon absehen, mir ein umfangreiches Modell aufzugeben, an denen frühere Aspiranten oft ein halbes Jahr lang oder noch länger zu schuften hatten. Mit wohlwollendem Lächeln des Zunftmeisters Koch, meines früheren Lehrers wurde mir die Aufgabe gestellt, ein Kreuzgewölbe aus Quadern in Steinfugenschnitt über einen unregelmäßigen dreieckigen Raum mit verschiedenen Kämpferhöhen der Gewölbenanfänger in einem Gipsmodell auszuführen. Im ersten Augenblick war ich erfreut, mit einem anscheinend einfachen, rasch fertig zu stellenden Meisterstück davonzukommen, aber als ich der Aufgabe näher trat, mußte ich erkennen, daß diese, wenn auch weniger umfangreich, so doch um so schwieriger auszuführen war, so schwierig und zeitraubend, wie wohl kaum eine von früheren Meistern ausgeführt war. An dem Modell war nämlich jeder einzelne Gewölbestein für sich auszutragen, mit nach allen Seiten windschiefen Fugen und Leibungsflächen frei zu bearbeiten – eine Heidenarbeit, was jeder Fachmann zugestehen muß. – Ich wurde bei der Königlichen Regierung vorstellig und bat, mich von der Ausführung dieses Meisterstücks zu dispensieren und den Engelhardtschen Neubau, von dem ich alle Zeichnungen, sowohl den gesamten Entwurf wie alle Details in sauberer Ausführung beilegte, als meinen Meisterbau anerkennen zu wollen. Mein Gesuch aber wurde ohne weitere Begründung abschlägig beschieden; ich hätte wohl erwarten dürfen, daß der Nachweis über meine Fähigkeiten zur Ausübung des Maurer- und Steinhauergewerbes mit der selbständigen Durcharbeitung eines großen Bauprojektes viel besser erbracht war, wie mit der Herstellung eines verschrobenen Gipsmodells, aber der Zunftzopf ließ solche Erwägungen nicht zu. – Gottlob wurde er kurze Zeit danach abgeschafft, die Zünfte mit ihren mittelalterlichen Vorrechten hörten auf – die Gewerbefreiheit wurde eingeführt, und damit stand nichts mehr im Wege, mir mein Geschäft zu gründen.
[11.9 Selbständigkeit, Grundstückserwerb]
Hier klicken (→) für eine Website des »Geoportals« der Stadt Kassel, auf der man historische Pläne mit einem aktuellen Stadtplan überblenden kann.
Die erste Aufgabe, die ich mir zur Begründung meines Geschäftes stellen mußte, bestand darin, daß ich mir neben [281] einer Wohnung ein entsprechendes Geschäftslokal mit Werkplatz, Schuppen für Gerüste und Geräte usw. zu beschaffen suchte. Den gutgemeinten Vorschlag meines Vaters, mich mit einem kleinen Teil unseres Gartens hinter unserem Hause zunächst zu begnügen, mußte ich dankbar ablehnen. Nach seiner Ansicht war es richtiger, klein anzufangen und mir erst etwas zu verdienen, denn ich besaß ja noch gar nichts. Er mochte es gar nicht hören, wenn ich davon sprach, daß ich mir gleich ein Grundstück zu kaufen versuchen wollte – »wovon«?
Auch Onkel Scheurmann, Mutters Bruder, der als Ratgeber in der Familie das besondere Vertrauen meiner Eltern genoß, konnte nicht begreifen, daß ich etwas kaufen wolle, wo mir keinerlei Mittel zur Verfügung standen. Als vorsichtiger Kaufmann – er war Gildemeister der Casseler Kaufmannschaft – kannte er nur das Prinzip: »Hier Geld, da Ware.« Bei einer gelegentlichen Besprechung in Gegenwart meines Vaters über meine Absicht, zu kaufen, fragte er mich, was ich denn eigentlich besäße, um mindestens eine Anzahlung auf ein Grundstück machen zu können; ich erwiderte ihm: »Nichts weiter wie Selbstvertrauen.« – »Dafür borgt Dir kein Jude eine Bamberger Zwewwel (Zwiebel),« war seine mir unvergeßliche Entgegnung, nach seiner Ansicht könne ich ein passendes Grundstück zunächst nur mieten, und erst wenn ich mir etwas erworben hätte, dies oder ein anderes zu kaufen.
Diese Ansicht teilte auch mein Vater. Er nannte mir mehrere Anwesen, die er für meine Zwecke geeignet hielt, die ich aber als durchaus untauglich erklärte, weil größere Werkplätze dabei fehlen. Derartige Grundstücke waren im Innern der Stadt überhaupt kaum zu haben oder nur für schweres Geld. Dagegen war ich nicht im Zweifel darüber, daß ich am äußeren Stadtgebiet ein größeres Grundstück erheblich billiger haben konnte, wenn ich mich ernstlich danach umsähe. Ich studierte den neu herausgegebenen Stadterweiterungsplan und fand die Lage an der Wolfhager Straße für besonders geeignet. Die dort gelegenen Grundstücke waren nicht übermäßig [282] groß und versprachen für die Zukunft eine vorteilhafte Ausnutzung, weil sie durch projektierte Straßenzüge durchschnitten wurden, und demnächst vorteilhaft als Bauplätze zu verwerten waren. Mein Onkel Engelhardt, der damals schon neben seinem Hauptgeschäft mit Grundstücken spekulierte, empfahl mir eines seiner Grundstücke in der dortigen Gegend, das er für meine Zwecke passend fand.
An einem schönen Sommerabend ging ich mit meinem Bruder August, der wie ich aus der Fremde zurückgekehrt war, hinaus vor die Stadt, um das mir von meinem Onkel empfohlene Grundstück aufzusuchen, das gegebenenfalls uns beiden zur Grundlage unserer Geschäfte dienen sollte. Die Gegend war mir bis dahin noch ganz unbekannt geblieben, denn die Casselaner machten nach Rothenditmold sehr selten ihre Spaziergänge. – Der Weg führte uns über die Wolfhager Straße, die damals noch in geringer Breite, von etwa sechs Metern, zwischen mit Bruchsteinmauern nach der Straße zu begrenzten Gärten hindurchführte und für Fußgänger wegen des schauderhaften Pflasters schlecht zu passieren war. An der rechten Seite lagen die Gartengrundstücke nebeneinander bis an die Mombach, an der linken Seite hörten die Gärten an einem Feldwege auf, der eine Verbindung zwischen der Wolfhager Straße und dem Rothenditmolder Fußwege bildete. Rechts davon, auf dem jetzigen Gebiete des Unterstadtbahnhofes, über welchen derzeit die Wolfhager Straße noch führte, die erst später verlegt wurde, befand sich ein weites, offenes Feld; inmitten desselben besaß unser Onkel ein mehrere Acker großes Stück Land, das wir uns ansehen sollten.
Es war gerade zur Zeit des Sonnenunterganges, ein wunderbar rotglühender Abendhimmel leuchtete uns entgegen, als wir beide von der Wolfhager Straße in den Feldweg einbogen, der nach dem gesuchten Acker führte. Die ganze Gegend war einsam und menschenleer, nur zwei kleine Häuser standen vereinzelt an dem schmalen Wege. Wir waren ganz in den Anblick der untergehenden Sonne vertieft und merkten nicht [283] daß wir von einer Frau beobachtet wurden, die aus einem der Häuser herausgetreten war. Sie begrüßte uns und knüpfte ein Gespräch mit uns an; unsere Frage, ob sie uns bescheiden könne, wo das Engelhardtsche Land läge, bejahte sie und bezeichnete die Richtung, die wir einzuschlagen hätten. Die Frau forschte uns aus, warum wir nach dem Lande fragten, ob wir etwa beabsichtigten, ein Grundstück zu kaufen, sie würde ihr Besitztum auch verkaufen; ihr Mann sei alt und gebrechlich, sie könne sich nicht mehr um den Garten bekümmern und wolle darum lieber in die Stadt ziehen. Wir folgten ihrer Aufforderung und besichtigten Haus und Garten; das erstere war ein noch nicht lange erbautes bescheidenes Fachwerkgebäude, einstöckig mit Kniedachgeschoß; es enthielt im ganzen 6 Räume mit Küche, ausreichend für die Familie der Frau Müller, so hieß die Besitzerin. Hinter dem Hause lag ein langgestreckter Obst- und Gemüsegarten, in dessen Mitte ein altes Gartenhaus stand. Das Anwesen gefiel mir sehr; ich konnte für meine Zwecke das Wohnhaus benutzen und durch An- und Aufbau vergrößern; außerdem bot der etwa einen Acker große Garten schon zur Hälfte genügenden Raum für Schuppen und Werkplatz, so daß noch ein schönes Stück Garten übrig blieb; es ließ sich also alles, was ich gebrauchte, nach Wunsch einrichten. Auch mein Bruder fand das Grundstück für sehr geeignet; der Preis von 5000 Talern, den Frau Müller forderte, erschien auch nicht zu hoch. Wir verzichteten jetzt auf die Besichtigung des Engelhardtschen Landes, ich erklärte Frau Müller, daß ich ernstlich beabsichtige, ihr Anwesen zu kaufen, sie möge es mir an Hand lassen, ich würde nächster Tage wiederkommen.
Als ich nach Hause kam, orientierte ich mich auf dem Stadtplan über das Grundstück und fand es zu den projektierten Straßenzügen günstig gelegen; ich war jetzt fest entschlossen, mich dort anzukaufen; lag das Grundstück auch noch weit außerhalb der Stadt, so war ich doch überzeugt, daß die Stadt sich nach dieser Seite vergrößern und dadurch die Lage eine immer bessere werden würde. Ich teilte nunmehr meinem [284] Vater mit, daß ich durch Zufall ein Grundstück gefunden hätte, das mir sehr gefiele, nicht teuer sei und mir räumlich böte, was ich gebrauchte. Er war aber mit meiner Wahl durchaus nicht zufrieden; es war ihm unverständlich, daß ich so weit außerhalb der Stadt mich ankaufen wollte, in einer Gegend, wo, wie er sich ausdrückte, »die Füchse sich gute Nacht sagten«. Nach seiner Ansicht brauchte ich mich gar nicht zu übereilen, es werde sich schon eine Gelegenheit bieten, etwas Passenderes zu finden.
Um meinen Vater, der es gewiß nur gut mit mir meinte, nicht zu verstimmen, ließ ich mehrere Wochen darüber hingehen, um mich noch anderweit umzuhören, aber ich fand nichts was mir besser zusagte, wie das Müllersche Grundstück. Auch die Geschäftsleute, mit denen ich am Engelhardtschen Neubau zu tun hatte, und welchen ich meine Absicht, mich anzukaufen, mitteilte, hielten meine Wahl für eine glückliche. Sie waren sämtlich bereit, falls ich etwa bauen wollte, die erforderlichen Arbeiten für mich auszuführen und mir Zeit zur Zahlung zu lassen, so lange bis ich etwas verdient hätte; sie waren überzeugt, daß ich mir in meinem zu gründenden Geschäft bald Kundschaft erwerben würde.
Der Zufall fügte es, daß mir Frau Müller nach einigen Wochen in den Weg kam; sie zürnte mir und sagte, ich hätte sie an der Nase herumgeführt dadurch, daß ich verlangte, ihr Grundstück an Hand zu behalten, ohne mich aber nachher wieder blicken zu lassen. Ich klärte sie darüber auf, weshalb ich noch nicht wieder zu ihr gekommen war; ich sähe aber ein daß ich sie nicht länger in Ungewißheit lassen dürfe, am nächsten Tage würde ich vorkommen, um den Kauf definitiv zu vereinbaren. Andern Tags schloß ich denn auch, ohne meinem Vater vorher etwas davon gesagt zu haben, den Ankauf des Grundstückes durch schriftlichen Vertrag mit Frau Müller ab. Der Eintrag des Kaufbriefes sollte binnen kurzer Frist auf dem Stadtgericht erfolgen; ich verpflichtete mich, an diesem Termin eine Zahlung von 2000 Talern zu leisten, der Rest sollte an zweiter Stelle längere Zeit unkündbar stehen [285] bleiben, das Grundstück (siehe Stadtplan) alsbald in meinen Besitz übergehen – so lautete unsere Abmachung.
[Faltplan zwischen den Seiten 284 und 285:]
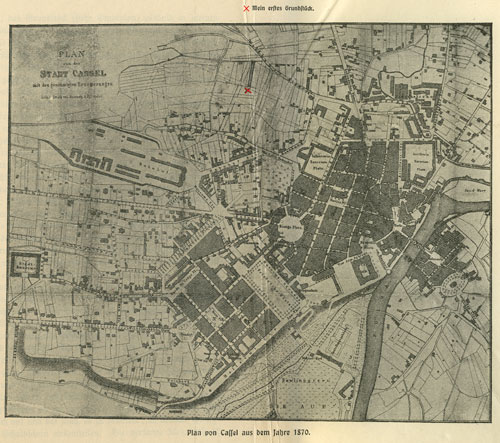
Mein erstes Grundstück. | Plan von Cassel aus dem Jahr 1870.
Als mein Vater erfuhr, daß ich entgegen seiner Ansicht das Müllersche Grundstück dennoch gekauft hatte, war er sehr ungehalten. Ich stellte ihm vor; daß ich nicht leichtsinnig zu Werke gegangen sei, sondern mir alles reiflich überlegt habe; auch daß mich die mir bekannten Geschäftsleute beim Bau unterstützen wollten. Betreffs der zu leistenden Anzahlung hoffte ich leicht einen Kapitalisten zu finden, der mir das Geld, das an erster Stelle hypothekarisch sichergestellt werde, als Darlehen geben werde. Tatsächlich machte es mir auch gar keine Schwierigkeit, ich bekam das Geld von einem unserer Hausbewohner, dem Proviantamts-Kontrolleur Ernst. Mein Vater vermochte sich aber nicht mit meinem Schritt auszusöhnen, er reiste nach Arolsen zu meiner dort verheirateten Schwester Marie; er zog es vor, dem gerichtlichen Termin zum Abschluß des Kaufes aus dem Wege zu gehen.
[11.10 Finanzierung, Anschaffungen]
So wurde ich denn Besitzer dieses Grundstücks, nicht allein gegen den Willen meines Vaters, auch mein Onkel Sch., der sich gern in der Rolle einer Vorsehung in der Familie gefiel, prophezeite mir nichts Gutes mit dem Ankauf desselben, ich würde es noch händeringend bereuen – ich steuere auf meinen Bankrott los usw. Aber gottlob kam es anders, mein Glücksstern hatte mich bei der Erwerbung dieses Grundstücks geleitet; es brachte mir reichen Segen, ja ich kam sogar ganz unerwarteter Weise zu einem Kapital, das mir bei meiner Mittellosigkeit über finanzielle Schwierigkeiten im Anfang meines Geschäftes hinweghalf. Als ich nämlich nach vollzogenem gerichtlichen Akt die Anzahlung von 2000 Talern gemacht hatte, wußte Frau Müller nicht, was sie mit dem Gelde anfangen sollte, und frug mich beim Verlassen des Stadtgerichts auf dem Hausflur, ob ich das Geld nicht gebrauchen könnte, es mache ihr jetzt Sorge, es gut anzulegen. Sie drängte mir das Geld förmlich auf und bat mich, es zu behalten; ich brauche ihr nur einen Schuldschein auszustellen. Sie verlange bloß, daß ich [286] ihr die üblichen Zinsen zahle und, wenn sie mal Geld gebrauche, in kleinen Beträgen Zahlungen leiste. Selbstverständlich willigte ich mit Freuden ein, und ich bekam gegen einen Handschein das Geld. »Ein junger Mann muß Glück haben« – sagte ich zu mir, erstaunt über das blinde Vertrauen, das mir die gute Frau, die mich doch kaum kennen gelernt hatte, schenkte. Ich brachte das Geld in den von wenigen Jahren gegründeten Kredit-Verein, der mir auf Bürgschaft meines Onkels August Engelhardt bereits einen Kredit von 2000 Talern eingeräumt hatte.
Mir stand jetzt ein Betriebskapital von 4000 Talern zur Verfügung, es fehlte mir nun nicht mehr an Mitteln, um die notwendigen Anschaffungen für mein Geschäft zu machen, und vor allen Dingen, um mir ein Haus und einen Werkplatz ganz nach meinen bescheidenen Wünschen einrichten zu können. Der Anfang war jetzt gemacht; er wurde mir aber nicht schwer, wie es im Sprichwort heißt, ich bekam schnell aufeinander folgend schöne Aufträge, womit mein Geschäft flott in Gang kam.
[11.11 Aufträge und Erfolg]

Die Karthäuserstraße – sie hieß wohl einst »Karthäuserweg« (aus einem Prospekt von 1908).*MA
Der erste Auftrag wurde mir vom Kaufmann Magersuppe erteilt, dem ich ein Wohnhaus in Fachwerk in der Mittelgasse erbaute. Dann folgte der Bau einer vornehmen Villa im Karthäuserweg für die Herren Jungk und Gräving aus Bremen, die spätere Villa Habich; zu gleicher Zeit übertrug mir Proviantmeister Decker, den ich aus der Loge kannte, den Bau seiner Villa an der Mönchebergerstraße u.s.f. Es gab für mich jetzt sehr viel zu tun, sowohl auf den Bauten, wie auf meinem Bureau; neben einem jungen, tüchtigen Techniker, den ich engagierte, mußte ich meine volle Arbeitskraft einsetzen, um als junger Geschäftsmann meinen Verbindlichkeiten prompt nachkommen zu können. Meine Schaffensfreudigkeit trug gute Früchte, der Kreis meiner Kundschaft vergrößerte sich immer mehr und damit mein geschäftliches Einkommen.
Die damaligen Verhältnisse waren aber auch viel günstiger wie heute, Submissionen kannte man noch nicht. Bei [287] Vereinbarungen über Arbeits- oder Lieferungsaufträge hielt man noch auf Treu und Glauben, der Grundsatz »Leben und leben lassen« wurde in der Geschäftswelt noch hoch gehalten – wie steht es dagegen heute im Geschäftsverkehr? – Die geschäftlichen Unkosten waren auch sehr viel geringer, die Arbeitslöhne noch nicht ein Drittel so hoch, wie die der heutigen Zeit, die Abgaben spielten kaum eine Rolle; heute wird der Geschäftsmann, besonders im Baugewerbe, bei den denkbar schlechtesten Preisverhältnissen durch Steuern, Lasten und Abgaben noch obendrein geradezu erdrückt.
[11.12 Heiratspläne, Haus-Umbau, Hochzeit]
Mit der zunehmenden Entwickelung meines Geschäftes steigerte sich naturgemäß auch die Sehnsucht nach einer eigenen Häuslichkeit. »Es ist nicht gut, daß der Mensch allein sei« – das hatte unser lieber Herrgott damals schon eingesehen, als er dem Adam eine Eva schuf – das empfand auch ich täglich immer mehr, nämlich, daß zu einem »Meister« unbedingt auch eine »Frau Meisterin« gehörte. Jetzt war ich ja in der glücklichen Lage, eine Frau ernähren zu können; mit freudigem Empfinden schrieb ich regelmäßig meiner lieben Sophie, und berichtete ihr getreulich über alles, was uns dem Ziele, bald vereint zu sein, näher brachte.
Den Umbau meines Wohnhauses betrieb ich mit großem Eifer, das Erdgeschoß enthielt unsere zukünftige Wohnung, bestehend aus zwei heizbaren Zimmern, nämlich der Wohnstube und der »guten Stube«, oder feiner ausgedrückt, »dem Salon«. An ersteres stieß unser Schlafzimmer, an letztere ein schmales Kabinett, dazu kam noch die Küche. Diese Räume lagen an einem wenige Quadratmeter großen, nach dem Hausflur abgeschlossenen Vorplätzchen; außerhalb desselben lag mein Bureau, vor dem Hauseingang war eine überdeckte Veranda, von der man in einen kleinen Blumengarten sah. Das Erdgeschoß lag mit dem Fußboden nur etwa einen halben Meter über der Straße, so daß jeder Vorübergehende bequem in unsere Zimmer sehen konnte. Die innere Ausstattung war völlig schmucklos, schlichte geweißte Decken, einfache [288] Tapeten, eiserne, sogenannte Casseler Rundöfen mit Braunkohlenfeuerung als Wärmespender, ein gemauerter Sparherd in der Küche usw.; so war meine Wohnung, wie die bürgerlichen Wohnungen derzeit allgemein, eingerichtet.
Das Haus steht heute noch an der Ecke der Orleans- und Wolfhager Straße. Der Feldweg zu meinem Grundstück war nur einspurig, ohne Fußsteig; um daher eine Einfahrt zu meinem Grundstück zu haben, mußte ich meiner Einfahrt gegenüber ein Stück Land pachten, auf dem mit dem Wagen gedreht werden konnte. Bei andauerndem Regen war der Weg so durchweicht, daß man nur über schrittbreit auseinander gelegte Steine einigermaßen trockenen Fußes zu meinem Hause gelangen konnte; wenn man daneben trat, sank man bis über die Knöchel in den Schlamm. – Für die Unterhaltung des Weges geschah seitens der Stadt gar nichts, auch die Wolfhager Straße war in einer jammervollen Verfassung. Bis auf einige traurige Ölfunzeln war die Straße ohne Beleuchtung, Wasserleitung und Kanal ruhten noch in der Zukunft Schoß, – wegen mangelnden Abflusses stieg das Grundwasser jeden Winter, oft bis zu einem Meter hoch, in meinen niedrigen Balkonkeller –, den schrillen Pfiff des Nachtwächters konnte man nur aus weiter Ferne hören. So war es in und um meine Residenz beschaffen, als ich mein Weibchen in dieselbe einführte – am 31. Mai 1868 war unsere Hochzeit. Die Trauung fand in der hannoverschen Gartenkirche statt. Der Quartettverein »Congreß« ließ es sich nicht nehmen, mir durch erhebenden Gesang eine besondere Freude zu bereiten und damit die Feier zu verschönen.
[11.13 Mit Ehefrau Sophie im neuen Hausstand]
Mein liebes junges Frauchen war zum Glück von Haus aus durch einsames Wohnen außerhalb der Stadt nicht verwöhnt; wir fühlten uns in unserem durch mütterliche Fürsorge recht behaglich eingerichteten Heim sehr glücklich und zufrieden. Obgleich ich geschäftlich recht gut verdiente, suchten wir uns anfangs dennoch sparsam einzurichten, die junge Hausfrau führte die Wirtschaft in den ersten vier Monaten [289] ohne Mädchen, nur mit Hilfe einer Aufwartefrau, erst im folgenden Oktober schafften wir uns eine Dienstmagd an.
Außer der unseren befanden sich noch zwei Wohnungen im Hause, von denen die in erster Etage an einen Hauptmann Blum von der Gendarmerie, die in der zweiten Etage an Frau Pfarrer Lohr, die Mutter des späteren Generalsuperintendenten, vermietet war. Daß ich bei aller Bescheidenheit der Ausstattung meiner Wohnungen und bei allen Mängeln der einsamen, nichts weniger wie vornehmen Lage meines Hauses zur Stadt, so angenehme Mieter bekam, ist bezeichnend für die damaligen Verhältnisse, denn es gab nicht nur sehr wenige Wohnungen in freier Lage im äußeren Stadtgebiet, sondern es herrschte auch ein allgemeiner Wohnungsmangel in der Stadt selbst. Zwischen uns und unseren Mitbewohnern entwickelten sich bald sehr freundliche Beziehungen, wir fühlten uns in unserer Abgeschiedenheit wie auf dem Lande wohnend, zogen unser eigenes Gemüse, hatten schönes Obst an den Bäumen und den netten Blumengarten unmittelbar beim Hause. Zwischen diesem und dem Gemüse garten war mein Werkplatz, auf den ich mir ein langgestrecktes Hinterhaus baute; es war ein von mir auf Abbruch übernommener alter Fachwerksbau, den ich noch sehr gut verwerten konnte, er erfüllte seinen Zweck ebensogut wie ein Neubau. Auf solche Weise suchte ich mich billigst einzurichten und meine Unkosten zu verringern, und ich bin gut dabei gefahren, Schritt für Schritt kam ich vorwärts!
[290] 12. Einer neuen Zeit entgegen.
[12.1 Wilhelm I. von Preußen kündigt sich an]
Es war ein Jahr ins Land gegangen, seitdem wir preußisch geworden waren, als König Wilhelm seinen ersten feierlichen Einzug in die frühere Haupt- und Residenzstadt Kurhessens hielt. Zum würdigen Empfang des neuen Landesherrn wurden außerordentliche Vorbereitungen getroffen, nicht nur die städtischen Behörden, auch die Bürgerschaft beteiligte sich in hervorragender Weise an der Ausschmückung der Stadt zur festlichen Begrüßung des Königs, ganze Straßen waren einheitlich und geschmackvoll dekoriert, die Stadt prangte in einem Festkleid wie niemals zuvor, dabei war auch mancher Sinnspruch angebracht, der von sich reden machte.
Weil der König seinen Einzug in die Stadt durch die Wilhelmshöher Allee vom Wilhelmshöher Bahnhof aus nahm, hatte die Stadt eine mächtige dreibogige Ehrenpforte in Form eines Triumphbogens am Eingang der Wilhelmshöher Allee zwischen den beiden Wachthäusern errichten lassen, an deren Ausführung ich beteiligt war. An der äußeren Seite prangte zwischen einem Arrangement von Flaggen und Emblemen auf dem grünen, tannengeschmückten Untergrund in Riesenlettern der Willkommengruß: »Heil dem König«. Die Königsstraße bildete eine herrliche via triumphalis, Tannenbäume zwischen beflaggten Masten bildeten eine geschlossene grüne Einfassung der Straße, deren Abschluß ein Mastentempel auf dem Königsplatz mit der Büste des Königs inmitten einer Palmengruppe bildete. Schon tagelang vorher war die Stadt in fieberhafter Tätigkeit, auch ich war mit meinen Leuten vom Morgen bis in die späte Nacht ununterbrochen an dem [291] Bau der Ehrenpforte beschäftigt, damit dieselbe rechtzeitig bis zum Einzug fertiggestellt werden konnte.
[12.2 Der erste Besuch des Königs]
Am Tage des Einzugs, den 15. August 1867, bot die Stadt ein äußerst belebtes Bild, die Straßen waren überfüllt von Menschen; der Zuzug von Fremden, besonders von Bewohnern nächstgelegener Städte und Dörfer, war ein außerordentlicher. Ich war noch am Bau der Ehrenpforte mit mehreren Leuten tätig, um dort die letzte Hand anzulegen und konnte von oben herab auf das Leben und Treiben herabsehen. Am Nachmittag marschierten die Vereine und Gewerke mit ihren Bannern und Emblemen auf, um sich anschließend an die Ehrenpforte die Wilhelmshöher Allee entlang aufzustellen; auch Vereine aus den Landkreisen waren dabei vertreten. Vor der Ehrenpforte auf dem Platz »Am Rondel« hatten auf einer Seite die städtischen Körperschaften und ihnen gegenüber die Ehrenjungfrauen Aufstellung genommen, um den König beim Eintritt in die Stadt zu begrüßen.
Gegen 5 Uhr traf Se. Majestät auf dem Wilhelmshöher Bahnhof ein, empfangen vom Oberpräsidenten v. Möller und der gesamten Generalität Cassels. An der Spitze einer glänzenden Suite zog Se. Majestät durch die Ehrenpforte in die Stadt ein, begrüßt durch tausendstimmiges Hurrah. Der König ritt sein Leibroß Sadowa, das Pferd, welches er während der Schlacht bei Sadowa (Königgrätz) geritten hatte, das seit dieser Zeit den Namen trug. Ich konnte den Einzug aus dem oberen Teil der Ehrenpforte, gedeckt durch Tannenzweige, vortrefflich beobachten. Der König begrüßte zuerst die Ehrenjungfrauen, von denen eine, Fräulein Nebelthau, die Tochter des Oberbürgermeisters, ihm einen Lorbeerkranz, eine andere, Fräulein Stück, die Tochter des Stadtrats, ein Gedicht überreichte, die übrigen Ehrenjungfrauen streuten Blumen. Dann ritt er zu den Vertretern der Stadt, von denen er durch eine längere Ansprache des Oberbürgermeisters Nebelthau begrüßt wurde, auf die der König eingehend in huldvoller Weise erwiderte. Dies Schauspiel, das ich so nahe [292] und ungestört von meinem erhöhten Standpunkte aus genießen konnte, bleibt mir unvergeßlich. König Wilhelm, ein hoheitsvolle, ritterliche Erscheinung, war trotz seines hohen Alters von einer erstaunlichen, fast jugendlichen Elastizität. Mit sichtlicher Erregung über den jubelnden Empfang, den ihm seine neuen Untertanen bereiteten, grüßte der König bei seinem Zuge durch die Stadt in herzgewinnender Milde und Freundlichkeit nach allen Seiten. Es herrschte eine stürmische Begeisterung, wie sie sich vorher wohl niemals in Cassel kundgegeben hat. Alsbald nach seiner Ankunft im Palais zeigte sich der König auf dem Balkon, mit dem Oberpräsidenten von Möller an seiner Seite, und ließ den großartigen Festzug an sich vorbei defilieren, an dessen Spitze drei mittelalterlich kostümierte Wappenherolde vorausritten. Am Abend fand im Königlichen Theater große Galavorstellung statt, wobei dem König ein begeisterter Empfang bereitet wurde. Nach den Theater war großer Tapfenstreich, die ganze Stadt war glänzend illuminiert, bis in die kleinsten Gäßchen hinein; damit endete der großartigste Tag, den Cassel bis dahin wohl je erlebt hatte.
Am andern Morgen fand eine Parade auf dem Friedrichsplatze statt, nach welcher sich der König in leutseliger, ungezwungener Weise zwischen seinen Offizieren bewegte. Das frische, muntere Wesen, mit dem sich der König hier zeigte, dazu seine stattliche, stramme Haltung imponierte den Casselanern und auch mir außerordentlich. – Am folgenden Tag besuchte der König die Grabstätte seiner Tante, der verstorbenen Kurfürstin, auf dem alten Totenhofe. Mit dieser pietätvollen Handlung machte er einen guten Eindruck, besonders bei denen, die ihre Anhänglichkeit an das alte Fürstenhaus bewahrt hatten.
Am Nachmittag fuhr der König nach Wilhelmshöhe und besichtigte inmitten des freudig erregten Publikums die Wasserkünste. Abends brachten die vereinigten Männergesangverein eine Serenade unter der Leitung des Hofkapellmeisters Reiß; damit endeten die erhebenden festlichen Tage.
[293] Die Kurhessen hatten nun ihren neuen Landesherrn von Angesicht zu Angesicht kennen gelernt. Ein edler Fürst, nicht als Eroberer des Landes, wohl aber als Eroberer aller Herzen, war er seinen neuen Landeskindern nahe getreten; mit Vertrauen sah man allgemein der Zukunft entgegen.
[12.3 1866er Krieg und Deutsches Reich]
Wie der König Wilhelm die Hoffnungen des gesamten deutschen Volkes in nie geahnter Weise der Verwirklichung entgegenführte, wie er den Gedanken der einheitlichen Gestaltung des deutschen Reiches mit Hilfe seiner Paladine, besonders seines großen Staatsmannes, zur Wahrheit werden ließ, das weiß alle Welt. – Wer aber die große, gewaltige Epoche seiner Regierung so durchlebt hat wie ich und meine Zeitgenossen, der erst hat einen Begriff von dem erstaunlichen Aufschwung, den unser vorher so ohnmächtiges und zerrissenes deutsches Vaterland nach dem Kriege von 1866 nahm, und von dem Wechsel, welcher in allen Verhältnissen eintrat. Von der Misere der früheren kleinstaatlichen Verhältnisse kann man sich heute gar keine Vorstellung mehr machen. Eine deutsche »Nation« als solche im Sinne der anderen Nationen kannte man derzeit nicht, Deutschland war bei den Ausländern nur ein geographischer Begriff, es gab nur Preußen, Hessen, Sachsen, Bayern usw. Jeder Staat unterhielt für sich diplomatische Beziehungen zu anderen Staaten, die Truppen unterstanden ihren Landesfürsten als obersten Kriegsherrn, die ihre Kontingente zur Bundesarmee im Falle eines Krieges zu stellen hatten.
Der Krieg von 1866, welcher der deutschen Bundesarmee ein Ende machte, liefert den Beweis über die Zerfahrenheit der militärischen Verhältnisse, die unter der Kleinstaaterei herrschte. Jedes Ländchen hatte seine Zollgrenzen, erst durch den Zollverein wurde eine gewisse Einheitlichkeit im Zollwesen herbeigeführt. Die Rechtsverhältnisse waren in jedem Staat andere. Das Verkehrswesen lag sehr im argen, auf der Landstraße sperrten Schlagbäume bei jedem Ort die Straßen, wer genötigt war, mit Wagen auf der Landstraße zu reisen, mußte [294] fortwährend den Geldbeutel in die Hand nehmen, um Chausseegeld zu zahlen. Maß und Gewicht war überall verschieden, die Ware wurde nach Scheffeln, Wispeln, Maltern, Himpten, Metzen, Vierteln und Gott weiß, was für Namen die Maße alle hatten, gemessen, die Flüssigkeiten nach Ankern, Eimern, Maß, Schoppen, Kännchen u.a.; gewogen wurde nach Zentnern, Pfund, Lot und Quentchen. Ebenso verschieden waren die Längen- und Flächenmaße; nach Ruten, Ellen, Fuß, Zoll und Linie, die je nach verschiedenen Staaten noch obendrein in der Länge variierten, wurden die Längen bestimmt, nach deren Quadraten die Flächen oder dem Kubus der Inhalt – ein Wirrwarr in den Maßverhältnissen, der in geschäftlicher Beziehung oft große Unzuträglichkeiten mit sich brachte. Am schlimmsten aber waren die Verhältnisse im Geldverkehr, Zahlungen in Goldmünzen wurden in Louisdor, Friedrichsdor, Νapoleonsdor, Dukaten, Pistolen u.a. geleistet, die einem stets wechselnden Kurs unterworfen waren oder mit einer Goldwaage erst auf ihr richtiges Gewicht geprüft werden mußten; die Münzen, besonders Dukaten, waren nämlich öfters am Rande beschnitten. Silber- und Scheidemünzen waren in fast allen deutschen Staaten verschieden; wir in Cassel rechneten nach Talern, Silbergoschen oder auch »guten Groschen« – 1 ¼ Silbergroschen, und Hellern; ein kupfernes 4 Hellerstück, eine meist fast platt abgegriffene Münze, nannte man einen »Dreier«, ein 8 Hellerstück eine »Schustertaler«. In Oberhessen und Süddeutschland rechnete man nach Gulden, Kreuzern und Batzen, in Bremen hatte man Grote und Schwaren, in Hamburg Mark und Schillinge u.s.f. Wenn Zahlungen in Papiergeld geleistet wurden, bekam man ein Sammelsurium von meist durch den Gebrauch fettig gewordenen, vor Schmutz oft kaum noch den Druck erkennen lassenden sogenannten »wilden Scheinen«. Wer eine Reise durchs deutsche Land unternehmen wollte, mußte entweder eine ganze Münzsammlung mit sich führen oder in jedem anderen Ländchen sein Geld mit Schaden gegen die übliche Landesmünze [295] umwechseln. Und so könnte ich noch manches aufzählen, wie und wo uns damals der Schuh drückte.
Gottlob ist heute alles anders, und daß es so ist, verdanken wir an erster Stelle der Titanenarbeit unseres herrlichen großen Reichskanzlers Otto von Bismarck. Er hat uns zu Kaiser und Reich verholfen; seiner Staatskunst gelang es nicht nur, die deutschen Stämme zu einigen, sondern auch die Wunden, die der Bruderkrieg geschlagen hatte, rasch zu heilen, Einheitlichkeit in die früher so verworrenen Verhältnisse hineinzubringen und Deutschland zu einer Machtstellung in der Welt zu verhelfen, die es früher niemals besessen hat. Er hat es fertig gebracht, den deutschen Michel aufzurütteln, ein nationales Empfinden bei ihm zu wecken – jetzt kann jeder Deutsche, wes Stammes er auch sei, sein herrliches großes Vaterland freimütig feiern in dem Liede »Deutschland, Deutschland über alles, über alles in der Welt«. – – –
[12.4 Kassel blüht auf, Vergrößerung des Unternehmens]
Nach dieser kurzen Schilderung über den Wandel der Verhältnisse in damaliger Zeit will ich fortfahren, über einiges Bemerkenswerte zu berichten, was uns die neue Zeit in den nächsten Jahren brachte.
Gleich wie alle größeren Städte im deutschen Reiche alsbald nach Konsolidierung der inneren politischen Verhältnisse sich vergrößerten und mächtig aufblühten, nahm auch Cassel in stetiger Weise zu. Die Bevölkerung unserer Stadt ist jetzt viermal so groß als damals, wo Cassel etwa 39.000 Einwohner zählte. Die Bautätigkeit steigerte sich infolge der wachsenden Bevölkerung von Jahr zu Jahr, die vorhandenen Baugeschäfte hatten alle vollauf zu tun.
Auch ich war durch größere Aufträge reichlich beschäftigt, so daß ich mich genötigt sah, meinen Geschäftsbetrieb zu erweitern und zu vervollkommnen; dazu gehörte auch die Beschaffung eigenen Fuhrwerks, das mir unentbehrlich wurde. Um die häufig vorkommenden kleineren Baufuhren bewältigen zu können, wollte ich zunächst mit einem Pferde anfangen. Als ich meinem Vater mein Vorhaben mitteilte, war er sehr wenig [296] davon erbaut, er sah die Notwendigkeit, selbst Pferde zu halten, nicht ein, weil ja jederzeit Fuhrleute zu haben wären; daß sich ein Geschäftsmann damals Pferde hielt, gehörte zu den Ausnahmen. Er meinte, wenn ich mir jetzt schon Pferde halte, werde man es für eine Großtuerei halten, füreine noble Passion, die für mich Anfänger gar nicht am Platze sei, denn daß die Equipage bald folgen werde, hielt er für selbstverständlich. Der gute Vater war bei seiner Ängstlichkeit gar zu leicht geneigt, aus meinen Schritten, die ich wagte, die ungünstigsten Konsequenzen zu ziehen. Um aber den Beweis zu liefern, daß ich nur geschäftliche Zwecke und nichts weniger wie eine noble Passion mit der Beschaffung eines Pferdes befolgte, kaufte ich mir vom Pferdehändler Rosenkranz einen alten Gaul für 100 Taler und von anderer Seite einen schon gebrauchten einspännigen Kastenwagen. In meinem Hintergebäude richtete ich den Stall ein, der noch knappen Platz für ein zweites Pferd bot. Wegen des mangelnden Raumes zu einer Burschenstube wurde in dem engen Stall ein Hängebett an der Decke befestigt, in das der Fahrbursch jeden Abend auf einer Leiter hineinklettern mußte.
[12.5 Abenteuerliche Pferdewagenfahrt]
Seit längerer Zeit schon hatte ich mir vorgenommen, die Steinbrüche in Breitenbach und Balhorn kennen zu lernen, aus denen ich das Sandsteinmaterial zu meinen Bauten bezog, über das ich öfters zu klagen hatte. Ich konnte mich aber immer noch nicht dazu entschließen, weil mir die Fahrt dorthin durch einen Lohnkutscher zu teuer kam. Jetzt aber, wo ich selbst Pferdebesitzer war, konnte ich mein Vorhaben ohne große Unkosten leichter ausführen. Onkel Lenderoth, derzeit Direktor der Möncheberger Gewerkschaft, mit dem ich in Geschäftsverbindung stand, stellte mir eine alte, halbverdeckte leichte Karriole zur Verfügung, die er selbst zu seinen Fahrten über Land benutzte; die Kutsche war ohne Bock und nur für zwei Personen eingerichtet. Weil ich bis dahin noch nie Gelegenheit gehabt, selbst zu kutschieren, machte ich unter Assistenz meines Fahrburschen am Abend vor meiner Fahrt nach Balhorn eine [297] kleine Probefahrt in der Wolfhager Straße, die mich von der Frömmigkeit und Lenkbarkeit meines »Max«, so hatte ich meinen Andulusier getauft, überzeugte, so daß ich den Mut in mir fühlte, die Fahrt am folgenden Tage selbständig zu unternehmen. Es war meine Absicht, allein fort zu fahren, aber meine liebe Frau, die zum ersten Male vereinsamt hätte zu Hause bleiben müssen, ließ mir keine Ruhe und bat mich inständigst, doch auch mitfahren zu dürfen. Meine Bedenken, daß die Fahrt ihr schaden könne, weil sie sich doch Schonung auferlegen müsse, suchte sie zu zerstreuen, und so gab ich schließlich ihrem Drängen nach. Nachdem ich den harten Sitz im Wagen durch Kassen und wollene Decken für mein Frauchen etwas bequemer hergerichtet hatte, bestiegen wir auf auseinander geklappten eisernen Tritten, ähnlich einer Hühnerleiter, das hochräderige Vehikel und fuhren, begleitet von den besten Segenswünschen meines Fahrburschen Adam, ab, hinaus in die Berge.
Anfangs fühlte ich mich als Rosselenker noch recht unsicher, die Peitsche handhabte ich sehr linkisch, knallen konnte ich gar nicht damit, ich gab jedenfalls eine komische Figur ab; das merkten wir an den Witzeleien uns begegnender Leute, die uns erheiterten. Mein Max war aber sehr trav, ich brauchte ihm nur mit dem Leitriemen über den Rücken zu klatschen, wenn er ein lebhafteres Tempo nehmen sollte. Gottlob war er kein Durchgänger; hatte er eine kleine Strecke getrabt, dann ging ihm die Puste aus – es war ein »Bauchbläser« –, so daß er sich in langsamem Schritt erst wieder erholen mußte. Als wir die ansteigende Wolfhager Straße hinanfuhren, kam er überhaupt nur im Schritt vorwärts und blieb von selbst stehen, um sich zu ruhen, wenn er nicht mehr fortkonnte. Ein Glück war es, daß wir zwei leichte Personen waren, an denen er nicht gar so schwer zu ziehen hatte, sonst hätte er ganz gestreikt.
So kamen wir denn langsam, aber sicher in seelenvergnügter Stimmung auf der Höhe der Straße an, die von [298] jetzt ab mit starkem Gefälle ins Ahnatal hinabführte; unser Wäglein kam bald stark ins Rollen – jetzt merkte ich erst daß ich kein Hemmwerk am Wagen hatte, um bremsen zu können. Ich fuhr nun langsam bergab und hielt den Gaul fest im Zügel, aber leider war die Schere zu kurz, die Karre kam ihm an die Hinterbeine, und das war dem sonst so frommen Tiere doch etwas ungemütlich, es fing an zu bocken und schlug nach hinten aus. Auf solche Kapriolen aber war ich noch nicht einstudiert, ich bekam es bei dem noch lange bergab führenden Wege mit der Angst und suchte, wenn die Bocksprünge gar zu bedenklich wurden, mir dadurch zu helfen, daß ich jedesmal seitwärts in einen Chausseesteinhausen hinein fuhr. Meine arme Frau bekam es bei dieser unsicheren Fahrerei erst recht mit der Angst, und an der steilsten Stelle, wo mein Gaul anfing, besonders ungemütlich zu werden, sprang sie in ihrer Aufregung, ohne daß ich es hindern konnte, aus dem hohen Wagen direkt auf die Straße und strauchelte dabei. Aufs heftigste erschrocken und erregt über den aus übertriebener Ängstlichkeit gewagten gefährlichen Sprung, hielt ich an und fragte meine Frau besorgt, ob sie sich weh getan habe; sie verneinte dies aber und suchte mich zu beruhigen. Das war aber nicht leicht, denn meine Stimmung war aus dem Gleichgewicht gekommen. Ich konnte es nicht unterlassen, meiner Frau ihre törichte Ängstlichkeit vorzuhalten, durch die sie sich in die größte Gefahr hätte bringen können – doch es war nun einmal geschehen, und ich dankte Gott, daß nichts Schlimmeres passiert war. Ich fuhr nun allein die Straße hinab und hielt mich immer seitwärts an den Steinhaufen entlang, wo ich einigen Widerstand fand, und kam, wenn auch auf etwas holperige Weise, unten im Ahnatal an; meine Frau ging zu Fuße.
Im Ahnatal rasteten wir kurze Zeit, um zu frühstücken, dabei hielt ich meiner lieben Frau eine Gardinenpredigt über das Geschehene. Ich stellte ihr vor, was alles bei ihr auf dem Spiel stände; sie solle sich nie wieder so vergessen und mich in [299] ähnlichem Falle erst anhalten lassen, damit sie ohne Gefahr aussteigen könne. Daß mit dem lammfrommen Tiere nichts Ernstliches passieren werde, davon wäre ich überzeugt.
Das heitere Temperament meines Weibchens trug schließlich den Sieg über meine sorgenvollen Gedanken davon und so bestiegen wir wieder unser Kabriolet und fuhren, wieder guten Mutes, weiter über Dörnberg nach Breitenbach, wo ich beim Wirt Friedrich ausspannte. Nach einem einfachen Mittagsessen ließ ich meine Frau ausruhen, und ich besorgte meine Geschäfte in den nahegelegenen Steinbrüchen, die mich einige Stunden in Anspruch nahmen. Von dort zurückgekehrt, tranken wir im Garten gemütlich Kaffee und ließen uns frischen Zwetschenkuchen dazu gutschmecken.
Bald darauf ließ ich wieder anspannen und trat den Heimweg an, der uns über Hof, Elgershausen und Niederzwehren führte. Beim Besteigen des Wagens entging es mir nicht, daß meine Frau Schmerzen empfinden mußte; ich fragte besorgt danach, aber sie bestritt entschieden, sich Schaden getan zu haben, sie sei nur ungeschickt eingestiegen.
Mein Brauner, der inzwischen durch reichliches Futter frische Kräfte gesammelt hatte, trabte munter los; er wußte, daß es in den Stall ging. Bis zum Dorfe Hof hatten wir gute, ebene Straße; in Hof selbst aber führte die Landstraße mitten durchs Dorf bei sehr starkem Gefälle. Beim Hinunterfahren auf dieser steilen Straße machte mein Gaul wieder dieselben Manöver wie im Ahnatal; ich konnte aber hier auf dem glatten Straßenpflaster den Wagen nicht aufhalten, wie dort. Meine arme Frau bekam es wieder mit der Angst und machte Miene, herauszuspringen. Ich flehte sie dringend an, doch ja nur sitzen zu bleiben, es werde nichts passieren, außerdem waren auch Dorfbewohner zur Stelle, die beispringen konnten. Ich mußte die Augen stets aufs Pferd richten, das auf dem glatten Pflaster wie auf Eiern ging. An einer Biegung der Straße rutschte der alte, steife Bock hinten etwas aus, kam aber zum Glück nicht zum Fällen. Aber meine Frau [300] war dadurch so erschreckt, daß sie in ihrer Angst zu meinem Entsetzen plötzlich wieder aus dem Wagen sprang. Ich war außer mir; einen Dorfbewohner, der hilfreich zusprang, bat ich, das Pferd zu halten und es, nachdem ich abgestiegen war, am Zügel die steile Straße hinab zu leiten; wir beide gingen bis vors Dorf hinterher. Obgleich meine Frau wieder vorgab, sich nicht weh getan zu haben – sie wollte meine große Erregung damit zu beschwichtigen suchen –, konnte ich ihren Worten doch nicht glauben, weil ich ihr ansah, wie sie den Schmerz verbiß.
Mit unserer frohen Laune, die wir uns trotz allen Ungemachs einigermaßen bewahrt hatten, war es nun ganz aus; ich hatte nur den einen Wunsch, erst glücklich wieder zu Hause zu sein.
Aber das Maß unserer Leiden war noch nicht voll. Es war inzwischen dunkel geworden; leider hatte unsere Musterchaise auch keine Laternen, die ich erst jetzt vermißte. Als wir durch Zwehren fuhren, war es schon ganz Nacht; bei meiner Kurzsichtigkeit konnte ich die Straße nur undeutlich erkennen. An einer Biegung der Landstraße stand an einer Hausecke ein großer Schreckstein – ich glaube, er steht heute noch –, ich lenkte jedoch zu früh in diese Biegung ein und rannte mit dem Vorderrad gegen den Schreckstein, so daß der Wagen hängen blieb. Die Folge davon war, daß der stark anziehende Gaul die Schere zerbrach. Das schon schlapp gewordene Pferd blieb zum Glück auf der dunkeln Straße sofort ruhig stehen, so daß ich absteigen und mir den Schaden, soweit es die Dunkelheit zuließ, besehen konnte. Der zerbrochene Scherenbaum hielt noch zusammen; bis zur nahegelegenen Freudensteinschen Wirtschaft leitete ich das Pferd an der Hand und half dann meiner vor Schreck weinenden Frau aus dem Wagen.
In der Wirtschaft nahmen wir etwas zu uns, jedoch war der Appetit uns gründlich vergangen. Der Wirt, dem ich mein Mißgeschick erzählte, ließ mir durch seinen Burschen den [301] zerbrochenen Scherenbaum mit einer Latte zusammenbinden. Auf meine Bitte durfte der Bursch mitfahren, der sich vorn auf dem Wagen eine provisorische Sitzgelegenheit eingerichtet hatte und die Zügel nahm. Nachdem durch eine Handlaterne die fehlende Beleuchtung am Wagen ersetzt war, fuhren wir im langsamen Tempo zur Stadt und kamen in diesem kläglichen Aufzug gegen 10 Uhr abends zu Hause an. Adam, der schon in tausend Ängsten geschwebt hatte, erwartete uns mit einer Laterne in der Hand vor der Einfahrt, ahnend, daß uns etwas zugestoßen sein müsse, weil wir so lange ausblieben.
An diese erste, selbst unternommene Wagenfahrt werde ich zeitlebens denken – das Unheil, das ich befürchtete, traf noch in derselben Nacht ein; ich mußte in der Frühe am nächsten Morgen den Arzt, meinen Freund Gottfried Krause, zu meiner erkrankten Frau holen. Gottlob überwandt die gute Natur meiner Frau diesen Unfall ohne nachteilige Folgen – sie erholte sich bald wieder, aber wir waren um eine Hoffnung ärmer.
[12.6 Zweites Pferd, neuer Pferde-Ärger]
Dies ernste Erlebnis hat bei mir keine angenehme Erinnerung an mein erstes Pferd hinterlassen. Auch an dem zweiten, das ich mir anschaffen mußte, weil sich einspännige Fuhren nicht lohnten, erlebte ich keine Freude. Ich hoffe, daß ich meine Leser nicht langweile, wenn ich auch von diesem noch erzähle.
Ein Bekannter meines Vaters, der Privatbereiter Schumann, hatte ein vom kommandierenden General von Plonski übernommenes Pferd zu verkaufen; es kostete nur 40 Taler und sollte durchaus zugfest sein. Nach Ansicht meines Vaters durfte ich diese Gelegenheit, zu einem billigen Pferd zu kommen, nicht unbenutzt lassen.
Ich sah mir das Pferd vorher an; es war eine Stute, die in Farbe und Größe zu meinem Max paßte, hatte aber viel mehr Temperament – es war angeblich ein Vollblut. Schumann meinte, das wäre eine gute Eigenschaft neben [302] einem etwas trägen Gaul, wie der meine; mein Pferdeverstand war damals noch gleich Null.
Ich überzeugte mich durch eine schwere Lastfuhre, die ich von beiden Pferden machen ließ, daß das Pferd zugfest war; allerdings war es bald quatschnaß von Schweiß, aber »das gibt sich« sagte Schumann. Der Kauf wurde perfekt, und ich war froh, auf eine so billige Weise zum zweiten Pferd gekommen zu sein, das nun seinen Platz, wenn auch etwas knapp bemessen, in meinem Stalle bekam.
Am anderen Morgen aber klagte mir der Fahrbursch schon sein Leid, daß ihn der »Bumski«, so nannte er das Pferd nach seinem früheren Besitzer, nicht habe schlafen lassen. »Der Gull hott’n Deiwel im Liewe, der schläht noch alles an Herschenkerner; he hott mich bahle us’m Bette rußgeschlahn,« berichtete mir Adam und zeigte mir die Spuren von den Hufschlägen an der Wand und unter seinem Hängebett, das unter der Stalldecke angebracht war.
Diese wenig erfreuliche Mitteilung veranlaßte mich, bei Schumann diese Untugend des Pferdes sofort zu rügen, der mich aber beruhigte. »Das gibt sich,« sagte er wieder, und riet mir, die Pferde umzustellen, sie müßten sich erst aneinander gewöhnen. Die veränderte Stellung hatte auch einigen Erfolg, es trat mehr Ruhe im Stalle ein, und wenn das erregbare Tier mal ausfeuerte, konnte es wenigstens Adams Bett nicht mehr treffen; weil es im übrigen vor dem Lastwagen seine Schuldigkeit tat, nahm ich seine Untugenden mit in den Kauf.
[12.7 Pannenreiche Kutschfahrt nach Wilhelmshöhe]
Wie es nun so geht, wenn man erst Pferde hat, dann will man auch mal damit Kutsche fahren; ich hatte aber noch keine, konnte mir aber beim Sattler Engelhardt in der Müllergasse eine solche mietweise leihen, ebenso die Chaisengeschirre für die Pferde. Und das tat ich denn auch, um an einem schönen Ostertage mit meinen Vettern Scheurmann, die gerade zu Besuch in Cassel weilten, eine Spazierfahrt nach Wilhelmshöhe zu unternehmen. Einen Kutscher hatte ich aber [303] noch nicht; mein Fahrbursch war für den Kutschbock noch nicht equipiert, er trug nur die Bluse und mit Vorliebe seine blaue Husarenmütze, die er aus seiner Dienstzeit noch behalten hatte. Dagegen war Vetter Louis Scheurmann bereit, die Zügel zu führen, er hatte schon oft selbständig gefahren und wußte mit Pferden umzugehen. So vertrauten wir uns denn auch seiner Führung an und fuhren in der Mietskutsche, einer alten Kalesche, mit meinen stolz aufgeschirrten Pferden von meinem Hause ab. Meine Frau sah uns nicht ohne Sorgen abfahren, die erste unglückliche Wagenfahrt war ihr noch zu frisch in der Erinnerung geblieben; aber Vetter Louis zerstreute ihre Bedenken.
Nach flotter Fahrt kamen wir in Kirchditmold an und machten dort beim Wirt Lingelbach Halt, um die Kalesche des schönen Wetters wegen aufzumachen, d.h. die Fenster und das Deckleder abzunehmen. Vetter Louis und ich besorgten dies Geschäft, während die übrigen einen Trunk in der Wirtschaft zu sich nahmen; mein Vetter mußte den Leitzügel dabei aus der Hand legen, welcher beim Wiederaufheben fatalerweise dem »Bumski« unter den Schwanz geriet. Der Versuch, den Zügel unter letzterem wieder herauszuziehen, brachte aber das reizbare Tier in eine solche Aufregung, daß es wütend ausschlug – es entpuppte sich als ein Strangschläger erster Güte. Je mehr an dem Zügel gezerrt wurde, desto rasender wurde die Stute, die alles, was sie beim Ausfeuern erreichen konnte, zertrümmerte. Ein Glück war es, daß mein alter Gaul ruhig stand und deshalb schnell abgespannt werden konnte, sonst wären ihm alle Knochen kaputgeschlagen.
Der Wagen, der jetzt ganz in der Gewalt des Strangschlägers war, mußte von uns gehalten werden, er drohte umzufallen; jetzt schlug er auch noch über die Deichsel, brach diese, zur Erde niederstürzend, in zwei Teile und rannte sich mit den scharfen Splittern eine tiefe Fleischwunde in die Brust. Auf dem Boden liegend, raste das ungeberdige Tier, das noch mit den Strängen am Wagen fest war, immer ärger, [304] es wälzte sich auf dem Rücken bis unter den Chaisenkasten und verarbeitete diesen von unten so, daß der ganze Boden in Fetzen ging. Nach vieler Mühe und nicht ohne Gefahr gelang es uns, die Zugstränge durchzuschneiden und den Wagen von dem Pferde wegzuziehen, so daß es schließlich wieder auf die Beine zu stehen kam. Aber wie sah das Tier aus – über und über in Schweiß gebadet, hatte es sich im Chausseestaub herumgewälzt; es war in der Farbe mehr Esel wie Pferd. Das arme Vieh blutete stark und zitterte am ganzen Leibe; fieberhaft atmend, schlugen ihm heftig die Seiten – es war eine wahre Jammergestalt.
Mit unserer Spazierfahrt war es nun nichts mehr, wir konnten jetzt wirklich sagen: »Adje, Chaise.« – Nachdem wir uns von unserem Schrecken erholt hatten, pilgerten meine Vettern weiter, und ich hatte das Vergnügen, dafür zu sorgen, daß ich mit meinem zerschundenen Fuhrwerk glücklich wieder heimkam. Die Pferde hatte ich einstweilen im Stalle der Wirtschaft untergebracht; dann besah ich mir den angerichteten Schaden. Der Wagen war arg zertrümmert; man hätte glauben sollen, er wäre von einer Kartätsche getroffen, so zerschlagen hatte ihn das Pferd.
Mit Hilfe eines von meinen Arbeitern aus Kirchditmold, der unter den Zuschauern war, machte ich die Kalesche wieder zu, ließ mir vom Wirt eine alte Deichsel borgen, spannte den alten Max davor und ließ die ramponierte Kutsche von meinem Arbeiter nach der Wolfhager Straße bringen. Ich ging voraus, um meine Frau auf dies neue Pech vorzubereiten, damit sie nicht zu sehr erschrak; ihre Befürchtung, daß uns etwas zustoßen werde, weil auch diesmal kein eigentlicher Kutscher fuhr, hatte sich leider bewahrheitet.
Das Untier ließ ich erst abends heimholen, um kein Aufsehen zu erregen. – – –
So erging es mir mit dem billigen 40 Talerpferd. Der Vorfall war mir eine Lehre, durch den erlittenen großen Schaden wurde ich klug; ich schaffte die beiden alten Pferde [305] sofort ab und kaufte für schweres Geld zwei tadellose junge Pferde. Eines davon, mein »Mohrchen«, ein auffallend schönes Tier – es war deshalb stadtbekannt – leistete mir über 20 Jahre seine treuen Dienste. Es vereinigte alle Tugenden seiner Art in sich, hatte auch viel Temperament, war dabei fromm wie ein Lamm, unverdrossen in der Arbeit und überall verwendbar; ich habe es später zureiten lassen und lange Zeit selbst geritten; als es nichts mehr leisten konnte, gab ich ihm das Gnadenbrot bis zu seinem Ende – beim Roßschlachter.
Das war die etwas lang geratene Geschichte von meinen ersten Pferden. – Daß ich noch bei Lebzeiten meines Vaters bei der zunehmenden Ausdehnung meines Geschäftes mir bald acht Pferde anschaffen mußte, will ich noch beiläufig erwähnen.
[12.8 Häuslichkeit und Verwandte]
Doch nun von etwas anderem – von unserer Häuslichkeit!
Wie ich schon erwähnte, bildeten wir zwei jungen Eheleute in den ersten vier Monaten nach unserer Verheiratung den alleinigen Hausstand, der sich im Oktober 1868 um eine weitere Person, unsere Dienstmagd, erweiterte. Im Jahre darauf vergrößerte sich unser Haushalt um weitere drei Personen, nämlich durch meine Schwägerin Dora als ständigen Besuch, ferner durch einen Bauführer, der mit Kost und Logis bei mir in Stellung war, sowie durch unseren Fahrburschen. Mein junges Frauchen hatte jetzt schon tüchtig zu tun; sie verstand es aber trotz ihrer Jugend recht gut und freudig zu wirtschaften; über das, was sie noch nicht wußte, holte sie sich Rat bei meiner Mutter.
Mit meinem Elternhause unterhielten wir einen regen Verkehr, ebenso mit unseren nahen Verwandten, darunter am meisten mit der Familie Scheurmann. Von unserem Hause nach der Stadt hatten wir einen großen Umweg zu machen, entweder durch den unteren grünen Weg, die jetzige Giesbergstraße, oder den Rothenditmolder Fußweg. Wenn [306] wir aber mal besonders schnell zur Stadt mußten, gingen wir stracks durch die an meinen Garten angrenzenden Nachbargärten, die nur durch meist offene Hecken von einander getrennt waren. Die nachbarlichen Beziehungen waren damals so vertraulicher Art, daß man ungeniert sich durch die Hecken gegenseitig Besuche machte und den Durchgang erlaubte.
[12.9 Freundes- und Singkreise]

KI-Entrasterung: Hans D. Baumann (→).
Außerhalb unseres Verwandtenkreises waren wir noch vielfach anderen, mit uns bekannt gewordenen Personen und Familien nähergetreten, mit denen uns dauernde Freundschaftsbande verknüpften. Es entwickelte sich ein angenehmer gesellschaftlicher Verkehr mit diesen Freundeskreisen, der uns viele frohe, vergnügte Stunden brachte und manche glückliche Erinnerung in mir auslöst. Es würde zu weit führen und es hat auch keinen Zweck für den Leser, die Namen aller derer aufzuzählen, mit denen wir in regerem Verkehr standen. Ich will nur nicht unerwähnt lassen, daß aus diesen freundschaftlichen Beziehungen dauernde geschäftliche, ja sogar Familienverbindungen hervorgingen; die Beziehungen zu unseren Freunden Seidlers, Lauckhardts, Potentes, Zahns u.a. stammen aus damaliger Zeit.
Auch einen weiteren Freund darf ich nicht unerwähnt lassen, der uns drei Brüdern besonders nahe stand, und der mit uns alt geworden ist, nämlich Freund Heinrich Schiebeler. Vereint mit ihm, einem der besten Tenöre der Casseler Liedertafel, bildeten wir ein Solo-Männerquartett, das nach unseren gemeinsamen Anfangsbuchstaben derzeit das »S.C.H.-Quartett« benannt wurde. Wir hatten es durch unsere Liebe zum Männergesang und fleißiges Streben so weit gebracht, daß wir uns einer allgemeinen Anerkennung in Sangeskreisen zu erfreuen hatten, so daß wir mehrfach zur Mitwirkung in öffentlichen Konzerten aufgefordert wurden.
Die größte Befriedigung aber fanden wir, wenn wir unter uns oder im kleineren Kreise singen konnten – auch meinem damals schon leidenden Vater haben wir durch unseren Gesang noch manche Freude bereitet. – Unser Bruder [307] August, der eine sehr schöne, sympathische Baritonstimme hatte, verlor durch eine starke Erkältung, die er sich bei einem Gartenfest in einer kühlen Nacht holte, leider seine Stimme, und damit waren wir genötigt, unser Quartett aufzugeben. Unserem Freunde Schiebeler haben wir zu dessen 70. Geburtstag in Erinnerung an diese schöne Zeit eine Aufnahme gewidmet, die uns vier Quartettsänger als alte Grauköpfe im Bilde zeigt (siehe d.). – – –
[Zwischen den Seiten 306 und 307:]

»Das S.C.H.-Quartett.« Zur Erinnerung an sangesfrohe Zeiten.
[12.10 Hausschlachtung]
Mit der Vergrößerung unseres Haushaltes, den öfteren Gesellschaften, die wir jetzt abhalten mußten, steigerten sich natürlich auch die Bedürfnisse für das Haus, deren Einkäufe wegen der großen Entfernung von der Stadt meist nur unter erschwerenden Umständen gemacht werden konnten. Wir entschlossen uns deshalb, »ins Haus zu schlachten«, und hielten im kommenden Winter unser erstes Schlachtefest, dem zwei fette Schweine zum Opfer fielen. An unserer Tante Minchen, die am Wurstkessel seit Jahren beim Hausschlachten meiner Eltern schon Erfahrungen gesammelt hatte, fanden auch wir eine treue Stütze.
Der erste Wurstekohl, der am Abend im Beisein meiner Familie festlich begangen wurde, lieferte eine Probe von dem gelungenen Schlachtewerk, und der reiche Segen an stattlichen schönen Würsten, die vorläufig in der guten Stube an Stangen dicht aneinandergereiht aufgehängt waren, erfreute unser aller Herz.
So hatten wir drei Jahre hintereinander unsere helle Freude an unserer Hausschlachterei, und ebenso die vielen Freunde und Verwandten, für die wir stets ein offenes Haus hatten. Beim vierten Male aber wurde mir das Hausschlachten gründlich verleidet, meine sämtlichen schönen Würste, die ich stets bei meinem Metzger in der Stadt räuchern lassen mußte, weil mir eine Räucherkammer fehlte, waren nämlich durch zu heißes Räuchern verdorben, so daß viele davon kaum genießbar waren; ich verschenkte den ganzen Vorrat der schönsten Würste an kleine Leute zu geeigneter Verwendung; [308] einen weiteren Versuch zum Hausschlachten habe ich danach nie mehr gemacht. – –
[12.11 Grunderwerb-Pläne]
In der äußeren Umgebung meines Besitztums hatte sich, seitdem ich mich dort angekauft hatte, noch nichts geändert; es schien so, als ob ich in meiner einsamen Lage auf Jahre hinaus durch nichts gestört werden sollte. Da bemerkte ich eines Tages, daß auf dem Felde vor meinem Hause ein Geometer mit mehreren Hilfsarbeitern dabei beschäftigt war, Vermessungen und Nivellierungen vorzunehmen, die längere Zeit in Anspruch nahmen. Ich erkundigte mich nach dem Zwecke dieser Vermessungen und erfuhr, aber ganz vertraulich, daß das Terrain zur Anlage des Bahnhofs für die neue Halle-Casseler Bahn in Aussicht genommen sei; es handele sich aber zunächst nur um Vorarbeiten, um zu prüfen, inwieweit sich dies Terrain zur geplanten Anlage eignen werde, es seien jedoch außerdem noch mehrfach anderweite Stellen ins Auge gefaßt worden.
Diese Mitteilung, wenn sie auch in ihrer Schlußfolgerung noch fraglich erschien, war mir außerordentlich wertvoll; ich sagte mir, daß mit der Anlage eines Bahnhofs unmittelbar vor meinem Hause der Grundwert in dieser Gegend erheblich steigen würde, und trat dem Gedanken näher, meinen Grundbesitz durch Erwerbung benachbarter Grundstücke zu erweitern.
Ich tat denn auch Schritte nach dieser Richtung hin und verhandelte mit den Besitzerinnen des an mein Grundstück anstoßenden, diesem gleich großen Gartens, zwei begüterten alten unverheirateten Damen, mit denen ich mich jedoch wegen des Preises noch nicht einigen konnte.
[12.12 Geburt von Tochter Emilie, Industrie-Ausstellung]

»Das Orangerieschloß mit der Industrieausstellungshalle zu Kassel.« Aus »Über Land und Meer«, Bd. 34, 1875. Oben am Hang, an der Südseite des Friedrichsplatzes: das Auetor an seinem damaligen Standort.
*Archiv Hans D. Baumann
Hier klicken (→) für eine Wikisource-Seite mit einem Artikel aus Heft 11, S. 171–174 der »Gartenlaube« von 1870 über die Kasseler Industrie-Ausstellung von 1870. Titel: »Ein Tempel der Hauscultur«. Dort auch ein Holzstich, auf dem man das Ausstellungs-Gebäude von der anderen Seite, vom Auetor her sieht.


Die Drahtbrücke, 1900 datiert bzw. 1904 gestempelt. Am anderen Ufer das Pensionat Salfeldt, Sternbergstraße 19a.*MA
Hier klicken (→) für ein Foto von Eugen Kegel: Drahtbrücke, 1889. (Universitäts-Bibliothek Kassel)
Inzwischen kam das Jahr 1870.
Ehe ich über weiteres aus diesem hochbedeutungsvollen Jahre berichte, will ich des freudigen, beglückenden Ereignisses von der Geburt unseres ersten Töchterchens gedenken, unserer Emilie, die uns am 8. Januar geboren wurde.
In diesem Jahre kam ein Unternehmen zustande, das für unsere Stadt von weitgehendster Bedeutung war. Es war [309] die »Allgemeine Industrie-Ausstellung für das Gesamtgebiet des Hauswesens«, die erste große Ausstellung, die überhaupt in unseren Mauern stattfand. Der Urheber des Gedankens war unser Mitbürger, Fabrikant Keerl, der in Erfahrung gebracht hatte, daß das Ausstellungsgebäude von der im Jahre vorher stattgehabten Wittenberger Ausstellung sehr preiswert zu haben war. Diese günstige Gelegenheit gab die Veranlassung dazu, der Ausstellungsfrage näher zu treten, die in der Vereinigung der für unsere Verhältnisse passenden Gebäude mit unserem vornehmen Orangerieschloß und der Karlsaue eine außerordentlich glückliche Lösung bot. Es trat alsbald ein geschäftsführender Ausschuß zusammen, bestehend aus dem Oberbürgermeister Nebelthau als Vorsitzenden, den Stadträten Hentze und Becker und dem Fabrikanten Keerl, welcher das Geschäft über den Ankauf der Gebäude mit dem Ausstellungskomitee in Wittenberg abschloß und die einleitenden Schritte für die Organisation der Casseler Ausstellung übernahm. Zur Bewältigung der vielfachen, umfangreichen Arbeiten, die in kürzester Zeit erledigt werden mußten, wurde ein Zentralausschuß gebildet, dem in zahlreichen Sektionen die mannigfachen Geschäfte übertragen wurden, die mit der Einrichtung und dem Betriebe einer solchen großen Ausstellung verknüpft sind. Auch ich wurde in diesen Zentralausschuß gewählt und bekam die Sektion für bauliche Herstellungen.
Die Ausstellung gab die Veranlassung zur Wiederinstandsetzung des Orangerieschlosses, das bis dahin in seiner alten verwahrlosten Verfassung geblieben war. Im Zusammenhang mit diesem schönen Schlosse bekam die Ausstellung ein vornehmes Gepräge; die Säle dienten zu Prunkräumen, die Hälfte davon zu Festsälen für Konzerte und feinere Restaurants. Die Restauration wurde einem bewährten Wirt, dem Restaurateur Behlendorf aus Leipzig, verpachtet, der den guten Ruf, der ihm vorausgegangen war, in jeder Weise rechtfertigte; eine feinere Wirtschaftsführung hatte man bis dahin in Cassel noch nicht kennen gelernt.
[310] Für die Ausstellungskonzerte wurde die Mansfeldsche Kapelle engagiert, ein Frankfurt Orchester, das neben seinem hervorragend tüchtigen Kapellmeister eine große Anzahl vorzüglicher Künstler zu seinen Mitgliedern zählte.
So konnte denn diese Ausstellung, die aus allen Teilen unseres deutschen Vaterlandes von Ausstellern reich beschickt war, unter den günstigsten Aussichten eröffnet werden.
Die feierliche Eröffnung fand am 1. Juni, mittags 12 Uhr, in der festlich geschmückten Rotunde des Orangerieschlosses statt, zu der die Spitzen der Behörden und des Militärs geladen waren. Fabrikant Keerl hielt die Festrede, der ein eigens für diese Feier komponierter Festmarsch folgte, unter dessen Klängen die Versammelten einen Rundgang durch die weiten Räume antraten. Um 3 Uhr begann das Diner im Orangerieschloß, an welchem etwa 400 Personen teilnahmen, Aussteller und Vertreter aus allen Teilen Deutschlands, aus Norwegen, England usw. Der Verlauf des Festbanketts war ein äußerst angeregter, eine Rede folgte der anderen. Die Befriedigung über die getroffenen Arrangements war eine allgemeine. Die treffliche Verpflegung und der vorzügliche Wein Behlendorfs, dabei die herrliche Musik der Mansfeldschen Kapelle brachten uns Festteilnehmer in eine überaus animierte Stimmung, in der auch ich erst in später Abendstunde bedenklich schwankenden Schrittes, am Arme lieber Freunde, den weiten Weg in meine entlegene Residenz zu Weib und Kind einschlug; solch einen festlichen Tag hatte ich in Cassel noch nicht mitgemacht.
Die Stadt Cassel hat dieser Ausstellung gar manches zu danken; an erster Stelle die Anlage einer zweiten Fuldabrücke, der neuen Drahtbrücke, die zur Herstellung einer direkten Verbindung der Unterneustadt mit dem Ausstellungsgebiet von einer Aktiengesellschaft erbaut wurde. Auch die Löwenbrücke, deren Ufermauern an beiden Seiten der kleinen Fulda als Ruinen unter der alten Kattenburg standen (siehe deren Abbildung), wurde wieder hergestellt, sodaß damit an drei [311] Stellen Verbindungswege von der Stadt nach der Ausstellung geschaffen waren.
[Zwischen den Seiten 310 und 311:]

Die ehemalige Kattenburg von der Aue aus gesehen.
Auf dem großen Innenhofe der Kattenburg hatte Direktor Renz seinen Zirkus aufgebaut, in dem er mit seiner berühmten Kunstreiter-Truppe während der Ausstellung seit langer Zeit zum ersten Male wieder Vorstellungen gab.
[12.13 Verkehrsverhältnisse, Wigands Pferdebahn, Thaliatheater]

»Grosse Wohnungsnoth bei der 1000 Jahrfeier in Cassel« 1913, also 43 Jahre nach Eröffnung der Allgemeinen Industrie-Ausstellung.*MA
Hier klicken für das Kapitel auf dieser Website über die Pferde- und Trambahn.
Hier klicken für das Kapitel auf dieser Website über die Domäne Wilhelmshöhe.
Durch die erfolgreiche Reklame für die Ausstellung wurde Cassel ausnahmsweise stark besucht; der Zuzug der Fremden war ein so erheblich größerer, daß die vorhandenen Hotels längst nicht ausreichten; es mußten deshalb Privatwohnungen beschafft werden, für die der Wohnungsausschuß zu sorgen hatte.
Selbstedend steigerte sich dadurch auch die Zahl der Besucher unserer schönen Wilhelmshöhe. Die mangelhaften Verkehrsverhältnisse zwischen Cassel und Wilhelmshöhe machten sich jetzt sehr fühlbar; wer nicht zu Fuß hinauf wandern wollte, konnte nur in einigen Zügen mit der Eisenbahn bis zum Wilhelmshöher Bahnhof fahren oder mußte eine Droschke benutzen, deren erschrecklich abgemagerte Pferde nicht imstande waren, ein flottes Tempo einzuschlagen.
Um dieser Kalamität einigermaßen abzuhelfen, richtete der Buchhändler Wigand am Königsplatz Omnibusfahrten ein, die alle zwei Stunden von morgens früh 8 Uhr bis abends 10 Uhr von seinem Hause abfuhren und die Passagiere für 5 Silbergroschen bis an die Domäne Wilhelmshöhe und ebenso von dort zurückbeförderten. An den Wassertagen fuhren die Omnibusse von 12 Uhr ab stündlich. Die armen Pferde aber kamen mit den oft voll besetzten Wagen nur langsam vom Fleck, so daß man fast in derselben Zeit zu Fuß heraufkommen konnte.
Kurze Zeit nach der Eröffnung der Ausstellung begannen im Königlichen Theater die Theaterferien; das Theater blieb, wie noch jetzt während der Hochsaison, auf beinahe zwei Monate geschlossen. Dagegen hatte ein neuerbauter Musentempel im unteren Grünen Weg, das »Thaliatheater«, seine Pforten [312] dem Publikum geöffnet, das unter Leitung seines Besitzers, des Theaterdirektors Axtmann, mit einer tüchtigen Schauspielertruppe sich bald die Gunst der Casselaner erwarb und sehr gut besucht wurde. Im Thaliatheater fand vorzugsweise die heitere Muse eine Stätte, die ihr im Hoftheater versagt blieb.
So nahm denn die Ausstellung mit alle dem, was neben her in unserer vorher so stillen Stadt geboten wurde, einen sehr befriedigenden Verlauf; der Fremdenzufluß steigerte sich bei dem schönen Sommerwetter von Tag zu Tag. Einen Glanzpunkt bildete der Besuch des Königs, der auf seiner Reise nach Ems, einer Einladung des Ausstellungskomitees folgend die Ausstellung besichtigte und sich anerkennend über dieselbe äußerte. Nach einem Dejeuner, das im Hauptrestaurant eingenommen wurde, verließ der König, sich huldvoll verabschiedend, die Ausstellung, um seine Fahrt nach Ems fortzusetzen.
[12.14 Westliche Stadterweiterung durch Aschrott, Weinberg-Ausbau, Grundstückskäufe]
Siegmund Aschrott, maßgeblicher Erschließer des »Vorderen Westens«. Für seine Erwähnung in Gustav Henkels Vortrag »Selbsterlebtes aus der Entwicklung der Elektrotechnik« (auf dieser Website) hier klicken. Für den Wikipedia-Beitrag hier klicken (→).
Drei Bilder aus einem Prospekt von 1908:

Der Ständeplatz von der heutigen Ecke Fünffensterstraße.*MA

Die Hohenzollernstraße, die heutige Friedrich-Ebert-Straße.*MA

Die Hohenzollernstraße, rechts die Alte Hauptpost. Unten: Die Kaiserstraße, heute Goethestraße, vom heutigen Rudolphsplatz aus nach Osten.*MA
Unter den Neuerungen, die sich in unserer Stadt zur Zeit der Ausstellung vollzogen, sind besonders die Straßenanlagen zu erwähnen, die in der westlichen Stadterweiterung in Angriff genommen wurden, und mit denen der Anfang zu den jetzt weit ausgedehnten Stadtteilen im Hohenzollernviertel und auf dem Weinberg gemacht wurde.
Der Fabrikant Sigmund Aschrott, der seither sein großes Geschäft hauptsächlich in Segeltuchfabrikaten machte und später in bedeutenden Armeelieferungen, hatte sich der Grundstücksspekulation zugewandt. Er kaufte nach und nach den größten Teil der Ländereien in der äußeren Gemarkung unserer Stadt und den angrenzenden Gemarkungen von Wehlheiden und Kirchditmold usw. auf und gewann durch diesen Besitz einen bedeutenden Einfluß auf die spätere Entwickelung der Stadt. Er ließ für das weite Gebiet einen Bebauungsplan ausarbeiten, der sich immer mehr nach Westen ausdehnte, in der Weise, wie er in dem heute bestehenden Straßennetz ausgeführt ist. Der Hauptstraßenzug, durch den das Aschrottsche Gebiet [313] aufgeschlossen werden sollte, bildete die jetzige Hohenzollernstraße. Vom Ständeplatz bis etwa zur Bismarckstraße führte dieser Straßenzug über Grundbesitz, den Aschrott nicht erworben hatte. Für den in diese Straße fallenden Teil dieser Grundbesitze beantragte Aschrott das Enteignungsverfahren, das ihm von der Stadt bewilligt und vom König genehmigt wurde. Für die Abschätzung der Grundstücke wurden drei Sachverständige, Kreisbaumeister Schuchard, Baumeister W. Koch und ich, erwählt.
Zu gleicher Zeit mit der Hohenzollernstraße wurde auch der Weinberg, vom Rondel an, und die obere Sophienstraße ausgeführt, und mit diesen drei Straßen der Anfang zu den jetzt weit ausgedehnten schönsten Teilen unserer Stadt gemacht. Der ehemalige Schaumburgsche Garten auf dem Weinberg wurde von dem früheren Apotheker in Batavia (?), Waitz, angekauft, der sich eine Villa darin erbaute, die später durch Umbau vergrößerte Villa des ehemaligen russischen Botschafters, des Generals v. Schweinitz. Nach der Anlage der oberen Sophienstraße kaufte ich von Waitz in Gemeinschaft mit meinem Vetter Hochapfel ein größeres Bauterrain auf beiden Seiten der Sophienstraße, das bis zur Wehlheider Grenze, jenseits der später angelegten Augustastraße, ging.
[314] 13. Während des deutsch-französischen Krieges.
[13.1 Der 1870er Krieg]
Ein fröhliches, bewegtes Leben und Treiben herrschte in Cassels Mauern, seitdem die allgemeine Industrie-Ausstellung eröffnet war. Dem Publikum wurden dadurch abwechselungsreiche Unterhaltungen und Genüsse geboten, an die man in dieser Fülle in Cassel sonst nicht gewöhnt war. Das Geld roulierte wie nie zuvor, an Gelegenheit zum Geldausgeben fehlte es ja nicht – warum auch nicht, es wurde damals leicht verdient, alle Geschäfte florierten, und der verstärkte Zuzug der Fremden brachte den Geschäftsleuten viel Geld ein.
Wir lebten im tiefsten Frieden; König Wilhelm war in Ems, sein Kanzler erholte sich auf seinem Sommersitz in Varzin. Unsere Nachbarn in Frankreich bliesen Friedensschalmeien, der französische Premierminister Olivier erklärte im »gesetzgebenden Körper«, daß der Frieden niemals gesicherter gewesen sei, wie gerade jetzt. Nur in Rom, der Residenz des souveränen Papstes, der Hauptstadt des Kirchenstaates – ein geeinigtes Königreich Italien bestand derzeit noch nicht – stritten die Kirchenfürsten auf dem »ökumenischen Konzil« um die Einführung des »Unfehlbarkeitsdogmas«. –
So stand es in der damaligen Zeit in Europa, die hohe Politik ruhte – kein Mensch konnte ahnen, daß wir am Vorabend welterschütternder Ereignisse standen – als Spanien plötzlich von sich reden machte, das nach einem König suchte. Die Königin Isabella, berüchtigten Angedenkens, war zwei Jahre vorher vom Throne gestürzt und hatte sich mit ihrem Söhnchen Alfred nach Paris in Sicherheit gebracht. Die Spanier wollten von den Bourbonen nichts mehr wissen. [315] Marschall Prim, der an der Spitze der provisorischen Regierung stand, war bemüht, den verwaisten Königsthron von neuem zu besetzen. Er lenkte das Augenmerk der Spanier auf den katholischen Prinzen Leopold von Hohenzollern, den Bruder des Fürsten von Rumänien, und bot dem Prinzen die Königskrone an, die dieser annahm.
Da, wie mit einem Zauberschlage verwandelte sich binnen wenigen Tagen die politische Situation aus einer wahrhaft stagnierend-friedlichen in eine äußerst bedenklich-kriegerische. Unsere Nachbarn, die Franzosen, erhoben ein gewaltiges Geschrei über die Wahl dieses Prinzen, und warum? Er hieß Hohenzollern – sonst nichts. Er war zwar ein Urenkel Napoleons, er war gut katholisch. er war gar kein eigentlicher Verwandter des preußischen Königshauses, aber er hieß »Hohenzollern«, das genügte. Der Name »Hohenzollern« wirkte auf die leicht zu erhitzende Einbildungskraft unserer Nachbarn, wie das rote Tuch auf den Stier, sie ließen sich da durch verleiten, blindlings in ihr Verderben hinein zu rennen. Die französischen Staatslenker an ihrer Spitze und die Volksvertreter im gesetzgebenden Körper in Paris führten eine Sprache, die an eitler Selbstüberhebung nichts zu wünschen übrig ließ. Wer gab ihnen das Recht, eine freie, unabhängige Nationale zu bevormunden und ihr vorzuschreiben, aus welchem Fürstenhause diese ihren König wählen sollte? Hatten sie denn noch nicht begriffen, daß die Zeiten vorüber waren, wo sie in die Geschicke anderer Völker und Staaten ungehindert und ungestraft eingreifen konnten? Hatten sie nicht wahrgenommen, daß außer der »Grande Nation« auch noch ein anderes Volk an der »Spitze der Zivilisation« marschierte, seitdem es sich selbst wiedergefunden hatte, nämlich das deutsche Volk?
Nein – nichts von alledem. – Die maßlose Arroganz und der Chauvinismus, der den Franzosen im Blute steckte, hatte immer noch die Oberherrschaft behalten. Sie konnten und wollten es nicht verwinden, daß sie im deutschen Volke nach dem Kriege von 1866 einen Rivalen gefunden hatten, der [316] ihnen die führende Stelle unter den Nationen Europas streitig machte. Sie konnten »Sadowa« nicht vergessen, von dessen Schlachtfeld die Macht und der Ruhm des großen Hohenzollernfürsten, König Wilhelms von Preußen, seinen Ausgangspunkt gefunden hatte. – »Revanche für Sadowa« hieß das geflügelte Wort, das zum Leitmotiv für fast alle französischen Politiker wurde. Das französische Volk betrachtete die Erfolge Preußens, die dieses ohne Zutun Frankreichs errungen hatte, als eine Demütigung für seine Ehre und Würde, und zu dieser sollte noch eine weitere hinzukommen in der Wahl eines Hohenzollern zum König von Spanien? – Das konnte und wollte der französische Nationalstolz nicht ertragen – – jetzt bot sich eine Gelegenheit, dem vermeintlichen preußischen Machtgelüste mit strafender Hand entgegen zu treten und die längst erwünschte »Revanche für Sadowa« zu vollziehen. Die Großmäuler in der französischen Kammer hatten jetzt Oberwasser, sie hatten im König von Preußen einen Sündenbock gefunden, der für die den Franzosen durch die Kandidatur des Prinzen Leopold angetane Kränkung ihrer Eitelkeit haftbar gemacht werden sollte. – Ihr schlapper, alternder Kaiser Napoleon, dessen Thron schon längst bedenklich ins Wackeln geraten war, und welcher nur noch durch einen siegreichen Krieg wieder befestigt werden konnte, wurde von seiner bigotten Frau gegen das protestantische Preußen aufgehetzt. So ließ sich der gekrönte Abenteurer von seinen Ratgebern zu diesem gewagtesten seiner Abenteuer, zum Kriege gegen Preußen verleiten, der ihm Land und Krone kosten sollte.
Obgleich die ganze Sache den König Wilhelm gar nichts anging und er ausdrücklich erklärt hatte, sich in die Entschließungen des Prinzen Leopold nicht einmischen zu wollen, ließ der Französische Minister Grammont durch den französischen Gesandten Benedetti den König in Ems in zudringlicher Weise attackieren, er solle als Chef des Hauses Hohenzollern den Prinzen zur Verzichtleistung auf den spanischen Thron auffordern. Der Prinz aber leistete diese Verzichtleistung ohne Aufforderung freiwillig, um kriegerische Verwickelungen [317] zu vermeiden, und damit schien der Fall erledigt. Das genügte aber den französischen Machthabern nicht, sie verlangten vom König selbst die Bürgschaft dafür, daß der Prinz auch in Zukunft keine Thronkandidatur annehme, daß er ihm auch ebenso wie jedem anderen Prinzen seines Hauses die Annahme irgend einer Thronkandidatur verbiete.
Wenn dieses anmaßende und erniedrigende Ansinnen an den König gelungen wäre, konnte man sich in Paris damit brüsten, das verlorene nationale Prestige wieder gewonnen zu haben. Aber gottlob kam es anders, unser edler König wies mit Entrüstung ein solches Ansinnen der französischen Regierung zurück. An der historisch denkwürdigen Stelle, die durch eine Steinplatte auf der Brunnenpromenade in Ems gekennzeichnet ist, erklärte der Monarch am 13. Juli dem mit seiner Forderung immer lästiger werdenden Benedetti ein für allemal, daß er ihm nichts mehr zu sagen habe, und damit waren die diplomatischen Beziehungen zu Frankreich abgebrochen.
Jetzt hatten die Franzosen das erreicht, was sie beabsichtigten, sie wollten mit der brüsken Herausforderung des Königs lediglich den Krieg gegen Preußen provozieren.
Νapoleon mit samt seiner Sippe durfte sich diese Gelegenheit nicht entgehen lassen – die Kriegserklärung erfolgte sofort!
Am 15. Juli in der Mittagsstunde traf Seine Majestät, von Ems kommend, auf dem hiesigen Bahnhof zu kurzem Aufenthalt ein, wo eine große Menschenmenge, darunter auch ich, sich angesammelt hatte, die den König mit ungeheurem Jubel empfing. Der Salonwagen des Königs war mit den kostbarsten Buketts angefüllt. Die Begeisterung erreichte ihren Höhepunkt, als der König den Wagen verließ und den Oberpräsidenten v. Möller, die Generalität und den Oberbürgermeister Nebelthau begrüßte, der dem König eine Adresse des Stadtrats überreichte, die er vorher verlas. Nur mit der größten Mühe konnte die nötige Ruhe geschafft werden, daß [318] die Verlesung verstanden wurde. Der König erwiderte bewegt, daß die kundgegebene patriotische Gesinnung einer seiner neuesten Provinzen seinem Herzen besonders wohl tue, was ihm beweise, daß er sich, wenn es sein müsse, fest auf sie verlassen könne. Nach halbstündigem Aufenthalt, während dessen im Fürstensalon Tafel gehalten wurde, bestieg der König, über Blumen schreitend, die von mehreren Damen auf den Weg gestreut waren, seinen Wagen wieder. Die Abfahrt erfolgte, nachdem Seine Majestät sich auf das herzlichste und tief ergriffen verabschiedet hatte, unter fortwährendem begeisterten Hochrufen, das erst verstummte, als der langsam ausfahrende Zug außer Sicht war.
Am 16. Juli wurden im Casseler Tageblatt die folgenden zwei Nachrichten veröffentlicht:
1. Cassel,
den 16. Juli, morgens 1 Uhr.
An
die Königliche Polizei-Direktion, hier.
Frankreich hat uns den Krieg erklärt, die schleunigste Mobilmachung des gesamten Norddeutschen Heeres ist von Sr. Majestät dem König befohlen.
Der Oberpräsident
v. Möller.
2. Planmäßige Mobilmachung der Norddeutschen Bundesarmee unter dem 16. dieses von Sr. Majestät befohlen. Der 16. ist erster Mobilmachungstag.
Der kommandierende General
v. Plonski.
Nun wurde es zur Wahrheit, was man längst voraussah, Frankreich, unser alter Erbfeind, wagte im Übermut den Waffengang mit Preußen; mit diesem glaubte es fertig zu werden, mit Hilfe seiner Chassepots und seiner Mitrailleusen. Daneben rechnete es noch immer mit der Uneinigkeit unter den deutschen Staaten, aber es hatte die Rechnung ohne den Wirt [319] gemacht. Die frivole Kriegserklärung Frankreichs an Preußen führte wie mit elementarer Gewalt die einmütige Erhebung des gesamten deutschen Volkes herbei. Nicht nur der Norddeutsche Bund folgte dem Rufe seines Oberfeldherrn, des Königs Wilhelm, auch die süddeutschen Staaten jenseits der Mainlinie schlossen sich an, um gegen den Erbfeind unter dem König von Preußen ins Feld zu ziehen. Alle Welt wurde jetzt überrascht durch die bereits vorher abgeschlossenen Verträge mit den Südstaaten, für den Fall eines Krieges mit Frankreich – eine weise Staatsaktion unseres vorausschauenden großen Bismarck – die bis dahin geheim gehalten war.
Der König übertrug den Oberbefehl über die süddeutschen Truppen seinem Sohne, dem Kronprinzen, der sofort abreiste und mit größtem Enthusiasmus vertrauensvoll von unseren süddeutschen Landsleuten empfangen wurde.
Wie durch Sturmwind wurde das nationale Bewußtsein überall im deutschen Lande angefacht, es herrschte eine patriotische Begeisterung, so gewaltig, wie niemals zuvor, die in Ton und Schrift, in Lied und Rede immer von neuem angeregt wurde; die »Wacht am Rhein«, ein Lied, das sonst nur in Gesangvereinen gesungen wurde, würde zum zündenden Schlachtgesang der Deutschen.
Die Mobilmachung der deutschen Armee vollzog sich mit einer erstaunlich musterhaften Präzision wie in Friedenszeiten, ohne irgendwelche Überstürzung. Alle Reservisten und Landwehrleute hatten sich sofort bei den Bezirkskommandos zu stellen. Die Pferdebesitzer wurden aufgefordert, am dritten Modilmachungstage ihre sämtlichen Pferde zur Ausmusterung zu stellen. Hier in Cassel war diese auf dem Platze neben der Kriegsschule. Von meinen sechs Pferden wurden meine zwei besten Pferde für tauglich befunden und nach einer Taxe der Kommission bezahlt.
Am 19. Juli. wurde der Reichstag des Norddeutschen Bundes zu einer außerordentlichen Session einberufen, die der König mit einer tiefernsten Thronrede eröffnete. Der Reichstag [320] beschloß einmütig die Bewilligung des zur Kriegführung erforderlichen Kredits sowie eine Vertrauensadresse an den König. Damit war die Aufgabe des Reichstages gelöst. Graf Bismarck schloß die kurze, denkwürdige Session mit dem Ausdruck herzlichsten Dankes von Seiten des Königs für die Schnelligkeit und Einmütigkeit, womit der Reichstag den Bedürfnissen der Nation Rechnung getragen habe.
Nunmehr konnte das Werk der Waffen seinen Lauf nehmen; zum ersten Male in der neuen Geschichte der Deutschen stand ganz Deutschland unter dem einzigen Willen eines erprobten Oberfeldherrn, des sieggewohnten Königs von Preußen, dem seine kriegserfahrenen Generäle, an der Spitze einer der genialsten Stategen aller Zeiten, sein Generalstabschef von Moltke, zur Seite standen. Unter solcher Führung konnte Deutschland den ihm schnöde aufgedrungenen Kampf mit Vertrauen und Zuversicht aufnehmen und einen glücklichen Ausgang erhoffen.
»Gott mit uns« war die Devise im eisernen Kreuz, das der König Wilhelm angesichts der ernsten Lage des Vaterlandes »in dankbarer Erinnerung an die Heldentaten unserer Vorfahren in den großen Jahren der Befreiungskriege« von neuem wieder stiftete.
Und »Gott war mit uns«!
Mit Gottvertrauen zogen unsere Truppen nach Frankreich hinein, von Sieg zu Sieg unaufhaltsam vordringend, bis sie den Erbfeind völlig niedergeworfen hatten – es war ein blutiger Krieg, der seinesgleichen in der Weltgeschichte nicht hat, der ausgefochten werden mußte, der aber gottlob ein für Deutschland glorreiches Ende nahm.
[13.2 Kassel während des Krieges]
Wie es nun während dieses Krieges hier in Cassel aussah, was ich persönlich in dieser Zeit erlebte, darüber will ich jetzt einiges berichten.
Die Ausstellung war in vollem Gange, es herrschte in allen Geschäften ein reger Betrieb, besonders im Baugeschäft. Auch ich hatte tüchtig zu tun, u.a. führte ich in Schaubs [321] Garten, dem damals vornehmsten Konzertgarten, die neuen großen Hallen und den Musikpavillon aus, ferner mehrere größere Neubauten, darunter das große Eckhaus an der Bahnhofstraße für meinen Onkel August Engelhardt.
Der plötzliche Ausbruch des Krieges ließ befürchten, daß die Geschäfte stocken oder wenigstens sehr dadurch leiden würden. Die Reichsbank beschränkte sofort ihre Kredite und erhöhte den Zinsfuß, ebenso die größeren Bankgeschäfte. Der Kreditverein allein verhielt sich abwartend und behielt den seitherigen Zinsfuß annähernd bei; diesem Umstand hatte ich es als junger Geschäftsmann zu danken, daß mir der Krieg keinen Nachteil brachte; im Gegenteil, er verhalf mir gewissermaßen zu einem guten Geschäft, das ich durch die billige Erwerbung des an meinen Garten anstoßenden Nachbargrundstückes machte, welches mit dem meinigen gleiche Größe hatte. Die Besitzerinnen, die ich schon im vorigen Kapitel erwähnte, hatten nämlich in ihrer Jugend die französischen Zeiten erlebt; sie waren nach der Kriegserklärung der festen Überzeugung, daß auch diesmal die Franzosen wieder ins Land kommen würden, und boten mir ihren Garten wieder an. Die Angst vor den Franzosen verhalf mir dazu, daß ich diesen Garten zur Hälfte des Preises bekam, den mir die Damen früher abgefordert hatten.
[13.3 Mobilmachung]
Inzwischen hatte die Mobilmachung der Truppen ihren regelrechten Verlauf genommen. Vor dem Ausmarsch der selben, am 27. Juli, fand ein außerordentlicher allgemeiner Bettag statt, den der König durch einen allerhöchsten Erlaß angeordnet hatte, in dem er, demütig sich vor dem Lenker der Schlachten beugend, das Volk aufforderte, den Segen und Beistand Gottes in diesem schweren Kampfe zu erflehen und zu beten, daß er der gerechten Sache zum Siege verhelfe.
Wohl noch nie ist ein Bettag mit inbrünstigerem Gebet abgehalten worden, als der damalige, wo so viele in Angst und Sorge um ihre Lieben beteten, die mit ins Feld ziehen mußten, und von denen leider tausend und abertausend ihr Leben lassen [322] mußten oder schwer verwundet die Wahlstatt in fremdem Lande mit ihrem Blute tränkten.
Am zehnten Tage nach Erlaß der Mobilmachungsorder war die kriegsmarschmäßige Ausrüstung unserer Truppen so weit vollendet, daß der Auszug aus unserer Stadt erfolgen konnte. Die Truppen wurden sämtlich mit der Bahn befördert, in langen Zügen, die alle nach dem Süden dirigiert wurden. Das 11. Armeekorps sollte mit den süddeutschen Truppen zusammentreffen und gemeinschaftlich mit diesen unter dem Oberbefehl des Kronprinzen von Preußen ins Feld ziehen. Die Eisenbahnverwaltung hatte eine wahre Riesenarbeit zu bewältigen; den Betrieb auf dem Bahnhof muß man mit angesehen haben, um sich einen Begriff davon machen zu können.
Neben den Zügen, in welche unsere Truppen, die stundenlang in heißer Sonnenglut in voller Ausrüstung am Bahnhof stehen mußten, verladen wurden, kamen fortwährend endlose Züge an, die nach kurzem Aufenthalt weiterfuhren.
Um den Truppen während ihres Aufenthaltes auf dem hiesigen Bahnhof einen Liebesdienst zu erweisen, hatte sich ein Komitee gebildet, das in besonders zu diesem Zwecke errichteten Buden Speise und Trank sowie Zigarren usw. verabreichte, Gaben, die sowohl von den städtischen Behörden, wie infolge Aufrufs aus allen Kreisen der Bürgerschaft opferfreudig gestiftet wurden. Ich war diesem Komitee beigetreten und hatte mit mehreren Herren und Damen den Dienst in einer dieser Buden übernommen.
Wir waren, so lange die Truppenzüge unseren Bahnhof passierten, Tag und Nacht in unserer Bude tätig und lösten uns abteilungsweise gegenseitig ab; wir verteilten in unserer Bude Brot, Wurst, Frikadellen, Braten, Käse usw. Es waren mehrere Brotschneidemaschinen und Tranchiermesser fast ununterbrochen im Gange, um die Gaben zu teilen und auf einer langen Tafel aufzuspeichern, die bei Ankunft eines Zuges von den hungrigen Truppen bald wieder vertilgt waren.
Es war keine geringe Arbeit, die wir zu bewältigen hatten, es gab alle Hände voll zu tun; ich hatte einige meiner Lehrlinge [323] mit herangezogen, die dafür sorgen mußten, daß stets frische Ware zur Hand war. Meine Frau beteiligte sich ebenfalls kräftig an unserem Liebeswerk, sie backte zu Hause »als zu« Frikadellen, und es gab allemal ein Halloh in unserer Bude, wenn ein Junge mit einem Handkorb voll frischer Frikadellen ankam. Meiner Frau wurde dafür der von uns gestiftete »Brotorden« verliehen in dankbarer Anerkennung für ihre Leistungen; er bestand in einer Scheibe Brot, dem so genannten »Kniestchen«, das an einem bunten Bande befestigt war. Es fehlte uns überhaupt nicht an wechselnder Unterhaltung während dieser Tage, wir erfreuten uns an dem frischen, fröhlichen Treiben und Scherzen der Truppen während ihres Aufenthaltes. Es herrschte zumeist eine heitere Stimmung unter den Kriegern, als ging es zu einem frohen Feste, eine Stimmung, die in einem seltsamen Kontrast stand zu dem Ernst der Lage, in der sie sich befanden. Manche trugen einen wahren Galgenhumor zur Schau, sie übten allerhand komische Streiche aus, die Lachsalven hervorriefen. Karikaturen von Napoleon waren mehrfach mit Kreide an den Außenwänden der Wagen angemalt, ebenso parodistische Spottverse in drolligen Reimen auf den »Chassepot« u.a. Die »Wacht am Rhein« oder »Ich bin ein Preuße, kennt ihr meine Farben« erschallte bei jedesmaliger, unter Hochrufen erfolgenden Abfahrt eines Zuges.
Uns beschlich jedesmal ein schmerzhaft wehmütiges Gefühl, wenn sie hinwegzogen, die kräftigen, gesunden Menschenkinder, fort in Tod und Verderben. Wie viele von denen, die voller Übermut in blühender Lebensfrische an uns vorbeizogen, lagen wenige Wochen darauf kalt und stumm, mit gebrochenem Auge, hingestreckt durch ein feindliches Geschoß auf blutigem Schlachtfeld oder waren schon bestattet in Feindesland, fern von den geliebten Angehörigen – wie viele wanden sich unter unsäglichen Schmerzen, leidend an schweren Wunden, und kehrten als Krüppel zurück – welche schweren Strapazen, Schrecknisse und Entbehrungen standen denen bevor, die mit dem Leben davonkamen! – – –
[324] Mit solchen tiefernsten Gedanken kehrte ich am Abend vom Bahnhof heim. In ähnliche Gedanken versunken, wie es mir schien, fand ich einen mir befreundeten Herrn, der einsam im Dunkeln auf der Laufpritsche vor dem Güterschuppen saß und mir im Vorbeigehen ein Lebewohl zurief; es war der Oberpostsekretär Bode, der »hinkende« Bode genannt, weil er ein kurzes Bein hatte, der sich von seinen Angehörigen und Freunden getrennt hatte und auf den abgehenden Zug warten mußte, um den Truppen zu folgen. Ich begrüßte ihn und unterhielt mich in der dunklen Nacht einige Zeit mit ihm; es wurde ihm nicht leicht, sich von Cassel zu trennen, er ging mit Besorgnis einem schweren Dienst entgegen, der Einrichtung der Feldpost für das 11. Armeekorps.
Dank der musterhaften, für den Kriegsfall im voraus schon bis ins Detail durch unseren bewährten Generalstab festgelegten Organisation im Transportwesen war binnen wenigen Tagen eine starke deutsche Truppenmacht an der Grenze aufmarschiert, um den Franzosen den »Spaziergang nach Berlin«, wie sie sich großprahlerisch ausdrückten, gründlich zu verlegen.
Es zeigte sich gar bald, wie die Armee Frankreichs, die nach Aussage des französischen Kriegsministers Leboeuf »bis auf den letzten Gamaschenknopf« fertig gerüstet sein sollte, sich von Schlacht zu Schlacht trotz ihrer Chassepots und Mitmailleusen vor der siegreichen deutschen Armee immer mehr rückwärts konzentrieren mußte, und wie das Kaiserreich, das in diesem Kriege ein Va banque spielte, durch die schließliche Gefangennahme des Kaisers mit samt seiner glorreichen Armee jämmerlich zusammenbrach.
Am 31. Juli begab sich der König Wilhelm zur Armee; sein Abschied von seiner Haupt- und Residenzstadt war sehr ergreifend und gestaltete sich zu einer gewaltigen spontanen Kundgebung der Berliner Bevölkerung, die ihrem König bewegten Herzens ein Lebewohl zurief.
[13.4 Neuigkeiten, Gefangene und Verwundete treffen in Kassel ein]
Hier klicken (→) für eine Reproduktion einer Zeichnung von Johann Bernhard Lang: »Ankunft der ersten Gefangenen in Cassel – August 1870«. (Universitäts-Bibliothek Kassel)
Erwartungsvoll und gespannt sahen wir in Cassel nunmehr den Nachrichten über die nächsten Ereignisse vom Kriegsschauplatz [325] entgegen. Jeden Morgen kamen wir, Freunde und Verwandte, zum Frühschoppen in Schaubs Garten zusammen, um neues zu hören oder mitzuteilen. Von seiten des Telegraphenamts, das sich in der ersten Etage des jetzigen Reuseschen Hauses am Königsplatz befand, wurden alle für die Öffentlichkeit bestimmten Nachrichten auf mit Blauschrift beschriebenen Telegrammformularen außen am Tore des Hauses angeschlagen, das natürlich stets von einer großen Menschenmenge umlagert war. Wenn ein Telegramm angeschlagen wurde, mußte es von einem der Nächststehenden mit lauter Stimme verlesen werden, so daß es die Umstehenden sogleich vernehmen und die Nachrichten nach allen Himmelsgegenden in der Stadt sofort kolportieren konnten.
Am 4. August traf die Depesche ein, die ein Gefecht bei Saarbrücken meldete, bei dem die Franzosen in Gegenwart ihres Kaisers, der den Oberbefehl übernommen hatte, und seines Sohnes Lullu die offene Stadt bombardierten und ihre ganze in der Nähe liegende Macht entfalteten gegen einige preußische Kompagnien. Die Franzosen beschränkten sich auf ihr Geschützfeuer, bei dem der kaiserliche Prinz, wie der glückliche Vater nach Paris berichtete, die Feuertaufe erhielt, indem er eine Kanone selbst abschoß oder wenigstens in der Nähe einer solchen stand; das war eine Heldentat, über die ganz Frankreich jubelte. – – –
Aber gewaltig war der Eindruck des Telegramms am folgenden Tage, das uns die Nachricht von dem glänzenden aber blutigen Siege der kronprinzlichen Armee bei Weißenburg brachte. Als die Nachricht hier eintraf, brach ein allgemeiner enthusiastischer Jubel aus, man umarmte sich in freudiger Erregung, patriotische Lieder ertönten in den Straßen, Hochrufe erfüllten die Luft und gewiß stieg auch manches Dankgebet für diesen ersten Sieg der deutschen Waffen himmelwärts. Aber auch manche Fürbitte zu Gott von denen deren Angehörige in dieser Schlacht mitgekämpft hatten, denn unser 11. Korps war besonders stark engagiert gewesen bei [326] der Erstürmung des Geisberges, wie es im Telegramm des Kronprinzen lautete.
Am Abend wurde in der Ausstellung eine große patriotische Feier veranstaltet, nach der die Menge mit der Mansfeldschen Kapelle an der Spitze vor die Wohnungen des Oberpräsidenten v. Möller, des Gouverneurs Grafen v. Monts u.a. zog und dort unter Absingen von patriotischen Liedern Hochs auf den König, aus den Kronprinzen und die tapfere Armee ausbrachte.
Am Abend des darauffolgenden Tages traf schon der Militärzug mit den gefangenen Franzosen hier ein, die längeren Aufenthalt hier nehmen mußten, um sich hier zu erfrischen. Seitlich neben dem Bahnhof war ein langes Zelt errichtet mit einer Baracke, die zur Küche diente. Ich hatte dort die gemauerten Herdfeuerungen im Auftrage der Kriegsbauverwaltung sofort nach der Mobilmachungsorder herzustellen. Aus dieser Küche wurden den in das Zelt geführten gefangenen Mannschaften die Rationen zugeteilt. Ich war bei Ankunft der Gefangenen zugegen. Voraus gingen 18 Offiziere, die eine ernste geschlossene Gruppe bildeten, einige schienen verwundet zu sein. In gedrückter Stimmung vor sich hinblickend, gingen sie durch das eine Gasse bildende Publikum, das sie achtungsvoll begrüßte, hindurch; sie blieben im Wartesaal zweiter Klasse, wo sie speisten. Dann folgten in langem Zuge die französischen Soldaten, welche die Sache leichter zu nehmen schienen, denn sie lachten und schwatzten miteinander und rauchten zum Teil kurze Pfeifen. Auffallend waren die vielen kleinen, schmächtigen Gestalten, die in ihrer schlappen Haltung einen nichts weniger wie militärischen Eindruck machten. Auch in ihren Uniformen sahen sie sehr abgerissen aus, bei denen uns zum ersten Male die roten Hosen besonders ins Auge stachen. Auch eine Anzahl Turkos war darunter, von welchen uns vorher schon graulen gemacht wurde. Ich offerierte einem solchen Afrikaner eine meiner Zigarren, die er sich sofort, seine weißen Zähne zeigend und [327] seine schwarze Visage grinsend verziehend, in den Mund steckte. Nach mehrstündigem Aufenthalt fuhr die Truppe über Berlin weiter nach Stettin, wo sie interniert wurde. Nichts konnte uns einen schlagenderen Beweis liefern von den Erfolgen, die wir in dieser ersten Schlacht errungen hatten, als die Zuführung dieser Gefangenen am zweiten Tage nach der Schlacht; durch sie wurden die gemachten Angaben vollauf bestätigt.
Kaum hatte sich die Erregung über diesen ersten Sieg gelegt, da erschien bereits am 7. August eine weitere Nachricht über eine zweite siegreiche Schlacht – die Schlacht bei Wörth, die an Bedeutung und Größe des Erfolges die erste Schlacht noch bei weitem übertraf. Die Armee Mac Mahons war in dieser Schlacht vom Kronprinzen vollständig aufs Haupt geschlagen, Mac Mahon selbst war verwundet, und sein Heer in voller Auflösung in die Flucht geschlagen.
Auch ein weiterer Sieg wurde vom selben Tage gemeldet von der Schlacht bei den Spicherer Höhen. In beiden blutigen Schlachten waren auf beiden Seiten leider enorme Verluste an Toten und Verwundeten, namentlich an Offizieren, zu beklagen. Der Sieg aber hatte den deutschen Waffen viele Tausende Gefangene, eine große Anzahl Geschütze und Feldzeichen eingebracht. Der König hatte in seinem Telegramm an die Königin Augusta, Gott für seine Gnade preisend, angeordnet, daß Viktoria geschossen wurde; auch hier in Cassel geschah dies von der Reservebatterie, die zurückgeblieben war.
An diesem Tage trafen mit der Bahn schon die ersten Verwundeten hier ein; es waren wohl mehr wie hundert Mann, Deutsche und Franzosen, welche, nachdem sie auf dem Bahnhof neu verbunden waren, mit Möbelwagen und Droschken in die Kriegsschule gebracht wurden, die zum Lazarett eingerichtet war.
Zur Pflege der verwundeten und erkrankten Krieger hatte sich mit dem Oberpräsidenten an der Spitze ein Provinzialverein gebildet, der in Gemeinschaft mit dem Vaterländischen [328] ländischen Frauenverein mit hilfreicher Unterstützung in den Lazaretten tätig war und die Beschaffung von Verbandzeug übernahm. Die Casseler Turngemeinden erklärten sich bereit, beim Transport der Verwundeten die Krankenträgerdienste zu übernehmen. Ein Verein zur Unterstützung hilfsbedürftiger Familien trat ins Leben u.a. Auf diese und ähnliche Weise äußerte sich die werktätige Liebe in der Heimat und stellte sich bereitwillig in den Dienst fürs Vaterland.
Bald wurden auch die Verluste bekannt aus den Reihen unserer hessischen Regimenter, darunter waren schon einige Casseler Kinder. Eine lange Reihe von Namen gefallener und verwundeter Offiziere wurde in den Zeitungen veröffentlicht, darunter waren mehrere allgemein bekannte und beliebte Persönlichkeiten. Der kommandierende General v. Bose, der das 11. Korps nach der Verabschiedung v. Plonskis ins Feld führte, wurde zweimal verwundet und mußte das Kommando an General v. Gersdorff abtreten.
[13.5 Frankreich vor der Niederlage]
Nach diesen gewaltigen Niederlagen der französischen Armee stockten die Nachrichten vom Kriegsschauplatz auf einige Tage. Man hörte nur, daß unsere deutschen Armeen den zersprengten, nach dem Innern auf die Festung Metz sich zurückziehenden französischen Korps, die vor Metz sich wieder sammeln wollten, dicht auf den Fersen waren. Aus Frankreich kamen interessante Berichte auf dem Wege über England in die deutsche Presse. Den Parisern wurde alles Mögliche von oben herab vorgeschwindelt von großen Siegen ihrer Armee; etwas anderes konnte man ja auch nicht erwarten, denn dem »Elan« der französischen Truppen konnte, was sich die Franzosen einbildeten, nichts widerstehen.
Das betörte Volk wurde darob in einen wahren Freudentaumel versetzt, der sich steigerte bis zu dem Augenblick, wo die nackte Wirklichkeit von den schweren Niederlagen nicht mehr verschwiegen werden konnte.
Jetzt trat ein jäher Umschlag ein; ganz Paris wurde in die größte Bestürzung versetzt. Die Aufregung und Verwirrung [329] besonders in den Regierungskreisen war grenzenlos, der Regierung drang der Angstschweiß aus allen Poren. Die Wut des Volkes gegen den Kaiser und seine Minister steigerte sich bei jeder weiteren Nachricht über die Niederlage, die nun nicht mehr zu verschleiern war. Die Kammern wurden einberufen und der Belagerungszustand über Paris verhängt, weil man eine allgemeine Volkserhebung befürchtete; der Ruf »Vive la republique« wurde schon laut.
Die Kaiserin, nach der Abreise des Kaisers zur Regentin eingesetzt, erließ eine lächerliche Proklamation, in der sie – eine neue Jungfrau von Orleans – anzeigte, daß sie in den ersten Reihen kämpfen werde. Im gesetzgebenden Körper ging es stürmisch zu; es wurde gefordert, daß der Kaiser das Oberkommando niederlege, ja sogar seine Abdankung wurde verlangt. Das Ministerium Olivier mußte demissionieren, der Graf von Palikao, eine Kreatur des Kaisers, bildete ein neues Ministerium. Die Bewaffnung der Nationalgarde wurde beschlossen, die französische Besetzung in Rom, womit Napoleon den Papst seither unterstützt hatte, holte man zurück und räumte den Kirchenstaat; mit diesem Ersatz glaubte man der geschwächten Armee wieder auf die Beine zu helfen und dem Vordringen der deutschen Armeen zu begegnen.
Aber unsere schneidigen Heerführer ließen den Franzmännern keine Zeit; wie in einem Kesseltreiben wurden die französischen Korps von den deutschen nach und nach umstellt – eine Taktik unseres genialen Moltke, mit der er in diesem Kriege Schule machte. Auf drei Heerstraßen verfolgten sie die Franzosen, die immer enger eingekreist wurden, immer mehr schloß sich der Ring um sie, bis sie schließlich nicht mehr heraus konnten – sie saßen in der Falle!
In dreitägigen Schlachten, am 14., 16. und 18. August, mit der blutigsten Schlacht im ganzen Kriege, der von Gravelotte am letzten Tage, war es gelungen, den überwiegend größten Teil der französischen Armee in Metz einzuschließen und ihr die Rückzugslinie nach Paris abzuschneiden. Dem [330] Kaiser Napoleon und seinem Sohne Lullu, die sich nach der Schlacht bei Spichern nach Metz zu der noch intakten Armee des Marschalls Bazaine begeben hatten, worauf Frankreich seine letzte Hoffnung setzte, gelang es, noch vor der völligen Einschließung aus Metz heraus zu kommen.
[13.6 Die Stimmung in Kassel]
Die Telegramme, die uns diese weiteren großartigen Erfolge der deutschen Waffen verkündeten, wurden allemal mit großem Jubel begrüßt. Jeder Sieg gab uns die Veranlassung zu einer besonderen Feier, die wir jedesmal in gehobener Stimmung im Freundeskreise vereint abhielten, zumeist in der vorzüglichen Ausstellungs-Restauration bei Behlendorf, der natürlich durch diese Umstände ein feines Geschäft machte. Was ich damals für Taschengeld verbrauchte – na, ich will’s lieber verschweigen. – – –
Der Verlauf der Ausstellung war denn auch infolge der immer glücklich lautenden Nachrichten vom Kriegsschauplatze ein so befriedigender, daß beschlossen wurde, den Endtermin um einen Monat, bis zum 10. Oktober, zu verschieben, was allseitig mit Freuden begrüßt wurde.
Das Ausstellungskomitee war aber auch bemüht, immer etwas Neues zu bringen, besondere Konzerte, Illuminationen, Feuerwerk usw. Um das Publikum mit der so sehr gefürchteten Mitrailleuse bekannt zu machen, richtete der Ausstellungsvorstand die Bitte nach Berlin, und zwar direkt an Bismarck, um Überlassung einer der eroberten Mitrailleusen. Diese Bitte wurde dann auch umgehend von Bismarck durch telegraphische Nachricht erfüllt. Das gefährliche Mordinstrument traf bald darauf ein und wurde in einem abgesonderten Raum gegen ein Eintrittsgeld von 5 Silbergroschen gezeigt; die Ausstellung machte mit dieser Sehenswürdigkeit ein recht gutes Geschäft, allerdings wurde sich vielfach – und das mit Recht – darüber aufgehalten.
Seit den letzten Berichten über die Schlachten vor Metz waren nur wenige Telegramme vom Kriegsschauplatz eingetroffen. Es verlautete nichts Genaues über die Bewegungen [331] unserer Heere in Feindesland, nur die Vermutung hegte man, daß die Armee auf Paris losmarschiere. Erst gegen Ende August kamen wieder Nachrichten über stattgehabte siegreiche Gefechte, woraus man schließen konnte, daß unsere Truppen wieder Fühlung mit dem Feinde gewonnen hatten; man ahnte, daß es bald wieder zu einem ernsten Zusammenstoß kommen müsse, das Telegraphenamt war immer belagert von Menschen, die gespannt auf Nachrichten warteten.
[13.7 Siegesnachricht, Reaktionen in Kassel]
Auch ich war am 3. September früh morgens schon am Platze, um neues zu erfahren, und hatte mich in der Nähe des Eingangs zum Telegraphenamt postiert, um aus erster Hand genaueres zu erfahren – es gingen schon allerlei Gerüchte um, daß etwas besonderes passiert sei. Da trat plötzlich ein Telegraphenbeamter heraus, der in lebhafter Erregung das an dem Torflügel anzuheftende Telegramm hoch in der Luft hielt. Die herandrängende Menge verlangte stürmisch die Verlesung des Telegramms, die durch den Beamten nach sofort eingetretener Ruhe geschah. Mit lauter Stimme verlas er das Telegramm, das König Wilhelm an die Königin Augusta in Berlin von Sedan um 1 Uhr 30 Minuten nachmittags abgeschickt hatte, es lautete:
»Die Kapitulation, wodurch die ganze Armee in Sedan kriegsgefangen, ist soeben mit dem General Wimpffen abgeschlossen, der an Stelle des verwundeten Marschalls Mac Mahon das Kommando führte. Der Kaiser hat sich nur mir selbst ergeben, da er das Kommando nicht geführt und alles der Regentschaft in Paris überläßt. Seinen Aufenthaltsort werde ich bestimmen, nachdem ich ihn gesprochen habe in einem Rendezvous, das sofort stattfindet. Welch eine Wendung durch Gottes Fügung. Wilhelm.«
[332] Nach dieser Verlesung erschallte ein Jubelgeschrei über den Königsplatz, das sich in Worten nicht schildern läßt – der Enthusiasmus war unbeschreiblich, man umarmte sich gegenseitig, ohne sich näher zu kennen, Tränen der Freude flossen überall, ununterbrochen erschallten Hochrufe und patriotische Lieder. Ich ging, ehe ich nach Hause eilte, um meiner Frau die Siegesbotschaft zu berichten, bei meinem Elternhause vorbei und klopfte meinem Vater an’s Fenster, welcher öffnete und nach dem Spektakel fragte, der vom Königsplatz bis hinter die Mauer erschallte. Ich teilte ihm freudig erregt die soeben eingetroffene Nachricht mit, auf die er förmlich unwillig, in seiner etwas kurzen Art, erwiderte, das könnte doch gar nicht möglich sein, es wäre eine alberne Übertreibung, eine ganze Armee gefangen zu haben; er glaube so etwas nicht – es schien in der Tat auch kaum glaubhaft, denn so etwas hatte die Welt bis jetzt noch nie erlebt! In überraschend kurzer Zeit hatte sich wie ein Lauffeuer die Freudenbotschaft durch die ganze Stadt verbreitet; die sämtlichen Schulen wurden sofort geschlossen, in wenig Augenblicken prangte die Stadt im reichsten Fahnenschmuck.
Durch Maueranschlag an den Straßenecken forderte der Magistrat schon vormittags um 11 Uhr die Bürgerschaft zur allseitigen Beteiligung am Festzug für den Nachmittag und Fackelzug am Abend auf. Um 3 Uhr setzte sich, vom Martinsplatz ausgehend, ein riesiger Festzug, bestehend aus den verschiedensten Korporationen, Schulen, Männern aller Stände und Berufe, mit Fahnen und Insignien, unter dem Geläute sämtlicher Glocken, den Klängen der Musik und dem Donner der salutschießenden Kanonen, in Bewegung und machte die Runde durch die Stadt, zum Oberpräsidialgebäude, von dessen Balkon der Oberpräsident eine zündende Rede hielt. Die Feuerwehr, der ich in der sogenannten Werkmeisterkompagnie angehörte, mußte gegen Abend in voller Uniform antreten zu einem großartigen Fackelzug, dem sich die gesamte Turnerschaft und viele Bürger anschlossen. Es gewährte einen großartigen, [333] mir unvergeßlichen Anblick, den imposanten Zug die Serpentine herauf, durch’s Auetor um den Friedrichsplatz herum zum Bellevueschloß ziehen zu sehen, wo dem General v. Plonski eine Ovation gebracht wurde, der sich eine weitere vor dem Oberpräsidium anschloß. Unter Absingen der »Wacht am Rhein« zog der Fackelzug über den Friedrichsplatz, auf dessen unterer Seite die Fackeln auf einen Haufen zu einem lodernden Siegesfeuer zusammengeworfen wurden. Abends war die Stadt glänzend illuminiert; im Hoftheater fand eine Festvorstellung statt, welche wir Feuerwehrleute, so wie wir waren, in unseren vom Fackelqualm verräucherten weißen Uniformen, schwarz und verrußt im Gesicht, ohne Eintritt zu zahlen, besuchten. Darauf machte ich mit meinen Freunden einen fidelen Abschluß in der Weinstube bei Göllner am Friedrichsplatz, wo den hochwogenden patriotischen Gefühlen durch einen guten Trunk trefflichen Weines noch kräftig nachgeholfen wurde. Damit endete dieser Tag, welcher dem glorreichsten, den die Geschichte Deutschlands jemals erlebt hat, folgte.
Am folgenden Mittag fand in der Ausstellungs-Restauration ein großes Festbankett statt, womit wir bei ausgezeichnetem Mahle und köstlichem Trank, im Verein mit unseren Damen in festlichem Gewande, den Tag von Sedan feierten. Es herrschte eine selten frohbewegte und gehobene Stimmung; wes das Herz voll war, des ging der Mund über; eine Rede folgte der andern, ein solch jubelndes Fest war bis jetzt in den Räumen der Ausstellung noch nicht abgehalten.
Nach dem Festbankett hatten wir Freunde, Seidler, Lauckhardt, Hochapfel und ich, mit unseren Frauen einen Ausflug in eigenen Wagen – ich war auch seit einiger Zeit im Besitz einer Equipage – nach Wilhelmshöhe verabredet, um bei Schombardt den Kaffee einzunehmen. Wir waren dort die einzigen Gäste in der Restauration und unterhielten uns über die Tagesereignisse beim gemütlichen Nachmittagskaffee. Da hörten wir durch die geöffneten Fenster einen [334] Reiter über den breiten, gepflasterten Platz vor dem Hotel – Anlagen waren damals hier noch nicht vorhanden – heransprengen und sahen einen Husaren-Offizier absitzen, der, wie wir nachher erfuhren, beauftragt war, einer Prinzeß von Preußen (Elisabeth?), die im Grand-Hotel wohnte, das neueste offizielle Telegramm mitzuteilen. Unsere Kutscher mußten wohl etwas vom Wortlaut desselben vernommen haben, denn gleich darauf rief einer derselben durch’s offene Fenster uns laut zu: »D’r Napolium kimmet noh Willemsheh!«
[13.8 Napoleon III kommt nach Wilhelmshöhe]
Auf’s höchste überrascht, sprangen wir sofort auf und erkundigten uns selbst bei dem uns bekannten Offizier – es war Arthur v. Griesheim –, der uns das kurz vorher erschienene Telegramm des Königs verlas, womit er der Königin seine Begegnung mit Napoleon anzeigte, sowie daß er ihm Wilhelmshöhe bei Cassel zu seinem Aufenthalt bestimmt habe. Es war wirklich ein eigenes Zusammentreffen – kaum hatten wir unter uns in unserer Unterhaltung den Wunsch ausgesprochen, daß es nett vom König wäre, wenn er Napoleon zu uns nach Cassel schickte – und ganz unerwartet ging derselbe schon in Erfüllung. Wir waren darüber, in der Überzeugung, daß Cassel gut dabei fahre, in die freudigste Stimmung versetzt, die uns dazu animierte, einigen Flaschen echten Champagners die Hälse zu brechen. Bei der ausgelassenen Fröhlichkeit goß Freund Seidler meiner Frau ein Glas Champagner über ihr neues seidenes Kleid – doch das machte nichts – wir waren ja so vergnügt – sie sollte ein neues haben – es kam uns gar nicht darauf an. – »Kellner, noch ’ne Flasche« – es ist doch famos »d’r Napolium kimmet noh Willemsheh« – – – so ulkten wir voller Vergnügen in gehobenster Stimmung noch längere Zeit im Hotel. Dann fuhren wir wieder heim – wir hatten allerdings für diesen Tag genug geleistet – Napolium hatte es uns allen angetan.
Die Ankunft des gefangenen Kaisers erfolgte schon am folgenden Tage; er traf abends 10 ½ Uhr auf dem Wilhelmshöher [335] Bahnhof ein, wo er von dem Gouverneur von Cassel, Grafen Monts, und dem Oberpräsidenten v. Möller empfangen wurde. Publikum bemerkte man nicht viel, weil die Ankunft nicht bekannt gegeben war. Auf dem Bahnhof war eine Ehrenwache aufgestellt, die mit Trommelwirbel salutierte. Er soll überrascht gewesen sein, hier noch eine so gute disziplinierte Truppe zu finden, während er alle Soldaten bis auf den letzten Mann in Frankreich wähnte. In Begleitung des Gouverneurs fuhr der Gefangene sodann in einem zweispännigen Wagen nach dem Schlosse. Beim Betreten des Schlosses soll er sich erinnert haben, daß am 7. Dezember 1807 sein Onkel Jérôme als König von Westfalen hier eingezogen war, der dem Schloß den Namen »Napoleonshöhe« gegeben hatte.
In den Räumen dieses Schlosses, die ehemals unter dem »König Lustik« vom Jubel übermütiger Feste und wüster Schwelgereien widerhallten, weilte jetzt der gestürzte Kaiser als Gefangener – welche wunderbare Fügung!
[13.9 Napoleons Zeit auf der Wilhelmshöhe]

Postkarte, ca. 1900: »Ney – Dr Conneau – Murat – Napoleon – Castelneau«; Rückseite: »Napoleon III. auf Wilhelmshöhe 1870/71«.*MA
Am Tage nach seiner Ankunft promenierte Napoleon schon früh morgens mit seinen Generälen in den schönen Parkanlagen. Die Natur entzückte ihn durch ihre Ruhe und Erhabenheit. Von Personen aus seiner nächsten Umgebung erfuhr man, daß der Kaiser sich sehr wohl auf seinem Gefangenensitze, unserer herrlichen Wilhelmshöhe, fühlte. Der Kontrast zwischen den gewaltigen Erlebnissen der letzten Tage und der friedlichen, ihn umgebenden Stille, dazu die kräftige, reine Waldluft war zu groß, als daß der wohltätige Einfluß auf sein Befinden sich nicht sofort fühlbar gemacht hätte.
In den ersten Tagen seines Aufenthaltes ging er deshalb häufig spazieren und hielt sich bei dem herrlichen Herbstwetter viel im Freien auf, meistens auf der Innenseite des Schlosses nach dem Herkules zu. Dort sah auch ich zuerst den Kaiser mit seiner Umgebung, alle trugen noch die Uniform, meist hellblaue Waffenröcke mit grellroten weiten Beinkleidern und Käppis, dabei reichen goldenen Besatz an Käppi, Kragen und [336] Ärmelaufschlägen. Der Kaiser machte durchaus nicht den martialischen Eindruck, den ich mir nach seinen bekannten Bildern von ihm versprochen hatte. Von gedrungener Statur, unter Mittelgröße, hielt er sich beim Gehen etwas nach vorn gebeugt; man sah ihm an, daß er leidend war. Am meisten überraschte es mich aber, daß der Kaiser nicht, wie man allgemein glaubte, schwarzes Haar und dunkele Augen, sondern fast semmelblonde, graumelierte Haare und helle, graublaue Augen hatte. Er trug das Haar lockig vor den Ohren liegend, den Schnurrbart herunterhängend, nicht mehr mit den gedrehten historischen Spitzen, wie er ihn früher trug, welcher mit dem Knebelbart damals typisch als »Napoleonsbart« bezeichnet wurde. Sein Gesicht war blaß und aufgeschwemmt, sein Blick von müdem, apathischem Ausdruck, durchaus nicht offen und frei, sondern mehr niedergeschlagen und scheu. Wenn er durch das Publikum ging oder fuhr, zeigte er ein gedrücktes Wesen; gegrüßt wurde er nur selten, kein »Vive l’Empereur« schallte ihm mehr entgegen, ernst und schweigsam verhielt sich die Menge, wenn er sich zeigte.
Die Adjutanten und Generäle des Kaisers waren fast durchweg stattliche, schöne Gestalten, die ihren Gebieter um mehr wie Haupteslänge überragten. Auffallend war der zwanglose Verkehr zwischen dem Kaiser und seiner Umgebung. Diese saß auf den Bänken oder stand um den Kaiser herum, plauderte lebhaft und rauchte Zigaretten. Der Kaiser stützte sich auf einen Stock beim Gehen, die anderen hatten kleine dünne Reitstöckchen, mit denen sie in der Luft herumfuchtelten; sie waren überhaupt kreuzfidel, lachten und scherzten, während der Kaiser in sich gekehrt dazwischen stand.
Unter seinen Adjutanten befanden sich zwei schlanke, junge Offiziere, darunter sein Neffe, der Prinz Achille Murat (s. Abbild.), die übrigen, die Generäle Reille, der bei Sedan den Brief Napoleons an König Wilhelm überbrachte, ferner Vaubert, Castelnau, Pajol u.a., waren schon ältere, ergraute, Herren.
[Zwischen den Seiten 336 und 337:]

Napoleon mit dem Prinzen Murat.
[337] Bald nach seiner Ankunft ließ Napoleon seine Pferde, die er in großer Zahl, einige achtzig, mitgebracht hatte, und die im Marstallgebäude eingestellt waren, öffentlich verkaufen; er behielt nur sechs Reitpferde, darunter den Fuchs, den er bei Sedan geritten hatte. Der Verkauf zog damals viele Pferdeliebhaber nach Cassel, und mancher hat durch Wiederverkauf viel Geld verdient; auch in Cassel blieben mehrere Pferde. Die größere Zahl der Dienerschaft wurde danach entlassen und kehrte nach Frankreich zurück.
Am 12. September machte der Kaiser in seiner achtsitzigen mit vier edlen Pferden bespannten Gala-Equipage, einen Vorreiter voraus, eine Spazierfahrt in die Umgebung. Die Equipage war voll besetzt, der Kaiser saß zwischen seinen Generälen, die alle in großer Uniform waren, hinter dem Wagen ritten drei Offiziere, ebenfalls in großer Uniform, daneben ein Leibstallmeister; zwei berittene Postillone hatten die Führung übernommen. Einige Tage darauf, am 15. September, trafen sechs schwarzbraune Trakehner Hengste mit einer königlichen Equipage aus Berlin ein, und es wurde dem Kaiser nahegelegt, sich bei seinen Ausfahrten doch lieber dieser Equipage zu bedienen. Der Anblick der schwarz-weißen Adler auf der Uniform der Dienerschaft, die ihm von jetzt ab zur Verfügung gestellt wurde, soll ihn anfangs erregt haben.
Diese, von unserem Gouverneur wahrscheinlich veranlaßte Veränderung hatte zur Folge, daß die französischen Herrschaften sich öffentlich nie mehr in Uniform zeigten, sie erschienen von nun an nur in schwarzen Zivil-Anzügen mit Zylinder.
Am 30. September besichtigte Napoleon die in Wilhelmshöhe einquartierte Reservebatterie. Der Gouverneur, Graf Monts, war zugegen. Der Batteriechef, Hauptmann Spangenberg, hielt ihm einen interessanten Vortrag über die Konstruktion und die Bedienung der Geschütze. (S. Abbild.)
[Zwischen den Seiten 338 und 339:]
Napoleon beschäftigte sich eingehend mit der Entstehungsgeschichte des Schlosses und der herrlichen Anlagen; er äußerte [338] sich hocherfreut über den herrlichen Blick, den er von seinen Zimmern in die malerische Umgegend hatte. Von seinem Onkel Jérôme habe er viel von der Naturschönheit dessen einstmaliger Residenz gehört, was er jetzt voll bestätigt finde. Jérôme habe ihm auch von den lukullischen Festen erzählt, die er auf Wilhelmshöhe abgehalten hätte, wie er den Weg von Cassel nach Wilhelmshöhe durch die gerade breite Lindenallee in einem mit vier Hirschen bespannten Wagen im Fluge zurückgelegt hatte. Eine heitere Damengesellschaft hätte ihn stets begleitet, und lustig wäre es damals hier zugegangen. In dem Raum, wo er jetzt im Schlosse allwöchentlich Messe lesen lasse, habe Jérôme Schauspiele abgehalten, in denen üppige Gruppen von Tänzerinnen ihn und seine Freunde entzückt hätten. Napoleon stellte hierzu eine vergleichende Betrachtung an über die wunderbare Wendung der Geschicke der Bonapartes, in der man eine gewaltige Ironie erblicke, die ihn aber nicht niederdrücken könne. Wenn er an das Geschick seines großen Oheims denke, an seinen qualvollen Aufenthalt auf der öden, weit entfernten, ungesunden Insel St. Helena, an jenes elende Bretterhaus, welches ihm zur Wohnung gegeben war, dann habe er keine Veranlassung, sich über sein Geschick zu beklagen. Sein Leben könne er ein durchaus behagliches nennen, seine Behandlung sei eine gentile, er fühle kaum den Druck der Gefangenschaft.
Und so war es auch, die Großmut unseres edlen Königs ließ es Napoleon an nichts fehlen; nicht wie ein Gefangener, sondern wie ein gastlich geladener Fürst wurde er behandelt, mit allen Ehrenbezeugungen, die einem souveränen Herrscher zuteil werden. Jeden Tag zog in das Wachtgebäude eine starke Militärtruppe unter dem Kommando eines Offiziers auf, gerade wie heutzutage, wenn die kaiserliche Familie auf Wilhelmshöhe wohnt. Wenn er am Wachtgebäude vorüberkam, wurde stets die Wache ins Gewehr gerufen, die unter Trommelschlag präsentierte.
Der Kaiser und sein Gefolge konnten sich frei bewegen, und innerhalb der Anlagen überall promenieren, mit Vorliebe [339] benutzte er den Weg über oder um den großen Rasenplatz hinter dem Schlosse, und hier hatte man die beste Gelegenheit, ihn und seine Leute zu beobachten. Um das Publikum nicht zu lästig werden zu lasten, war eine Postenkette in den Anlagen verteilt, ganz so, wie es auch heute bei dem Aufenthalt der Majestäten auf Wilhelmshöhe der Fall ist. In einiger Entfernung folgte ihm ganz unauffällig ein Herr in tadellosem schwarzem Anzug – es war der Polizei-Kommissar Eiffert, der sich seiner bedeutungsvollen Mission wohl bewußt war. Seine weiteren Spaziergänge machte er mit Vorliebe nach dem derzeit einsam gelegenen Mulang – eine Villenkolonie ahnte man damals noch nicht – und von dort nach der Löwenburg und dem Riesenschloß; beide Bauwerke interessierten ihn sehr, besonders das Oktogon mit den Kaskaden, deren kolossal aufgetürmte Steinmassen ihn an den ägyptischen Pyramidenbau erinnerten. Über die großartigen Ausblicke von diesen Punkten war er immer sehr entzückt.
Auch Wilhelmstal, den Lieblingsaufenthalt Jérômes, besuchte der Kaiser. Er ließ sich durch den Kastellan Steindecker durch alle Gemächer führen, ließ sich den Park zeigen und betrachtete alles mit großem Interesse. Dieser Besuch erinnerte ihn auch an Jérôme, der ihm manches von Wilhelmstal erzählt habe, wie hier im engsten Kreise von Freunden Aufführungen der ungezwungensten Art mit schönen Weibern stattgefunden hätten, wobei Bäder von Milch, Bouillon oder Rotwein den Schluß machten, nicht immer mit gewünschter Wirkung. Solche Anekdoten von Jéróme gaben für Napoleon und seine Umgebung auf Wilhelmshöhe öfter den Stoff der Unterhaltung ab.
In die Stadt Cassel ist Napoleon nur zweimal, aber dann nicht weiter als zum Königsplatz gefahren, nur um damit das Gerücht zu widerlegen, daß ihm der Besuch der Stadt untersagt sei.
Napoleon sprach gut deutsch, den schwäbischen Dialekt mit französischem Akzent. Ich hatte Gelegenheit, in nächster [340] Nähe ein Gespräch mit anzuhören, das er mit dem dauernd diensttuenden Oberpostsekretär Denner im Schlosse hielt. Anton Denner, einer meiner guten Freunde, Mitbewohner meines Hauses, lud mich ein, ihn in seinem Postlokale zu besuchen zu einer Zeit, wo der Kaiser seine Briefe meist persönlich abholte. Ich folgte der Einladung und traf es so günstig, daß der Kaiser erschien, den ich von einem Nebenzimmer aus in nächster Nähe sehen und sprechen hören konnte. Er war sehr leutselig in seinem Gespräch mit Denner, dem er anscheinend großes Vertrauen schenkte; später, bei seiner Abreise von Wilhelmshöhe, verehrte ihm Napoleon ein wertvolles Andenken.
Der Fremdenbesuch war in dieser Zeit ein ganz außergewöhnlicher; das Wetter war bis Ende Oktober ein sehr mildes und trockenes, bei fast immer klarem Himmel. Auch der Hannoversche Männergesangverein besuchte Cassel und Wilhelmshöhe, wobei ich, als alter Bekannter des Vereins, die Führung übernommen hatte. Wir hatten Gelegenheit, den gestürzten Zäsaren, der mit seinen Generalen im Park promenierte, ganz in der Nähe zu sehen und seine Aufmerksamkeit durch mehrere Männerchöre zu erregen, die er, stehenbleibend, mit anhörte. Die Sänger wählten zum Schluß das Lied: »Was stehst du, Mensch, mit düsterm Sinn, die Welt ist ja so schön« – ob er den Text wohl verstanden hatte?
Mit Rücksicht auf den Kaiser wurde es vermieden, Transporte gefangener französischer Soldaten durch die Stadt zu führen; nur einmal im Winter, bei strenger Kälte, wurden wohl über tausend Mann von der Loire-Armee vom Bahnhof in die Stadt geführt, die im Reithause am Garde du Corpsplatz verpflegt wurden. Es war ein jammervoller Anblick, dies zerlumpte Gesindel vorbeiziehen zu sehen. Auf ihren bleichen, hohläugigen Gesichtern sah man die Not und das Elend, das sie bei dem bitterkalten Wetter in den Eisenbahnwagen auszustehen hatten; es war eine große Anzahl Kranker darunter, die ins Lazarett gebracht wurden, sogar mehrere [341] Leichen wurden aus den dichtgedrängt besetzten Wagen herausgezogen.
[13.10 Verwundete Franzosen in Kassel]
Im Reithaus wurden die Ärmsten durch aufgestellte Öfen mit warmen Speisen und Getränken, besonders Kaffee, erwärmt und gestärkt, und bald hatte jeder eine brennende Zigarre im Munde. In der kurzen Zeit ihres Aufenthaltes wurden von allen Seiten warme Kleidungsstücke, besonders Strümpfe und wollenes Unterzeug herbeigeschafft, damit die Bedürftigsten unter ihnen sich etwas besser vor der Kälte schützen konnten. Ein großer Teil der blutjungen Burschen – es waren fast noch Knaben – waren Elsässer, mit denen wir uns unterhalten konnten, und die allmählich gesprächiger wurden, als sie sahen, mit welcher Fürsorge man sie behandelte. Mir erzählte einer derselben von dem Elend und den Entbehrungen, welche die von Gambetta »aus der Erde gestampften Legionen« zu erleiden hatten, wie sie ohne jede militärische Ausbildung in mangelhafter Ausrüstung vor den Feind geschleppt wurden, um zum größten Teil entweder niedergeschmettert oder gefangen zu werden.
Wir alle, die wir diese bedauernswerten Opfer mit eigenen Augen sahen, wünschten, daß demjenigen, der auf unserer schönen Wilhelmshöhe wie ein rohes Ei behandelt wurde, dieser jammervolle Anblick nicht vorenthalten würde, damit er sich einen Begriff von dem namenlosen Unglück machen könnte, als dessen Urheber er betrachtet wurde.
Aber der Imperator, der jahrelang die tonangebende Rolle im europäischen Konzert gespielt hatte, dessen Worten alle Welt seither gelauscht hatte, sollte vor solchem Anblick verschont bleiben! – Warum diese Großmut, die vom Volke nicht begriffen wurde?
In Cassel waren deshalb nur solche französische Offiziere interniert, die überall zwanglos verkehren konnten und respektvoll behandelt wurden. Man sah sie in den Konzerten der Ausstellung, wie im Hoftheater, wo ihnen die besten Plätze eingeräumt wurden, sie trugen meist tadellose schwarze [342] Anzüge mit einer roten Rosette im Knopfloch, dem Zeichen der Ehrenlegion.
[13.11 Das Ende des Krieges]
Doch zurück zum Kriegsschauplatz! Die Katastrophe von Sedan führte bekanntlich zum Zusammenbruch des Kaiserreichs. Am 4. September konstituierte sich in Paris eine provisorische Regierung, welche Napoleon und seine Dynastie der Regierungsrechte für verlustig erklärte und die Republik für Frankreich proklamierte.
Die neuen Machthaber, an ihrer Spitze Jules Favre, versuchten Friedensverhandlungen anzubahnen, die aber ohne Erfolg blieben, weil die Franzosen »weder einen Zoll Landes noch einen Stein einer Festung« abtreten wollten. Ohne dies aber konnte und wollte unser eiserner Kanzler keinen Frieden gutheißen; er verlangte Garantien dafür, daß ein Überfall Frankreichs in Zukunft unmöglich werde, durch die Abtretung der ehemals zu Deutschland gehörenden Provinzen Elsaß und Lothringen mit der Festung Metz, hierzu wollten sich die Franzosen nicht verstehen und den Krieg gegen die verhaßten Prussiens bis aufs Messer fortführen. Wie die Herren der ersten französischen Republik nach der großen Revolution die feindliche Welt eroberten, so glaubten die verblendeten Republikaner, nach dem Sturz des Kaiserreichs auch diesmal den Sieg an ihre Fahnen zu knüpfen – noch waren ja kriegsgeübte Truppen vorhanden, die meisten Festungen waren noch nicht übergeben. Aber gottlob kam es anders!
Unsere Armee rückte nach dem Fall von Sedan unaufhaltsam gegen Paris vor. Mit Ausnahme der Belagerungsarmee vor Metz, Straßburg und den kleineren Festungen, stand die deutsche Hauptmacht unter dem direkten Oberbefehl des Königs, die nun dazu bestimmt war, die größte Festung der Welt – Paris – zu nehmen.
Die Riesenstadt, an deren Befestigung die Franzosen mit fieberhafter Tätigkeit gearbeitet hatten, wurde nach Moltkes meisterhafter Strategie von den deutschen Korps binnen kurzer Zeit ringsum eingeschlossen. Am 19. September schon telegraphierte [343] der König an die Königen, daß die Zernierung von Paris vollzogen sei. Jetzt war auch diese Festung geschlossen, aus der freiwillig niemand mehr herauskommen konnte; allerdings konnten auch unsere Truppen so bald nicht hinein, es stand ihnen noch eine lange Belagerungszeit bevor. Bis tief in den strengen Winter hinein waren unsere Truppen den größten Strapazen und Entbehrungen ausgesetzt, welche der jetzt vorherrschende, aufreibende Vorpostendienst mit sich brachte. Ich habe später manches Klagelied von meinen Freunden vernommen, welche die Belagerung vor Paris mitgemacht hatten.
Mit Ausnahme einiger Ausfallgefechte kamen größere Engagements nur selten vor; der General-Quartiermeister von Podbielski schloß deshalb sein Telegramm meist ab mit den Worten: »Vor Paris nichts Neues« – Worte, die schließlich eine stereotype Redensart wurden.
Weil keine französische Armee mehr im Felde stand, trafen Nachrichten von Bedeutung längere Zeit nicht hier ein. Endlich, am 27. Oktober, wurde uns die hocherfreuliche Kunde von der Kapitulation von Metz durch das offizielle Telegramm des Königs: »Diesen Morgen hat die Armee Bazaines und die Festung Metz kapituliert. 150.000 Mann Gefangene inkl. 20.000 Blessierte und Kranke. Heute Nachmittag wird die Armee und die Garnison die Gewehre strecken. Wilhelm.«
Mit allgemeinem Jubel wurde diese hocherfreuliche Siegesbotschaft begrüßt und gefeiert, wenn auch nicht in dem Maße, wie nach dem Falle von Sedan. Das Telegramm des Prinzen Friedrich Carl nach erfolgter Übergabe der Festung lautete noch günstiger, der Verlust der Franzosen belief sich auf 173.000 Mann, es war die beste Armee Frankreichs, mehr als fünf Armeekorps, darunter die Kaisergarde, drei Marschälle, über 50 Generäle und 6000 Offiziere kapitulierten, dazu kam noch eine unermeßliche Kriegsbeute an Geschützen, Waffen, Material, Pferden usw.
[13.12 Napoleon und seine Offiziere beim Kriegsende]
[344] Dem Kaiser Napoleon war die bevorstehende Kapitulation als unvermeidlich schon einige Tage vorher angekündigt worden. Er ging düster und traurig einher und brachte kaum Speise und Trank über seine Lippen. Als Metz kapituliert hatte, rief er aus: »Es bricht alles zusammen.« Er hatte mit Zuversicht immer noch auf Bazaine gerechnet, daß es ihm gelinge, entweder mit seinen Kerntruppen den Belagerungsgürtel vor Metz zu durchbrechen und den Deutschen vor Paris in den Rücken zu fallen oder sich bis zum Friedensschluß halten zu können. Nun wurde auch diese Hoffnung zu Schanden. Zu seinem Troste besuchte ihn seine Gemahlin, die Kaiserin Eugenie, die am 30. Oktober in Wilhelmshöhe eintraf – welch ein Wiedersehen nach dem verlorenen Spiel, zu dem sie die Karten gemischt hatte! Nach drei Tagen reiste sie wieder ab.
Inzwischen traf auch der kriegsgefangene Bazaine mit Gefolge und Dienerschaft in Cassel ein, das er sich, in der nächsten Nähe seines Kaisers, zu seinem Aufenthaltsort wählen durfte, ein Beweis dafür, daß man keine Gefahr darin erblickte – ihre politischen Rollen hatten beide ausgespielt.
Der Marschall wohnte mit seinem Adjutanten im Hotel du Nord, seine Dienerschaft und die Pferde wurden in der Gastwirtschaft von Gebrüder Regenbogen in der Bahnhofstraße untergebracht. Ich hatte dort bauliche Arbeiten auszuführen und fand Gelegenheit, mit einigen Leuten von der Dienerschaft, es waren Elsässer, Unterhaltungen anzuknüpfen über manches, was sie in Metz erlebt hatten. Sie waren alle der Ansicht, daß sie verraten wären und daß Bazaine selbst als »un traitre« bezeichnet werde, sonst wäre Metz nie übergeben worden. Daß ihn die gesamten Franzosen für einen Verräter hielten, dafür zeugt der später gegen ihn geführte Prozeß, in dem er, unter dem Druck der öffentlichen Meinung, die ein Opfer verlangte, zum Tode verurteilt, nachher aber zu lebenslänglicher Festungshaft begnadigt wurde, aus der er mit Hilfe seiner Gemahlin und seines früheren Adjutanten wieder befreit wurde.
[345] Die Pferde Bazaines kamen schon in den nächstfolgenden Tagen zur öffentlichen Versteigerung, der ich beiwohnte. Eines derselben kam, ohne daß ich es beabsichtigte, in meinen Besitz. Dies Pferd hatte eine anscheinend schwere Verletzung an einem der Sprunggelenke, das sehr stark angeschwollen war, es ging nur auf drei Beinen. Es wollte keiner bieten; ich, eigentlich mehr aus Ulk, machte ein geringes Gebot, auf das aber kein weiteres erfolgte, und so bekam ich den Zuschlag. Mein Tierarzt, der zugegen war, beglückwünschte mich zu dem Kauf und sagte mir ein glänzendes Geschäft voraus. Es war nämlich im übrigen ein schönes, noch junges Tier, das nur sehr heruntergekommen war. Nach mehreren Wochen war der Schaden völlig gehoben und das verletzte Bein tadellos wieder hergestellt. Der »Bazaine«, so wurde das Pferd genannt, hatte sich durch die Ruhe und gute Pflege prachtvoll herausgemacht, es war ein stolzes Tier und vorzüglicher Traber, den ich im Frühjahr für schweres Geld an einen Liebhaber wieder verkaufte.
Marschall Bazaine, der Sündenbock der Franzosen, durfte es nicht wagen, nach Frankreich zurückzukehren. Es gefiel ihm in Cassel auch sehr gut, so daß er zunächst längere Zeit hier wohnen wollte. Er mietete eine der neuerbauten Villen meines Freundes Fritz Potente am Akazienweg. Dort wurde ihm im Laufe des kommenden Jahres eine Tochter geboren; damit diese aber das Licht der Welt auf französischem Boden erblickte, ließ der törichte Vater aus Frankreich eine Kiste voll Erde kommen, auf die er das Bett der Wöchnerin stellen ließ. So erzählte man sich hier den Vorfall, mit dem sich der eitle Franzose nur lächerlich machte.
Bazaine mit seiner Frau, einer schönen Maxikanerin, war ein eifriger Spaziergänger; man begegnete ihm in seinem schwarzen Samtjackett täglich auf der Straße; seine untersetzte, etwas beleibte Persönlichkeit, erinnerte mehr an einen Spießbürger, als an einen Soldaten; nur das gebräunte Gesicht und der französische Knebelbart ließen einen solchen [346] in ihm vermuten. Erst nach einem Jahr verließ er wieder unsere Stadt, um sich freiwillig in Frankreich vor ein Kriegsgericht zu stellen. Seine Villa ging nach seinem Abzug in den Besitz des Kaufmanns Katzenstein über, der beim Ankauf der Villa bedingte, daß zur Erinnerung an den berühmten Bewohner eine passende Inschrift außen am Hause angebracht wurde. Sein Wunsch wurde ihm erfüllt, indem unter einer Fensterbrüstung eine Platte eingelassen wurde, in deren Mitte in Medaillonform das modellierte Konterfei des neuen Besitzers angebracht war mit der Umschrift: »Einst zog hier Marschall Bazaine ein, jetzt wohnt hier Albert Katzenstein.« Der neue Besitzer fand aber keinen Gefallen an dieser Dedikation und ließ sie bald wieder entfernen.
Auf Wilhelmshöhe, »am Hoflager Napoleons«, wurde es immer stiller, je mehr wir in den Winter hineinkamen; der gefangene Franzosenkaiser war für die Casselaner bald nichts Neues mehr, sie wanderten nicht mehr in großer Schar hinauf, um ihre Neugierde zu befriedigen; sie sahen genug Franzosen in der Stadt, darunter auch Anhänger Napoleons, die ihrem entthronten Kaiser ihre Beileidsvisiten abstatteten. Der frühere Polizei-Präfekt von Paris, Pietri, eine der willfährigsten Kreaturen Napoleons, traf ein und blieb längere Zeit bei ihm, ebenso der Prinz v.d. Moskwa mit Frau und zwei Söhnen; die Marschälle Leboeuf und Canrobert, die Generäle Frossard, Fleury u.a. hielten sich nur kurze Zeit hier auf.
[13.13 Abreise Napoleons, sehr kalter Winter]
Als starker Frost eintrat, kaufte sich Napoleon in Cassel einen tüchtigen Pelz und ging nach wie vor täglich spazieren. Auf dem Lac lief er mit seiner Umgebung oftmals Schlittschuh, er war ein passionierter Schlittschuhläufer. Napoleon blieb noch bis zum 19. März 1871 auf Wilhelmshöhe und begab sich dann nach Chislehurst in England. Bei seiner Abreise äußerte er zu seiner Umgebung, daß ihm der Aufenthalt auf Wilhelmshöhe sowohl körperlich als geistig so wohl getan habe, wie nirgendwo, selbst nicht in Vichy. – –
[347] In Cassel wurde die Ausstellung, um nochmals von ihr zu reden, am 5. Oktober geschlossen. Sie hatte trotz der unvorhergesehenen kriegerischen Ereignisse, von denen man einen ungünstigen Einfluß auf den Besuch der Ausstellung befürchtete, insoweit geschäftlich gut abgeschnitten, daß nicht nur kein Defizit, sondern sogar ein Überschuß sich herausstellte. Das Publikum hatte die vorzüglichen Konzerte der Mansfeldschen Kapelle immer mit lebhaftem Interesse besucht, die vortrefflich geführte Behlendorfsche Restauration erfreute sich daneben eines andauernd guten Zuspruchs, so daß der Ausstellungsvorstand beschloß, den Restaurationsbetrieb und die Konzerte das Winterhalbjahr hindurch fortbestehen zu lassen, ein Beschluß, der von den Casselanern mit großer Befriedigung aufgenommen wurde, denn es fehlte tatsächlich an besseren Unterhaltungen im Winter.
Gegen den Schluß des Jahres wurde es bitterkalt, der Winter trat mit einer Strenge auf, an die man nicht mehr gewöhnt war, dazu kam ein ausnahmsweise starker Schneefall. In unserm freistehenden, leicht gebauten Hause machte sich die eisige Kälte ganz besonders fühlbar, der Schnee lag, durch den Wind angehäuft, meterhoch auf dem Wege vor meinem Hause. Ohne Doppelfenster, nur zwei Casseler Rundöfen mit Braunkohlenheizung in meiner Wohnung, dabei nur dünne Fachwerkswände, und draußen oft über 20 Grad Reaumur, wie konnte man unter solchen Verhältnissen ein warmes Zimmer bekommen – unmöglich! Wir froren wie die Schneider; in unserem Schlafzimmer waren die Waschbecken jede Nacht zugefroren; nie habe ich später die Strenge des Winters so sehr empfunden, wie in diesem. Im Freien barsten die Bäume mit heftigem Knall auseinander, ich büßte in meinem Garten einen großen Teil meiner Obstbäume ein – mit einem Wort, es war eine Hundekälte! Gerade während der Weihnachtstage war die Kälte besonders groß; wir feierten zum ersten Male die Weihnachtsbescherung bei uns im Hause mit unserer kleinen Emilie, in Gegenwart meiner Eltern; [348] und ich entsinne mich noch, welche Schwierigkeiten wir hatten, um unsere Zimmer nur einigermaßen warm zu bekommen. –
Das Jahr 1870 mit seinen folgenschweren Ereignissen, das glorreichste in der Geschichte des deutschen Volkes, ging nun zur Neige. Wenn wir Deutsche zurückblickten auf das, was es uns gebracht hatte, mußten wir bekennen: »Gott war mit uns!« Der Herr der Heerscharen war mit unserem Volke in Waffen, er hat an ihm das zur Wahrheit werden lassen, was die verblendeten Franzosen in ihrer Vermessenheit beim Ausbruch des Krieges für sich erflehten, daß er ihrer gerechten (?) Sache zum Siege verhelfe – er hat der gerechten Sache allerdings zum Siege verholfen, aber diese war auf unserer Seite!
In der Hoffnung, daß der Friede dem blutigen Drama in Frankreich bald ein Ende machen werde, traten wir ins neue Jahr hinüber.
[349] 14. Zum Frieden und was die folgenden Jahre brachten.
[14.1 Kaiserproklamation in Versailles]
Beim Eintritt ins neue Jahr war der Kampf zwischen den ringenden Völkern noch im vollen Gange. Beide machten die äußersten Anstrengungen – die Franzosen, um der vollständigen Niederlage zu entgehen – die Deutschen, um die glänzenden Erfolge bis zur letzten Entscheidung, der Einnahme von Paris, zu führen, der man langsam, aber sicher, Schritt für Schritt täglich immer näher kam.
Mitten in diesem Kriegsgetümmel vollzog sich unter den Mauern von Paris, in Versailles, ein Ereignis, durch das der Traum der Deutschen endlich zur Wahrheit wurde, durch welches sich glänzend erfüllte, was bisher vergebens erstrebt – die Wiedererstehung der deutschen Kaiserwürde!
Im Spiegelsaal des Schlosses zu Versailles, dem Schlosse des französischen Königs schmachvollen Angedenkens, mit dessen Namen die Greueltaten und Zerstörungen am herrlichsten unserer deutschen Ströme in einer Zeit tiefster Erniedrigung und Zerrissenheit des deutschen Volkes verknüpft sind, traten am 18. Januar die deutschen Fürsten und Abgeordneten aller deutschen Staaten zusammen, um demjenigen die Kaiserwürde anzubieten, der nicht allein als mächtigster unter den deutschen Bundesfürsten der dazu Berufenste war, sondern der wie kein anderer dazu prädestiniert erschien, die auf dem Schlachtfelde wieder errungene deutsche Kaiserkrone zu tragen. Er verstand es wie kein zweiter, die Sehnsucht der Nation zur Wahrheit werden zu lassen; er wagte es trotz seines hohen Alters, an der Spitze des deutschen Volkes in Waffen [350] gegen den Erbfeind zu ziehen und diesen, den größten Gegner der deutschen Einheit, niederzuringen. Dankerfüllt richteten sich die Augen der gesamten Nation, voran die der deutschen Fürsten, auf die hehre Heldengestalt »Wilhelms des Siegreichen«, sie boten ihm des Reiches Krone und Szepter an, daß er das Deutsche Reich in neuer Kaiserherrlichkeit wieder erstehen lasse.
Wie sich die Kaiserproklamation in Versailles vollzog, ist in dem bekannten Bilde Anton v. Werners festgelegt. Überall im Deutschen Reiche wurde sie mit großem Enthusiasmus aufgenommen, in den verschiedensten Städten wurde sie mit feierlichen Demonstrationen, Glockengeläute, Illumination usw. begrüßt. In unserem Cassel aber ging das welthistorische Ereignis spurlos vorüber, die Stadtvertretung hatte es versäumt, die Initiative zur Veranstaltung einer öffentlichen Feier zu ergreifen, dagegen wurde im Militär-Kasino und in kleineren Kreisen der hohen Bedeutung dieses Ereignisses in festlicher Weise Rechnung getragen.
Schon wenige Tage nach dem für Deutschland so hochbedeutenden historischen Akt im Schlosse zu Versailles fanden Verhandlungen über die Kapitulation von Paris statt, dessen Widerstandsfähigkeit zu Ende ging. Die Not unter der Bevölkerung der französischen Hauptstadt hatte den höchsten Grad erreicht, alle Versuche, die Belagerungslinie zu durchbrechen, waren mißlungen, die Belagerungsgeschütze feuerten ihre zerstörenden Geschosse immer mehr in das Innere der Stadt; es gab keine Hoffnung mehr, die Übergabe der Stadt war unausbleiblich!
Endlich am 28. Januar, nach viermonatlicher Belagerung, erfolgte die Übergabe der Forts von Paris, nachdem die Bedingungen zu einem Waffenstillstand zwischen dem Grafen Bismarck und Jules Favre vorher festgelegt waren. Diese Katastrophe, mit welcher der Kampf zwischen Deutschland und Frankreich seinem Ende nahte, rief einen endlosen Jubel in Alldeutschland hervor.
[14.2 Patriotische Festlichkeiten in Kassel]
[351] Auch in unserer Stadt war der Jubel ein ungeheurer. Die Häuser prangten im reichsten Fahnenschmuck, jubelnde Scharen durchzogen die Stadt. Am Nachmittag fand eine erhebende Feier auf dem Friedrichsplatze statt, wo nach einem ergreifenden Instrumentalchor der Pfarrer Dr. Falkenhainer eine von warmem Patriotismus durchglühte Rede hielt, nach welcher von der nach vielen Tausenden zählenden Menge der Choral »Nun danket alle Gott« gesungen wurde, worauf ein dreifaches Hoch auf unsern Kaiser mit tausendstimmigem, nicht endenwollendem Jubel ausgebracht wurde. Dazu läuteten die sämtlichen Glocken in der Stadt, und die Kanonen donnerten Viktoria. Daran schloß sich ein festlicher Umzug durch die Stadt; abends gab ein von Tausenden geleiteter Fackelzug und eine allgemeine Illumination der Feier einen würdigen Abschluß. Bis spät in die Nacht hinein dauerte der Jubel und das Freudenschießen.
Im Theater war eine Festvorstellung, in der »Deutschlands Auferstehung«, ein Festspiel mit lebenden Bildern, das Publikum zur Begeisterung hinriß; am Schluß erregte ein vorzüglich arrangiertes Tableau mit der Büste Kaiser Wilhelms im Mittelpunkte, geschmückt mit dem Lorbeer der »Germania« – die von Fräulein Harke dargestellt wurde –, umgeben von den bedeutendsten Heerführern der Gegenwart und den Kriegern der geeinigten deutschen Staaten, ungeheuren Jubel; über dieser Gruppe, hoch im Wolkenhintergrunde, schwebte die Gestalt des »Alten Fritz«, der segnend seine Hände über die Gruppe ausbreitete. Das war wieder ein Festtag mit unvergeßlichen Eindrücken, die mir beim Niederschreiben wieder lebhaft in die Erinnerung treten.
Am 26. Februar wurden vom französischen Bevollmächtigten nach langem Widerstreben in Versailles die Friedensbedingungen unterzeichnet, die lauteten: Abtretung von Elsaß und Lothringen mit der Festung Metz sowie 5 Milliarden Kriegsentschädigung. Nachdem die französische Nationalversammlung in Bordeaux diese Bedingungen anerkannt hatte, [352] erfolgte am 2. März der Friedensschluß. Das Telegramm des Kaisers an die Kaiserin Augusta lautete: Soeben habe ich den Friedensschluß ratifiziert, nachdem er schon gestern von der Nationalversammlung in Bordeaux angenommen worden ist. So weit ist also das große Werk vollendet, welches durch siebenmonatliche siegreiche Kämpfe errungen wurde dank der Tapferkeit, Hingebung und Ausdauer des unvergleichlichen Heeres in allen seinen Teilen und der Opferfreudigkeit des Vaterlandes. Der Herr der Heerscharen hat überall unser Unternehmen sichtlich gesegnet und daher diesen ehrenvollen Frieden in seiner Gnade gelingen lassen. Ihm sei die Ehre und dem Vaterlande mit tief bewegtem Herzen Dank. Wilhelm.
Zur Friedensverkündigung erklang das Geläute sämtlicher Glocken der Stadt. Am Sonntag folgenden Tages fanden Dankgottesdienste in allen Kirchen statt. Von einer öffentlichen Feier nahm man Abstand, dagegen wurde acht Tage später in den festlich geschmückten Räumen des Orangerieschlosses im Ausstellungs-Restaurant eine Friedensfeier veranstaltet, an der sich auch Damen beteiligten. Bei dem Festessen wurden Reden auf den Kaiser, auf das wieder geeinigte deutsche Vaterland, auf die Führer der Armee usw. gehalten, es herrschte eine patriotische Begeisterung und freudig bewegte Stimmung, die schließlich unter den Klängen der Mansfeldschen Kapelle nach der aufgehobenen Tafel zu heiterem Tanz führte, der die Teilnehmer bis zum frühen Morgen in ungetrübter Freudigkeit vereint hielt. Auch ich war einer der Festteilnehmer, aber ohne Frau; sie ließ mich allein ziehen, weil sie verhindert war, denn sechs Tage nach dem Friedensschluß hielt Freund Adebar zum zweiten Male Einkehr in meinem Hause und überraschte uns mit einem zweiten Töchterchen, [353] unserem Fränzchen. Daß dies erfreuliche Familienereignis bei froher Feststimmung im engeren Kreise noch besonders gefeiert und der jungen Mutter gedacht wurde, will ich nicht unerwähnt lassen.
Nach vollzogenem Friedensschluß fand der Einzug eines Teiles unserer Truppen in die Stadt Paris statt, darunter befanden sich auch Truppen der Casseler Garnison. Leider beschränkte sich die Okkupation der Stadt nur auf wenige Tage und nur für einen beschränkten Teil bis zum Place de la concorde, eine Konzession an die Eitelkeit der Franzosen, die man in Deutschland nicht verstand, die sich aber an den Franzosen selbst bitter rächte. Denn sofort nach dem Abzug der deutschen Truppen trat allgemeine Anarchie ein, die Kommune wurde proklamiert, der niedere Pöbel riß die Herrschaft an sich und verübte Greueltaten, die ein Brandmal in der Geschichte von Paris bilden. Unsere Truppen lagen währenddessen in den Forts um Paris und hörten das Kampfgetöse der sich selbst zerfleischenden Pariser mit an; sie sahen die Rauchsäulen aufsteigen von den stolzen Schlössern und öffentlichen Gebäuden, an denen die Petroleuser die Brandfackel angelegt hatten. Mit Entsetzen vernahm die Mitwelt die jammervollen Schilderungen von den Szenen, die sich in den Mauern der unglücklichen Stadt unter dem Rasen der entfesselten Volkswut abspielten. Fünf Jahre später konnte ich mich beim Anblick der angerichteten Zerstörungen des Schauderns nicht erwehren. – Wehe, wenn die Bestie im Menschen die Oberhand gewinnt! –
[14.3 Rückkehr der Truppen, Einquartierung]
Unser Kampf mit Frankreich war nun ausgefochten, die deutschen Truppen kehrten geschmückt mit dem Siegeslorbeer in die Heimat zurück. Der Einzug unserer heimischen Truppen erfolgte aber erst später, nachdem ein großer Teil der anderen Armeekorps unter glänzenden Feierlichkeiten schon den Einzug in ihre Garnison gehalten hatten. – Der Glanzpunkt aber war der Einzug der Truppen am 16. Juni in Berlin mit dem sieggekrönten Kaiser, den Prinzen seines Hauses und seinen Paladinen an der Spitze – ein historischer Akt, der in seiner [354] Großartigkeit und seinem imposanten Verlauf kaum seinesgleichen in der preußischen Geschichte wiederfindet.
Am 11. Juli hielt die 26. Division ihren Einzug in unserer Stadt, die zum festlichen Empfange unserer tapferen Krieger im reichsten Schmuck prangte. Am Wilhelmshöher Tor war eine prächtige Ehrenpforte errichtet, durch welche die Truppen in die Stadt einzogen. Unter dem Geläute aller Glocken, dem Donner der Geschütze fand der Einzug statt, an der Spitze der kommandierende General v. Bose mit seinem Stabe. Empfangen von tausendstimmigen, anhaltenden Hurrarufen der dicht gedrängten jubelnden Volksmenge begrüßte zuerst unser Oberpräsident v. Möller den tapferen General beim Eintritt in die Stadt. Ihm folgte der Oberbürgermeister
Nebelthau, an der Spitze des Magistrats und Stadtverordneten, mit einer längeren Ansprache, nach der er dem siegreichen Heerführer einen goldenen Torbeerkranz überreichte, auf dessen Blättern in silbernen Inschriften die Schlachten und Gefechte, an denen das Korps sich beteiligt hatte, verzeichnet waren. Der General dankte im Namen seiner Truppen mit bewegten Worten für die dem Korps von der Stadt Cassel zuteil gewordene Ehrung und gedachte der vielen Söhne unserer Stadt, die auf dem Felde der Ehre geblieben waren, und der Trauer, welche die Herzen derer Angehörigen erfüllen müsse, die ihre Lieben unter den Heimkehrenden vermissen.
Nach diesen Worten wandte sich der Gefeierte an die Festjungfrauen, die ihm einen Lorbeerkranz überreichten, und dann zog die lorbeergeschmückte Siegerschar unter einem dichten Blumenregen, der unaufhörlich aus allen Fenstern erfolgte, durch die mit Flaggen und Girlanden überreich geschmückte Königsstraße in die Stadt ein, die überreich geschmückten Straßen durchziehend, zum Friedrichsplatz, wo eine große Parade in Gegenwart aller Gewerke und Korporationen, die Spalier bildeten, stattfand. Damit schloß die offizielle Einzugsfeier und die Truppen zogen in die ihnen angewiesenen Quartiere.
[355] Auch wir hatten 4 Mann Einquartierung bekommen, die wir in unserem Gartenhaus, das wohnlich eingerichtet war, unterbrachten. Um unserer Einquartierung etwas besonderes zugute zu tun, hatten wir uns zu mehreren Freunden zusammengetan, um den uns überwiesenen Mannschaften – es waren mehr wie 20 Mann – ein Essen im Restaurant Wulp, jetzt das Heller’sche Haus, Ecke der Rosenstraße, zu geben, an dem wir auch teilnahmen. Die Leute waren über das Festmahl und unsere Beteiligung an demselben hoch erfreut. Es kam eine so gehobene Stimmung über uns, daß wir allesamt gegen Abend noch zum Eissengarthenschen Felsenkeller auf dem Weinberg hinzogen, um auch an dem von der Casseler Feuerwehr veranstalteten Fest teilzunehmen. Beim Marsch durch die Stadt kommandierten wir Zivilisten unsere mehr oder weniger stark bezechten Vaterlandsverteidiger, die sich in dem Festestrubel den Rest holten und schließlich so sternhagelbekneipt waren, daß ich u.a. meine Last hatte, meine 4 Mann spät abends wieder nach Hause in ihr entlegenes Quartier zu dirigieren – ; an diesem Abend war wohl kaum noch ein völlig nüchterner Soldat in der Stadt anzutreffen.
Nun stand uns noch der Einzug der 22. Division bevor; es war aber noch sehr unbestimmt, wann derselbe erfolgen werde; jedenfalls aber war er vor Eintritt des Herbstes kaum zu erwarten.
[14.4 Erholungsreise über Straßburg in die Schweiz]
Es trat nun eine längere Pause der Ruhe ein, in der man mal wieder an etwas anderes denken konnte. Die mannigfachen Festlichkeiten waren ja recht schön, ich ließ auch fast keine im Stich; aber ich merkte auch, daß das viele Schwiemeln mir auf die Dauer nicht gut bekam. Bei der angestrengten persönlichen Tätigkeit in meinem Geschäft machte sich bald eine gewisse Abspannung geltend – ich mußte was dagegen tun und entschloß mich zu einer mehrwöchentlichen Reise mit meiner Frau, der sich Vetter Louis Scheurmann und Frau anschlossen. Unser Reiseziel war die Schweiz bis zum Vierwaldstätter See und Umgebung. Unterwegs besuchten wir auch Straßburg, [356] mußten aber in Kehl übernachten. Die Rheinbrücke bei Kehl war nämlich beim Ausbruch des Krieges gesprengt und die Verbindung der Eisenbahn mit Straßburg war noch unterbrochen, so daß wir abends von Kehl nicht weiter kommen konnten und dort übernachten mußten.
Hier sahen wir die ersten Bilder der Zerstörung, die der Krieg gebracht hatte. Die sämtlichen Stationsgebäude in Kehl waren von den Franzosen zusammengeschossen und lagen noch in Trümmern; eine provisorische Bretterbude ersetzte das Empfangsgebäude.
Wir wohnten in der »Poscht« (Post), dem einzigen besseren (?) Gasthof in dem Städtchen, und fanden dort ein leidliches Unterkommen. Die Wirtin war eine einfache Frau von angenehmem Wesen; als alleinstehende Witwe führte sie das Geschäft. In fesselnder Weise erzählte sie uns von ihren Erlebnissen während des Krieges und der Belagerung von Straßburg und zeigte uns eine Anzahl Granatsplittern von den Geschossen, die auf ihrem Besitztum krepiert waren. Nach ihrer Schilderung hatte die gute Frau während der Tage der Beschießung Kehls eine schreckliche Zeit durchlebt, in der sie nur Schutz in ihrem Keller finden konnte. Sie verstand es, diese bange Zeit ergreifend auszumalen und entgegnete uns auf das Bedauern, welches wir ihr ausdrückten, in ihrem badischen Dialekt: »Ja, ja – desch ischt scho recht – gell – desch glaubt keiner nit, wie’sch zugange isch – wie de Bembele (Bomben) uf de Stadt nunner g’falle sinn, un hennt alles zerschlage« – Am anderen Tage besahen wir uns die gewaltigen Trümmer des gesprengten Brückenkopfes der ehemaligen Rheinbrücke, die noch bis in das Flußbett des Rheins hinein lagen, und besuchten dann Straßburg. Großer Gott – wie sah es da noch aus – ! Ganze Straßen – u.a. die Steinstraße, die rue nationale – lagen noch auf beiden Seiten des Straßendammes in Trümmern. Die Bibliothek, die Mairie, die Finkmatkaserne waren völlig zerstört, das schöne Gebäude des Theaters zum Teil. Die Quaimauer am Ill, der durch die [357] Stadt fließt, war arg zerschossen, auch an vielen Privathäusern sah man Zerstörungen, wo die Granaten eingeschlagen waren. Selbst das Münster war nicht verschont geblieben, das Dach desselben war in Brand geschossen und zeigte jetzt nur eine provisorische Eindeckung mit Dachpappe.
Nachdem wir dies herrliche Bauwerk eingehend angesehen und bewundert hatten, stiegen wir zum Münster hinauf, um den Blick auf die Stadt von oben herab zu genießen. Von der Plattform des unvollendeten Turmes bot sich uns ein weiter, interessanter Blick über die Stadt und ihre Umgebung.
Wir waren die einzigen Besucher; der Turmwärter, ein alter Elsässer, erklärte uns das prachtvolle Rundgemälde und was von der Zerstörung noch sichtbar war, und unterhielt sich mit uns über das, was er in der schrecklichen Zeit während des Bombardements hier oben mit durchgemacht hatte. Mich reizte es, in den hoch in die Luft ragenden Turmhelm des Münsters noch weiter hinauf zu steigen. Auf der einzigen, beim Bombardement unbeschädigt gebliebenen Wendeltreppe stieg ich in dem wunderbar durchbrochenen Maßwerk des Turmes hinauf bis zur sogenannten »Laterne«. Als ich beinahe oben war, wurde ich aus der Höhe begrüßt und mit meinem Namen angerufen. »Nanu – wer ist denn das?« rief ich wieder hinauf – und siehe, es waren zwei junge Herren (Lotz und Heike) von Henschel u. Sohn, die mich kannten und sich freuten, in dieser schwindelnden Höhe mit einem Casselaner zusammen zu treffen. Ich entgegnete ihnen, daß unten auf der Plattform noch drei Casselaner verweilten, wir wären also zu sechs Landsleuten zu gleicher Zeit auf dem Münster.
Nachdem wir uns nach allen Seiten genügend umgeschaut hatten, stiegen wir wieder hinab; fast unten angelangt, sah ich zwei Herren und Damen mit meinem Vetter zusammenstehen und hörte, wie er zu ihnen sagte: »Sehen Sie, jetzt kommt noch einer!« Die inzwischen hinzugekommenen Herrschaften hatten sich nämlich während der Unterhaltung auch als Casselaner entpuppt – es waren zwei Gebrüder Fick, beides Professoren [358] mit ihren Frauen – mit mir waren wir also vier Casseler Ehepaare. Als ich die zwei mir nachfolgenden Herren nun auch noch als Casselaner vorstellen konnte, war die Freude groß über dies amüsante Zusammentreffen. Wir ließen uns vom Turmwärter einige Flaschen Elsässer Roten bringen und stießen auf unser liebes Cassel an; außer uns war niemand mehr oben. – –
Unsere weitere Reise in die Schweiz hinein verlief in jeder Weise befriedigend. Wir fuhren u.a. die kurz vorher eröffnete Rigibahn von Vitzenau hinauf bis Rigi-Kaltbad, der damaligen Endstation, und stiegen von dort zu Fuß bis zum Rigi-Kulm. Zum ersten Male sahen wir von hier aus das überwältigende Panorama des Schweizer Hochgebirges bei schönstem klaren Wetter, tief unter uns den Vierwaldstätter See mit seinen malerischen, gewundenen Ufern! – –
[14.5 Spekulationserfolg, Tod des Vaters]
Von unserer Reise nach Cassel zurückgekehrt, fand ich in der nächsten Umgebung meines Grundstückes ein emsiges Leben und Treiben; die vor einiger Zeit schon ausgeschriebenen Erdarbeiten zum Halle-Casseler Bahnhof, dem jetzigen Unterstadtbahnhof, waren inzwischen in Angriff genommen worden. Mit der Verlegung der Wolfhager Straße wurde begonnen, die direkt an meinem Hause vorbeigeführt wurde. Jetzt war ich fein raus, mein Haus kam nun an eine breite Verkehrsstraße, direkt dem neuen Bahnhof gegenüber, zu liegen.
Mein guter Vater gewann noch die Überzeugung, daß es doch so keine Unklugheit gewesen war, mich in dieser Gegend, »wo sich die Füchse gute Nacht sagen«, anzukaufen. Ihm war es leider nicht beschieden, die Entwickelung des neuen Stadtteils zu erleben, welcher um meinen Grundbesitz, den ich durch Ankauf auf beiden Seiten nach und nach vergrößerte, binnen wenigen Jahren entstanden war. Er starb schon bald darauf, am 19. September, viel zu früh für uns alle, im 55. Lebensjahre, an den Folgen der Bleikolik. – – –
[14.6 Der Kronprinz auf Wilhelmshöhe]
Gegen die Mitte des Monats September kam der Kronprinz – »Unser Fritz«, wie er seit dem Kriege genannt wurde [359] – mit seiner ganzen Familie nach Wilhelmshöhe, um sich von den Strapazen des Feldzuges zu erholen. Ein offizieller Empfang fand nicht statt, dagegen bereiteten Tausende, die hinauf gewandert waren, dem geliebten Helden des letzten Krieges einen begeisterten Empfang.
Daß die kronprinzlichen Herrschaften unsere herrliche Wilhelmshöhe erwählt hatten, um in Ruhe dort längere Zeit zu verweilen, lieferte den Beweis, daß das, was man befürchtete – nämlich daß der Nimbus unserer Wilhelmshöhe durch den Aufenthalt des kriegsgefangenen Kaisers der Franzosen eine Einbuße erleiden würde – nicht zutreffend war.
Der Kronprinz verweilte auf Wilhelmshöhe bis nach seinem Geburtstage, an welchem ihm mit einer Serenade der vereinigten Casseler Gesangvereine, in Verbindung mit einem imposanten Fackelzug der Bürgerschaft, eine großartige Ovation bereitet wurde.
[14.7 Rückkehr der letzten Truppen]
Während seines Aufenthaltes kehrte endlich auch die 22. Division unter General v. Wittich, dem Namensvetter unseres späteren kommandierenden Generals, aus Frankreich zurück und hielt am 25. September ihren feierlichen Einzug in unsere Stadt. Mit demselben festlichen Gepränge wie beim Einzug der 21. Division wurde auch die 22. Division empfangen. Weil aber diesmal Se. kaiserliche Hoheit der Kronprinz die tapferen Söhne unseres Landes, die unter ihm gefochten und seine Siege mit errungen hatten, in ihre Heimat zurückführte, war die Beteiligung der Bevölkerung eine noch erheblich größere, auch die gesamte Schuljugend wurde mit herangezogen.
Es war ein wahrhaft herzerhebender Anblick, die männlich schöne, kraftvolle Heldengestalt unseres Kaisersohnes an der Spitze des Zuges einherreiten zu sehen, neben sich, auf einem Doppel-Pony, seinen zwölfjährigen Sohn, den Prinzen Wilhelm, unseren jetzigen Kaiser. Unablässig grüßte er mit seinem Feldmarschallstab nach allen Seiten hin und blickte lächelnd mit freundlich strahlenden Augen auf die ihm begeistert [360] zujubelnde Menge – es war ein mächtig ergreifendes Schauspiel, das mir heute noch lebhaft vor Augen steht.
Der feierliche Einzug dieser letzten hessischen Truppen in die Heimat bildete für uns Casselaner gewissermaßen das Schlußtableau dieser gewaltigsten, ereignisreichsten Epoche unserer vaterländischen Geschichte. Es herrichte von nun ab wieder Ruhe im Staate – d.h. dem wieder erstandenen »Deutschen Reiche« – aber nicht Ruhe, die gleichbedeutend ist mit Stillstand – nein – solche, die uns unter dem mächtigen Szepter des deutschen Kaisers Gewähr leistete, daß das endlich geeinigte deutsche Volk fernerhin in Ruhe gelassen werde von äußeren Feinden, daß es die Segnungen eines dauernden Friedens genieße! Unauslöschlicher Dank, Ruhm und Preis demjenigen, dem wir das alles zu danken haben, des neugeschaffenen deutschen Reiches erstem und größtem Kanzler – dem Fürsten Bismarck! –
[14.8 Sohn Christel, Umzug in die Wolfhager Straße]
Es gehört nicht in den bescheidenen Rahmen dieser Erinnerungsbilder, politische Ereignisse der neueren Geschichte mit meinen Erlebnissen zu verflechten. Ich will mich nur darauf beschränken, noch einiges aus der jetzt folgenden Entwickelungsperiode unserer Stadt zu berichten in Verbindung mit dem, was in bezug auf meine persönlichen Verhältnisse erwähnenswert erscheint.
Mit der stetigen Ausdehnung meines Geschäftes und dem Zuwachs in meiner Familie durch die am 2. März erfolgte Geburt eines Söhnchens, meines Christel, stellte sich für mich die Notwendigkeit heraus, mir eine geräumigere Wohnung und daneben auch größere Geschäftslokalitäten zu beschaffen. Es fand sich ein Liebhaber für mein Haus und Hintergebäude, dem ich beides mit einem kleinen Teil meines Gartens verkaufte. Ich baute mir nebenan ein neues Haus, jetzt Nr. 41 der Wolfhager Straße, mit größerem Nebengebäude fürs Geschäft, und bezog die erste Etage im Vorderhaus. –
[14.9 Gerüsteinsturz an der Neuen Galerie]
Hier klicken (→) für ein Foto von Carl Machmar: Das Gerüst an der Gemäldegalerie (der »Neuen Galerie«). (Universitäts-Bibliothek Kassel)
Hier klicken (→) für ein Foto aus der Bauzeit der Gemäldegalerie, Blick aus der Friedrichstraße. Das Gebäude rechts ist das Frankfurter Tor, an seiner Stelle wurde das Hölkesche Haus errichtet. (Universitäts-Bibliothek Kassel)

Die Friedrichstraße aus der selben Perspektive: das Hölkesche Haus (»Christian Hölke, Installationsgeschäft«), im Hintergrund über den Bäumen eine Kuppelfigur der Neuen Galerie (aus einem Prospekt von 1908).*MA
Während ich hier wohnte, passierte mir am Bau der neuen Gemäldegalerie, den ich in Gemeinschaft mit meinen [361] Freunden Fr. Potente und Aug. Zahn übernommen hatte, ein schweres Unglück, das in seinen Folgen verhängnisvoll für mich werden sollte. Bei der Arbeitsteilung, die wir unter uns getroffen hatten, übernahm ich die Aufrichtung des Baugerüstes, das ich in derselben Weise wie das s.Zt. am Welfenschloß in Hannover bestandene Gerüst, als hohes Mastbaum-Gerüst konstruierte. Die Aufstellung, die ich dem Zimmermeister Kurzrock übertragen hatte, war an einer Seite etwa zum dritten Teil schon erfolgt, die übrigen zwei Drittel aber waren noch nicht fertig abgebunden, die definitiven Verbindungen sollten gerade angebracht werden. Zu diesem Zwecke hatten sich die Zimmerleute am 25. Mai morgens eine 200 Zentner-Last Rüstbohlen hochgezogen und waren dabei, die provisorischen Abschwartungen durch definitive Zangenverbindungen zu ersetzen, als gegen 10 Uhr – es war sehr stürmisches Wetter – ein gewaltiger Windstoß die hoch oben auf dem unfertigen Gerüst lagernde Last Bohlen erfaßte, wodurch dasselbe seitwärts ins Wanken kam, umstürzte und den fertigen Teil mit sich niederriß. Ich war gerade in der Friedrichsstraße auf dem Wege zur Galerie, als ich den furchtbaren Krach des Zusammensturzes vernahm und, das Unglück ahnend, zur Baustelle eilte. Ein Entsetzen erfaßte mich bei dem Anblick, der sich mir bot, ich war vor Schreck wie gelähmt. – – –
Eine nähere Schilderung dieses furchtbaren Unglücks, dessen Augenzeuge ich jetzt sein mußte, mit allen den erschütternden Nebenumständen möge mir erlassen bleiben, es wird mir schwer, darüber zu schreiben, die Erinnerung daran macht mich immer von neuem erschauern. –
Die Folgen dieses Zusammensturzes waren schrecklich, es kamen fünf Zimmerleute zu Tode, drei wurden schwer verwundet und einige andere erlitten leichtere Verletzungen.
Wie ein Lauffeuer durcheilte die Schreckenskunde die Stadt und verursachte einen großen Menschenauflauf an der Unglücksstätte. Der Oberpräsident v. Bodelschwingh, der [362] Polizeidirektor Albrecht, der Staatsanwalt und andere Spitzen unserer Behörden trafen ein und sahen das entsetzliche Unheil. Kein Mensch hatte eine Ahnung davon, wodurch der Einsturz herbeigeführt sein konnte; ich selbst fragte, wie er nur möglich sein konnte – ich hatte an diesem Morgen die Leute selbst ja nicht bei der Arbeit gesehen, um zu wissen, ob sie Fehler gemacht hatten – ich konnte es nicht fassen – ich glaubte, den Verstand zu verlieren.
»Es kann doch nur an einem Konstruktionsfehler gelegen haben, daß das Gerüst dem Windstoß nicht widerstand – wer hat denn das Gerüst konstruiert und die Aufstellung zu leiten?« war die Frage, die der Oberpräsident an die bauleitenden Beamten richtete. Ich trat sofort vor und meldete mich freiwillig als der Angefragte; ich erklärte, selbst vor einem Rätsel zu stehen, und bezog mich bezüglich der Konstruktion auf eine Äußerung des Geh. Oberbaurats Giersberg aus Berlin, der wenige Tage vorher die Baustelle besucht und sich gerade über das Gerüst sehr beifällig geäußert hatte. Doch das konnte mich zunächst nicht retten; ich wurde aufgefordert, dem Polizei-Kommissar Eiffert auf das Polizeibureau zu folgen, um dort alle näheren Angaben über das Gerüst usw. zu Protokoll zu geben.
Der Weg dorthin durch die Menschenmenge war für mich geradezu entsetzlich; ich mußte Äußerungen aus der Menge mit anhören, die mir das Blut in den Adern erstarren machten – daß ich die zu Tode gekommenen Menschen auf dem Gewissen hatte, war bei vielen eine ausgemachte Sache. – – –
Nach dem Inquisitorium auf der Polizei eilte ich zu meiner armen Frau, die in größter Angst schon auf mich wartete – ich war in furchtbarer Aufregung. – –
Am andern Tag bekam ich vom Staatsanwalt eine Vorladung zum Augenscheinstermin auf der Unfallstelle – ich wurde als Angeklagter wegen fahrlässiger Tötung, meine beiden Sozien als sachverständige Zeugen vorgeladen. Ich war über die mir allein aufgebürdete Verantwortung außer [363] mir und der völligen Verzweiflung nahe – – der Leser kann sich denken, in welcher Gemütsverfassung ich bei diesem Termin war. – – –
Alle Trübsal, die dieser Unglücksfall für uns Unternehmer im Gefolge hatte, mußte ich allein ausbaden. Vor der Beerdigung der fünf Getöteten, die zu gleicher Zeit auf dem hiesigen Friedhof beerdigt wurden, hatte ich die jammernden Hinterbliebenen zu mir ins Haus geladen, um eine größere Geldsumme unter sie zu verteilen. – Wenige Tage darauf begannen die Untersuchungstermine auf der Staatsanwaltschaft im alten Renthof. Mein Untersuchungsrichter war der Kreisgerichtsrat Henning; auch der erste Staatsanwalt Wilhelm war oft zugegen, gemütlich seine lange Pfeife rauchend. Diesen beiden wohlwollenden Herren hatte ich es zu danken, daß ich allmählich ruhiger wurde; sie suchten meine Aufregung zu beschwichtigen, wenn ich durch Kreuz- und Querfragen oft ganz verwirrt war und mehr ins Protokoll aufgenommen wissen wollte, wie nötig war.
Außer gegen mich wurde einige Wochen später auch noch gegen den Zimmermeister Kurzrock die Untersuchung eingeleitet. Das Gerüst aber wurde ihm nicht wieder übertragen, es wurde genau in derselben Weise wieder aufgebaut, wie ich es konstruiert hatte, aber von einem Zimmermeister Dietrich, den ich mir aus dem Harz kommen ließ, weil die hiesigen Meister sich nicht an das Gerüst wagten. Dieser stellte das Gerüst auf, ohne daß irgend eine ernstliche Verletzung der darin beschäftigten Leute vorkam. – –
Infolge der furchtbaren Aufregungen und aller damit verbundenen steten Sorgen und Ängste war mein Nervensystem schwer erschüttert; ich kam dabei körperlich so sehr herunter, daß ich bald völlig abmagerte. Auf Anraten meines Freundes Dr. Krause machte ich im Herbst noch eine Reise an den Rhein mit meiner Frau, meiner Mutter und meiner Schwägerin Emma; ich wurde hierdurch wohl etwas abgelenkt, aber mein Zustand blieb derselbe. Ich atmete erst auf, als [364] ich im Januar den Beschluß der königlichen Staatsanwaltschaft erhielt, der dahin lautete, »daß die Angeklagten hinsichtlich der gegen dieselben erhobenen Beschuldigungen aus den von der Staatsanwaltschaft entwickelten Gründen außer Verfolgung zu setzen seien«. –
[14.10 Niedergeschlagenheit, Versuche zur Abhilfe]
Alles das, was ich persönlich bei diesem Unglücksfall durchkosten mußte, hatte so deprimierend auf meine Gemütsverfassung eingewirkt, daß ich in Gesellschaft oft ungenießbar war. Meine arme Frau hatte bei meinem reizbaren Wesen viel auszustehen, die Fliege an der Wand konnte mich schon ärgern, nichts war mir recht, ich litt an Angstgefühlen, trübe Gedanken beherrschten mich, ich mochte nichts essen, schlief nachts nicht, mußte viel weinen u.a. Mein Zustand war oft unerträglich, meinem ärgsten Feinde hätte ich die Qualen nicht gewünscht, die ich zuweilen auszustehen hatte. – –
Durch angestrengtes Arbeiten in meinem Geschäft suchte ich tagsüber gegen meine schwarzen Gedanken anzukämpfen, abends machte ich mir Beschäftigung im Haus. Ich baute damals einen Christgarten für meine Kinder zusammen, der von da ab alljährlich unter unserem Weihnachtsbaum stand und jetzt meinem ältesten Sohne zugefallen ist.
[14.11 Reiten als Therapie, Kur in Wolfsanger]
Im Sommer des folgenden Jahres schickte mich Krause nach Norderney, um vier Wochen an der See meine Nerven zu stärken. Ich habe dort eine sehr interessante Zeit verlebt, über die ich vieles schreiben könnte; mein nervöser Zustand hatte sich aber nur wenig gebessert. Ich versuchte nun alles mögliche, fing an zu kurpfuschern, alle Heilmittel gegen nervöse Leiden wendete ich an, fragte auch andere Ärzte um Rat – kurz, ich unterließ nichts, um eine Besserung herbeizuführen – aber es ging nur sehr langsam damit vorwärts, es schien alles wenig zu helfen.
Da riet mir ein befreundeter Arzt, Dr. Fröhlich, ich solle es doch mal mit dem Reiten versuchen, das Reiten habe schon vielfach in solchen Fällen gute Dienste getan; ich hätte gewiß Gelegenheit, mir ein Reitpferd zu halten. Und diesen Rat befolgte ich, mein »Mohrchen«, eines meiner Pferde, von [365] dem ich schon vorher erzählte, wurde tauglich befunden, zum Reitpferd zu avancieren, ich ließ es, nachdem ich mir ein feines Zaumzeug und Sattel angeschafft hatte, vom Bereiter Kempf zureiten und hatte meine helle Freude an dem schmucken Tier. Dann nahm ich Reitunterricht auf einer Reitbahn, die ich mir auf einer Wiese in meinem Garten im Freien einrichtete. Ich hatte vorher noch nie auf einem Gaul gesessen und mußte wie ein Rekrut bei der Kavallerie anfangen zu lernen, aber nach drei Tagen wollte ich schon nicht mehr; meine Knochen taten mir so fürchterlich weh, daß ich mich kaum bewegen konnte. Es half aber nichts; ob ich wollte oder nicht, ich mußte immer wieder auf den Gaul, bis ich nach einigen Wochen die Schmerzen des Reitfiebers überwunden hatte; da fing ich an, Gefallen an der Reiterei zu finden.
Auf den Wunsch meines Reitlehrers hatten sich noch mehrere mir schon bekannte Herren dem Reitunterricht auf meiner Sommer-Manege angeschlossen, so daß wir schließlich zu einem halben Dutzend Reiter beieinander waren. Jetzt machte mir die Sache viel Spaß; ich konnte morgens nicht früh genug aufs Pferd kommen.
Nach etwa zweimonatlichem Reiten auf meiner Wiese machten wir den ersten Ritt ins Freie bis hinter Obervellmar, von dem ich sehr erfreut zurückkam – zum ersten Male schmeckte mir das Frühstück wieder, das mir mein Frauchen vorstellte. Ich blieb nun dabei, machte täglich meinen Spazierritt und wurde allmählich wieder ein anderer Mensch.
Im folgenden Sommer ging ich mit meiner Frau, meiner Mutter und meiner Schwester Sophie zu einer sechswöchentlichen Kur in die Kaltwasserheilanstalt Wolfsanger, und diese Kur bekam mir sehr gut. Ich ließ mir mein Reitpferd alle paar Tage dorthin bringen, um die wohltuende Bewegung des Reitens nicht zu unterlassen.
So kam ich denn mit der Zeit wieder zu neuem Lebensmut und wurde wieder unternehmungslustiger.
[14.12 Tätigkeiten im Vorderen Westen, Umsiedlung dorthin]
Von dem Käufer der von mir gebauten Villa Jungk am Karthäuserweg, dem Brauereibesitzer Edward Habich aus [366] Boston, der – später als Kunstmäcen hier sehr angesehen – seinen dauernden Wohnsitz in unserer Stadt genommen hatte, wurde mir der Bau eines großen Wohnhauses an der neu angelegten Hohenzollernstraße, das jetzige Eckhaus Nr. 41 an der Kronprinzenstraße, übertragen. Habich mußte seinen Bauplatz etas vergrößern und war deshalb genötigt, eine angrenzende Parzelle von Aschrott zu kaufen; er beauftragte mich, das Kaufgeschäft mit A. zu vereinbaren. Aschrott, der damals noch sein Engros-Geschäft in Segeltuchen betrieb, hatte sein Kontor in seinem Hause an der unteren Königsstraße, neben der Synagoge. Das Geschäft für Habich kam zustande, aber nicht allein mit diesem – auch mit mir wurde ein Geschäft gemacht. A. verstand es, mich zu überreden, auch ein Grundstück von ihm zu kaufen, und so kam ich in den Besitz meiner Bauplätze an der Ecke der Hohenzollern- und Bismarckstraße. Ich war einer von den ersten, der sich im Hohenzollernbiertel anbaute, außer meinen Häusern Bismarckstraße 2 und 4 stand nur das Habichsche Haus und ein weiteres, das mein Vetter Hochapfel erbaut hatte, jenseits des Karthäuserweges.
Die zunehmende Bautätigkeit im Westen der Stadt veranlaßte mich, meinen Geschäftsbetrieb dorthin zu verlegen, und nachdem meine Häufer an der Bismarckstraße fertiggestellt waren, siedelte ich von der Wolfhager Straße zur Bismarckstraße über und nahm meine Wohnung in der ersten Etage des Eckhauses.
Nach Anlage der Orleansstraße, zu der ich einen erheblichen Teil meines Grundstücks kostenlos an die Stadt abtrat, veräußerte ich zu günstigen Preisen nach und nach meinen dortigen Grundbesitz, den ich in Bauplätze eingeteilt hatte, ebenso mein neuerbautes Haus mit allem Zubehör an der Wolfhager Straße. So kam ich in den Besitz von Mitteln, die ich in anderweiten Bauten wieder gut anzulegen suchte.
Wie ich schon im früheren erwähnte, hatte ich mich in Gemeinschaft mit Vetter Hochapfel an der oberen Sophienstraße angekauft. In dieser schönen freien Tage glaubten wir mit [367] der Erbauung von Einfamilienhäufern à la Bremen ein gutes Geschäft zu machen; wir bauten deshalb sieben aneinanderstoßende villenartige Häuser nach einem Eubellschen Projekt – die »sieben Raben«, wie sie getauft wurden.
Bei diesen Häusern fanden die fertigen Steinhauerarbeiten Verwendung, die ich vom Jagdschloß des Prinzen Heinrich von Hanau, am Burgberg bei Großenritte, zurücknehmen mußte. Ich hatte nämlich an diesem Schloßbau, der nach den Plänen der Leipziger Architekten Roßbach und Lüders erbaut wurde, die Ausführung der Maurer- und Steinhauerarbeiten übernommen, mußte aber die Arbeiten während des Baues wieder einstellen, weil die Fürstin von Hanau, des Prinzen Mutter, zum Weiterbau kein Geld mehr herausrücken wollte. Ein großer Teil der Steinhauerarbeiten war aber schon fertig und zum Teil schon versetzt, und diese auf meine Forderung mir in Anrechnung gebrachten Arbeiten schaffte ich nach Cassel, um sie an den oben genannten Häusern wieder zu verwerten. Aus den verbliebenen Resten des Schloßbaues ist nachher das »Gertrudenstift« erstanden.
[14.13 Umzug in die Sophienstraße, Familienleben]
Die Vermietung unserer Häuser, noch viel weniger ein Verkauf derselben erfolgte aber nicht so rasch, wie wir hofften. Die Casselaner zogen es im allgemeinen vor, in einer Etage zu wohnen, wie es zumeist auch heute noch der Fall ist. Um den Anfang zu machen, entschloß ich mich, weil sich die Gelegenheit bot, meine Wohnung in der Bismarckstraße zu vermieten, in eins der Häuser, in Nr. 3 der oberen Sophienstraße, zu ziehen.
Wir waren mit dem Wechsel unserer Wohnung sehr zufrieden; wir fühlten uns in unserem neuen Heim sehr glücklich; die schöne Tage, der freie herrliche Blick nach dem Habichtswald, der Garten vor dem Hause, den wir an der Bismarckstraße vermißten, waren Vorzüge dieser Wohnung, um die wir zu beneiden waren. Wir waren erfreut, daß unsere heranwachsenden Kinder im Garten und auf der Straße, die noch ganz ohne Verkehr war – die Verbindung [368] über die »Terrasse« nach dem Weinberg bestand noch nicht – sich ohne Gefahr herumtummeln konnten.
So fühlte ich mich, nun nicht mehr beim Geschäft wohnend, in dieser freien Tage, der schönen reinen Luft, auch wieder viel wohler und war glücklich und zufrieden. Wenn ich nach angestrengter Tätigkeit, nach allerlei Verdrießlichkeiten im Geschäft, müde und abgespannt heimkam, war es mir allemal eine wahre innige Herzensfreude, wenn ich mit meiner lieben Frau und unseren Kleinen in unserem behaglichen Heim Stunden der Erholung genießen konnte. An der Seite meines jugendfrischen blühenden Weibes, – um uns die lieben Kinder, fühlte ich mich jetzt so recht im Vollgenuß eines glücklichen Familienlebens und blickte mit froher Zuversicht in die Zukunft. – – – –
[14.14 Verwandte beider Seiten]
Was nun meine übrige Familie anlangt, so will ich hier einfügen, daß sich meine Brüder Conrad und August und ebenso meine Schwester Luise inzwischen verheiratet hatten. Unsere Mutter mit den übrigen Geschwistern zog nach dem Tode meines Vaters zu mir ins Haus, zuerst in die Wolfhager Straße, und als ich mein Haus dort verkauft hatte, räumte ich ihr die Parterre-Wohnung in dem Hause Bismarckstraße 4 ein. – Diese Wohnung war so geräumig, daß meine Mutter zwei Zimmer abvermieten konnte. Der erste ihrer Mieter war Prinz Alexander von Battenberg, der spätere Fürst von Bulgarien, welcher derzeit als Fähnrich der Darmstädter Dragoner die hiesige Kriegsschule besuchte. Die Mutter des Prinzen, die Prinzessin von Battenberg, hatte die Wohnung persönlich gemietet und meiner Mutter ans Herz gelegt, ein wachsames Auge auf ihren Sohn zu haben. Der Prinz war ein stattlicher, schöner, junger Herr, von einer bestrickenden Liebenswürdigkeit, dabei einfach und bescheiden in seinem Wesen. Den wohlgemeinten Ratschlägen meiner Mutter schenkte er gern Gehör. Er plauderte gern in zwanglos gemütlicher Weise mit meiner Mutter und auch mit mir oder meiner Frau, wenn wir mit ihm zusammen waren. Er [369] verschmähte es selbst nicht, sich in der Küche auf den Kohlenkasten zu setzen und zuzusehen und zu plaudern, wenn Mutter für ihn Kartoffelpfannkuchen backte. Gelegentlich bekam er auch Geschenke aus Rußland von seinem Paten, dem Kaiser Alexander, die er uns zeigte. Was ihm noch bevorstand, und welche hervorragende Rolle in der Geschichte er dereinst noch spielen würde – wer konnte das ahnen? In seiner ganzen Persönlichkeit spiegelte sich sein edler, vornehmer und bestimmter Charakter, dem jeder Schein zuwider war. Seine Entsagung nach einer ruhmvollen Laufbahn als erster Bulgarenfürst zeigt uns sein Bild von dieser Seite. – –
Am Schluß des Jahres 1874 hatten wir die Freude, Angehörige der Familie meiner Frau dauernd für unseren Familienkreis in Cassel gewonnen zu haben. Ich hatte nämlich meinem Schwager Hermann Meyer zugeredet, sich in Cassel zu etablieren und ein Hotel ersten Ranges, woran es sehr mangelte, zu gründen. Er folgte meinem Rat, pachtete zunächst das dem Maurermeister Losch gehörende, neuerbaute Eckhaus an der Museumsstraße und gründete das Hotel Royal, welches er am 1. Januar 1875 dem Verkehr übergab. Meine Frau war darüber besonders glücklich, weil sie mit ihren Schwestern Dora und Emma wieder einen näheren Verkehr unterhalten konnte – meine Schwägerin Emma war nämlich auch öfters hier – und so erlebten wir beide im Hotel Royal im ersten Jahre manche glückliche, vergnügte Stunde – – bis zum Winter. – – –
[14.15 Geburt des Sohnes Hermann, Tod der Ehefrau Sophie]
Am 20. November wurden wir durch die Geburt eines zweiten Söhnchens, unseres Hermann, hocherfreut; daß es diesmal wieder ein Junge war, stimmte uns Eltern besonders glücklich, und weil alles in normaler Weise gut verlaufen war, überbrachte ich noch am selben Abend meinen nächsten Anverwanden die Freudenbotschaft. Das Befinden der jungen Mutter war ebenso wie in den früheren Fällen ein vorzügliches; ich weidete mich mit Stolz und Freude an dem Mutterglück meiner lieben Frau, die schon nach wenigen Tagen wieder [370] frisch und blühend aussah und sich so wohl fühlte, daß sie scherzhaft meinte, sie könne schon aufstehen.
Am sechsten Tage aber trat plötzlich eine Wendung ein, meine Frau klagte über Schmerzen und hatte Fieber. Ich schickte zu Krause, der sofort kam und mir gleich, nachdem er sich über den Sitz der Schmerzen informiert hatte, bedenkliche Äußerungen machte; ich mußte sofort Eis holen lassen. Er riet mir, eine Festlichkeit, die wir abends im Casseler Reiterverein vorhatten, nicht mitzumachen – eine furchtbare Angst überfiel mich – – ich vermag es nicht, Näheres über die nun folgenden Tage zu schreiben – Großer Gott, wie schrecklich waren diese für mich, der ich plötzlich aus allen Himmeln gerissen wurde – – mein armes, liebes, herziges Weib war immer bei klarem Verstande – die Liebste ahnte es, in welcher Gefahr sie schwebte – entsetzlich – sie sprach mit mir, sie fühle es, daß sie von mir und den Kindern müsse – – ich mußte die Kinder an’s Bett bringen, die weinend die letzten Wünsche ihrer Mutter mit anhörten – – vor innerem Schmerz, den ich dabei zurückhalten mußte, schrie ich laut auf, wenn ich allein mit mir war – – es konnte doch nicht möglich sein, daß das liebe, junge, immer so gesunde und lebensfrohe Weib von mir und meinen Kindern genommen werden sollte. – Ich bat und flehte meinen Freund Krause, mir doch Helfer zu sein und meine arme Frau zu erretten – er kam täglich dreimal – zu meiner Beruhigung brachte er den Geheimen Sanitätsrat Dr. Stilling mit – aber alle ärztliche Kunft war vergebens – mir war der furchtbarste Schmerz, den ein Menschenherz zu tragen hat, nicht erspart – – meinen Gott bat ich inbrünstig, das schwere Geschick von mir abzuwenden – – er aber nahm das liebe, reine, seelensgute Wesen zu sich – am 9. Dezember gegen Mittag war sie droben bei ihm. – – – Bei völlig klarem Bewußtsein sprach sie bis kurz vor ihrem Hinscheiden über alles, was sie noch auf dem Herzen hatte – über die armen Kinder, die nun bald keine Mutter mehr hätten – ihr letzter Wunsch [371] war, daß ich ihre Schwester Emma bei den Kindern behalten solle – ja niemand anders – – – – – – – – –
Grau und trübe lag nun die Zukunft vor mir, nachdem mir mein Liebstes genommen war – aller Lebensmut war von mir gewichen –, meine ohnehin noch gedrückte Gemütsstimmung wurde immer düsterer – mir bangte oftmals vor mir selber – nur der Gedanke an meine vier Kinder half mir, mich wieder aufzuraffen – ich suchte Ablenkung und fand sie in angestrengter Arbeit, an der es mir gottlob nicht mangelte. – –
Die Sorge für mein Hauswesen und insbesondere für meine nun mutterlosen Kinder hatte meine Schwägerin übernommen; die Kinder, die schon immer mit vieler Liebe an ihrer Tante hingen, fühlten sich unter ihrer fürsorgenden sicheren Obhut wohl geborgen. – – Bis zum Sommer blieb Tante Emma bei uns, dann mußte sie zur Stütze meiner Schwiegermutter, die sie nicht entbehren konnte, wieder nach Hannover. An ihre Stelle trat meine Cousine Klara Scheurmann, die sich auch redlich bemühte, mir eine treue Stütze zu sein. – – – –
[14.16 Reise in den Schwarzwald und nach Paris]
Um mich von meinen trüben Gedanken abzulenken, veranlaßte mich mein Schwager Hermann Meyer im Spätsommer zu einer Reise in den Schwarzwald in Gemeinschaft mit ihm und meiner Schwägerin Dora. Wir waren bei gutem Wetter bis nach Baden-Baden gekommen und besuchten von dort aus die Ebersteinburg. Bei bedecktem Himmel waren wir in einem Landauer zur Burg hinauf gefahren, von der man einen herrlichen Blick hinab ins Murgtal haben sollte. Oben angekommen, sahen wir nichts von dem schönen Tal; alles war grau in grau wie Dreigroschenstapete und dabei begann es wie Bindfaden zu regnen, so daß wir umkehren mußten. Eine Änderung des Wetters schien für längere Tage nicht in Aussicht, und bei Regen im Schwarzwald zu reisen, hatte keinen Zweck. Ich schlug deshalb vor, direkt nach Straßburg zu reisen. Mein Vorschlag wurde angenommen. Ich [372] hatte die Reisekasse zu führen und ließ mir von der Wirtin das Kursbuch geben, um mich über den Abgang der Züge nach Straßburg zu informieren.
Ich fand einen geeigneten Zug, bis zu dessen Abfahrt genügend Zeit übrig blieb, um nach der Rückkehr ins Hotel uns reisefertig machen und zum Bahnhof fahren zu können. Die Ankunft dieses Zuges in Straßburg ergab sich aus dem Kursbuch, – dicht darunter stand die Ankunft in Paris. Ich machte scherzhaft die Bemerkung, daß wir bei dem Wetter am besten täten, gleich nach Paris zu fahren; – das wäre so was – meinten meine Reisekollegen.
Wir fuhren also zurück nach Baden-Baden, beglichen unsere Rechnung und fuhren zur Bahn. Beim Lösen der Billetts erkundigte ich mich so ganz beiläufig, ob man direkte Billetts nach Paris bekommen könnte, was bejaht wurde. Ich fragte nach dem Preis und ohne mich lange zu besinnen, forderte ich drei Billetts direkt nach Paris. In den Wartesaal zurückkehrend, präsentierte ich meinen Verwandten drei lang zusammenlegbare Fahrscheine mit den Worten: »Jetzt geht’s nach Paris!« Beide bekamen zuerst keinen gelinden Schrecken, ich setzte ihnen aber auseinander, daß wir am besten dabei führen – wer wüßte, ob wir sonst mal nach Paris kommen würden. Mein Schwager Hermann kannte Paris, wo er längere Zeit in Stellung war; er war der Sprache mächtig, und so waren wir bald einig. – Seine-Babel war unser nächstes Ziel.
Die Reise ging über Straßburg nach Avricourt, dort wurde die Grenze überschritten, und wir sollten die Pässe vorzeigen – wir hatten aber keine. Ein Glück war es, daß Schwager Meher gut parlieren konnte; er machte es dem Beamten klar, daß wir nur harmlose Touristen wären, die sich kurzerhand entschlossen hätten, einen Abstecher nach Paris zu machen. Wir zeigten unser Gepäck, Briefschaften, Visitenkarten und bezahlte Hotel-Rechnungen u.a. und kamen so glücklich über die Grenze.
[373] In Nancy hatten wir Aufenthalt und Gelegenheit, im Wartesaal etwas zu genießen. In dem überfüllten Saal war ein Mordsspektakel durch die lebhafte Unterhaltung französischer Soldaten, die vom Manöver kamen. Von Nancy ab kamen wir in einen französischen Zug, der uns direkt nach Paris führte. Die Personenwagen zweiter Klasse waren sehr unbequem; hart gepolsterte Sitze und steife, gerade Rücklehnen boten während der etwa zehnstündigen Fahrt und meist in der Nacht keine angenehme Ruhegelegenheit in dem außerdem vollbesetzten Coupé, in das wir uns mit noch einem russischen Ehepaar und drei kleinen Göhren, die sich nicht vor uns genierten, zu teilen hatten.
Gegen 11 Uhr vormittags trafen wir in Paris ein; Quartier nahmen wir im Grand-Hotel in der »cinquième Etage«. Über das, was wir während der etwa sieben Tage unseres Aufenthaltes in der Riesenstadt alles erlebt hatten, näher zu berichten, würde zu weit führen. Unter der Führung eines stadtkundigen »Fouriers« – es war ein »Sachse«, den wir im Louvre trafen und welcher uns seine Dienste anbot – sahen wir vom frühen Morgen bis zum späten Abend so viel des Interessanten, wie es wohl mancher, der sich viele Wochen in Paris aufhält, nicht zu sehen bekommt; für meine Schwägerin war es oft zu viel, wir mußten manche Exkursion allein unternehmen. Von den unter der Schreckensherrschaft der Kommune zerstörten Prachtbauten fanden wir mehrere Ruinen noch in der ursprünglichen Verfassung, u.a. die Tuillerien, an deren zerstörten Innenwänden, Malereien, Tapeten usw. noch sichtbar waren, St. Coud u.m. Auch auf Versailles mit seinen Sehenswürdigkeiten wurde ein Tag verwandt. Ich war aber von Versailles sehr enttäuscht, der berühmte Park war sehr verwahrlost. Auf der Rückreise von Paris nahmen wir zwei Tage Aufenthalt in Metz und besahen uns die Schlachtfelder in der Umgebung der Festung, mit den Massengräbern, Friedhöfen und Denkmälern, erschütternde Zeugen des mörderischen Krieges.
[374] Das Resultat dieser Reise war insoweit ein günstiges zu nennen, daß ich von meinen trüben Gedanken mehr abgelenkt wurde; meine Umgebung hatte wohl auch von jetzt ab weniger wie seither unter meiner deprimierten Stimmung zu leiden – ich wurde wieder verträglicher. – – – –
[14.17 Tod der Mutter, Heirat mit Schwägerin Emma Buerdorf]
Das kommende Weihnachtsfest, dem ich nun allein mit meinen mutterlosen Kindern in wehmütigem Gedenken an frühere glückliche Tage schweren Herzens entgegensah, ließ in mir den Entschluß reifen, meinen lieben Kindern die fehlende Mutter zu ersetzen. Ich reiste am zweiten Weihnachtstage nach Hannover und hielt um die Hand meiner Schwägerin an; sie willigte freudig ein, den Kindern, die sie so sehr liebte, eine sorgsame Mutter und mir eine treue Lebensgefährtin zu sein. – –
Am 8. Februar, einige Wochen, nachdem nach langem, schwerem Leiden meine Mutter am 24. Januar gestorben war, wurden wir auf dem Döhrener Turm im engsten Familienkreise in Gegenwart meiner Schwester Marie und meiner drei ältesten Kinder in stiller Feier getraut. – – –
Es war eine schwere Aufgabe, an die meine Frau herantrat; bei meinem hochgradig nervösen Zustand, der noch lange anhielt, hatte sie mit mir viel Geduld und Nachsicht zu üben. Wie sie aber ihre übernommenen Pflichten erfüllte, wie mir an ihrer Seite und durch ihre treue, aufopfernde Pflege wieder Gesundheit, Liebe und damit eine glückliche Häuslichkeit erblühte, dafür geben die nunmehr zurückgelegten dreiunddreißig Jahre unserer Ehe ein beredtes Zeugnis. – –
[14.18 Sohn Karl, Sohn Fritz, Aufschwung des Bauens]
Am 4. März 1878 wurde unser Sohn Karl geboren; wir wohnten noch in der oberen Sophienstraße, zogen aber bald darauf wieder in mein Haus in der Bismarckstraße 2, das ich durch einen Anbau an der Hohenzollernstraße vergrößert hatte. Am 16. Oktober des folgenden Jahres erblickte dort unser Fritz das Licht der Welt. – – –
Im Laufe der siebziger Jahre wurden die ersten großen Staatsbauten unter dem preußischen Regime ausgeführt, [375] u.a. das Postgebäude am Königsplatz, das Justiz- und Regierungsgebäude, die Reichsbank, die Kunstgewerbeschule usw. Die Stadt Cassel machte schon vorher den Anfang mit ihren stattlichen Schulgebäuden, dem Realgymnasium an der Schomburgstraße und der höheren Töchterschule am Ständeplatz.
Die Privatbautätigkeit entwickelte sich mächtig; auch ich habe eine erhebliche Anzahl Privathäuser nach eigenen Entwürfen ausgeführt; damals war es noch nicht wie heute allseitig Gebrauch, die technische Leitung von der praktischen Ausführung zu trennen; beides blieb meist in einer Hand. Zu den Privatbauten, die mir übertragen wurden, hatte ich auch stets als Architekt die Entwürfe zu liefern. Außerdem baute ich für alleinige Rechnung wie auch in Gemeinschaft mit meinem alten Freunde Eduard Habich die Häuser an der Hohenzollern- und Kronprinzenstraße, ferner mit Ernst Scheldt die Villen an der von uns angelegten Nahlstraße usw.
Eine wesentliche Änderung im inneren Stadtgebiet trat ein durch die Verlegung der alten Infanteriekaserne nach dem damals noch weit außerhalb der Stadt liegenden Aschrottschen Gelände an der verlängerten Hohenzollernstraße. Die Frankfurter Baubank war für dies Geschäft gewonnen worden; sie erbaute die neue Infanteriekaserne und erhielt als Gegenwert das gesamte Territorium der alten Kaserne, das in die Bauquartiere an der unteren Königsstraße umgestaltet wurde. Mein Vetter Hochapfel wurde als Vertreter der Frankfurter Baubank mit der Leitung dieses Geschäftes betraut.
[14.19 Gründung einer Firma mit Freunden, Bestattung des Kurfürsten]
Hier klicken (→), um zu einem Scan der Graphik zu kommen. (Universitäts-Bibliothek Kassel)
Gegen Ende des Jahres 1872 traten wir vier Freunde, Seidler, Lauckhardt, Hochapfel und ich, zusammen und gründeten unter der Firma Seidler u. Co. unsere Ziegelei. Unsern gemeinschaftlichen Freund Adolf Cornelius, meinen Kindern als Onkel C. bekannt, machten wir zu unserm Administrator.
Unter den besonderen Ereignissen aus den siebziger Jahren, die für Cassel bemerkenswert sind, gedenke ich der Bestattung unseres hochseligen Kurfürsten, der am 6. Januar [376] 1875 in Prag starb. Seinem Wünsche gemäß fand er seine letzte Ruhestätte auf dem alten Friedhofe neben den Ruhestätten seiner Mutter, der Kurfürstin Auguste, und seiner Schwester, der Prinzeß Caroline. An der feierlichen Einholung seiner Leiche vom hiesigen Bahnhof beteiligte sich die Casseler Einwohnerschaft, die vom Bahnhof bis zum Friedhof dichtgedrängt in den Straßen Spalier bildete (s. Abb.), um mit wehmütigen Empfindungen dem fern von seinen ehemaligen Landeskindern im Exil gestorbenen angestammten Landesfürsten auf seinem letzten Weg noch einen stillen Gruß zu entbieten. Es gewährte einen feierlich ernsten Anblick, wie der mit prachtvollen Kränzen überladene Leichenwagen, bespannt mit acht Isabellen in Trauerschmuck, durch die schweigende Menge zog. Wir Casselaner sahen zum ersten Male diese stolzen Tiere wieder, die in früheren Jahren so oft in den Straßen unserer Stadt zu sehen waren, wenn sie im Vier- und Sechs-Gespann dem Kurfürsten und seiner Gemahlin bei ihren Ausfahrten dienten. – –
[Zwischen den Seiten 376 und 377:]
[14.20 51. Tagung der Naturforscher und Ärzte, Besuch des Kaisers]
Im Nachsommer des Jahres 1878 tagte in Cassel die 51. Versammlung deutscher Naturforscher und Ärzte, an der wohl über anderthalbtausend Besucher aus allen Gauen Deutschlands teilnahmen. Für diese hochansehnliche Versammlung fehlte es bei den sehr beschränkten Saalverhältnissen in der Stadt an einem genügend großen Raum zur Abhaltung sowohl der gemeinschaftlichen Versammlungen wie der größeren Festlichkeiten. Man entschloß sich deshalb, die Faßhalle der Hessischen Aktienbrauerei in Wehlheiden zu einer Festhalle umzugestalten, wozu mir als Mitglied des Lokalausschusses der Auftrag erteilt wurde.
Das Fest nahm einen glänzenden Verlauf, der noch besonders dadurch erhöht wurde, daß gegen den Schluß des Festes am 15. September Kaiser Wilhelm hier eintraf, um auf unserer Wilhelmshöhe zur Nachkur einen längeren Aufenthalt zu nehmen, nachdem er infolge des Nobilingschen Attentats schmachvollen Angedenkens in Gastein und Teplitz [377] die Kur gebraucht hatte. Ergreifend war es mitanzusehen, wie der immer noch leidend erscheinende Kaiser, den rechten Arm in einer schwarzen Binde tragend, ernsten, aber milden Antlitzes durch die vieltausendköpfige Menge fuhr, die ihm dabei tief bewegt zujubelte. Ich selbst war so sehr ergriffen, daß ich ein inneres Schluchzen nicht unterdrücken konnte, wie ich den schwer geprüften Monarchen an mir vorbeifahren sah, und wie mir, so ging es wohl vielen Zuschauern, die ihre Tränen nicht zurückhalten konnten.
Daß der Kaiser nach der Rückkehr in sein Land unsere Wilhelmshöhe zuerst aufsuchte, wurde als ein Vorzug betrachtet, auf den wir nicht wenig stolz waren. Die Kaiserin war schon vor dem Kaiser eingetroffen, der Kronprinz kam einige Tage später; ihm folgte eine große Anzahl Fürstlichkeiten, die an den Kaisermanövern, die in der Nähe Cassels abgehalten wurden, teilnahmen. Wie es nicht anders zu erwarten war, hatten die Casselaner ihre Stadt wie immer festlich aufs reichste geschmückt, an verschiedenen Stellen waren Ehrenpforten errichtet usw. Dem Kaiser wurde nach einigen Tagen, als er die Stadt besuchte, ein imposanter festlicher Empfang bereitet, der sich in ähnlicher Weise wie bei früheren Empfängen abspielte.
Eine ganz besondere Ovation aber brachte ihm Sonntags nach dem Gottesdienst die gesamte Casseler Schuljugend, die festlich gekleidet, mit Bannern und Blumen geschmückt, vor dem Palais am Friedrichsplatz aufmarschierte. Die Schülerinnen der Töchterschulen waren sämtlich in Weiß gekleidet mit blauen Schärpen, einem Kornblumenkranz in den Haaren, und ein gleiches Blumenbukett in der Hand haltend. Es war die erste offizielle Feierlichkeit, an der auch unsere beiden Töchterchen freudig teilnahmen. Das Kaiserpaar, das vom Balkon des Palais den Aufzug der Jugend mit ansah, wurde mit endlosem Jubel begrüßt, der sich noch steigerte, als der Kronprinz zwischen ihnen erschien, der eine der kleinen Schülerinnen, die zur Überreichung eines Festgedichtes und [378] Blumenbuketts an das Kaiserpaar abgeordnet war, auf dem Arm trug. Es war ein rührendes, mir unvergeßliches Bild.
Am 20. September fand in der Ebene bei Wabern die Kaiserparade statt, bei welcher der Kaiser sich zum ersten Male nach dem Attentat seinen Truppen wieder zeigte, deren Fronten er zu Pferde abritt. Um ihm mit seinem verletzten Arm das Reiten zu ermöglichen, hatte er sich alsbald nach seinem Eintreffen auf Wilhelmshöhe im Aufsitzen aufs Pferd geübt. Sein Reitpferd wurde dabei in eine ganz schmale Grube gestellt, zu der eine schiefe Ebene führte, auf welcher das Pferd in die Grube hinabgeleitet wurde, das nun mit dem Rücken noch so viel über das Terrain in die Höhe ragte, daß der Kaiser, ohne beim Aufsitzen in die Höhe zu steigen, bequem in den Sattel kommen, und nachdem das Pferd auf der andern hinauf führenden schiefen Ebene aus der Grube herausgeleitet war, seine Reitübungen in der Ebene vornehmen konnte.
Zur Kaiserparade und dem Tags darauf folgenden Manöver war ich mit meiner Frau im eigenen Wagen früh Morgens nach Wabern abgefahren, wo ich mir vorher Quartier bestellt hatte. Ich hatte mein Reitpferd mit eingespannt und mein Sattelzeug auf dem Kutschbock verpackt. Im Dorfe Obermöllrich wechselte ich mein Reitpferd mit einem Pferde des dortigen Bürgermeisters – eines Verwandten meines Werkmeisters Fleck – das zu meinem andern Wagenpferd einigermaßen paßte, bestieg mein Pferd und konnte nun alle militärischen Schauspiele hoch zu Rosse mit ansehen, und zwar immer in nächster Nähe der maßgebenden Stellen. Diese Vergünstigung genoß ich durch meine Bekanntschaft mit der Gendarmerie. Der Brigadier der Gendarmerie, Oberst Pilgrim, war nämlich einer meiner Mieter, und das Gendarmeriebureau war mit seiner Wohnung verbunden; dadurch kannten mich die meisten Gendarmen. Auch der im Manöver mitwirkende General von Bychelberg, den ich im Felde traf, war Mieter meiner Villa auf der Terrasse. Diesen Beziehungen hatte ich es zu verdanken, daß ich überall ungehindert [379] hinreiten und der Wagen mit meiner Frau den königlichen Wagen folgen konnte, so daß wir uns immer in der nächsten Nähe der Allerhöchsten Herrschaften befanden und manche interessante Episode miterlebten.
Am 25. September verließen die Majestäten Wilhelmshöhe, nachdem ihnen ein Flor Casseler junger Damen, etwa 50 an der Zahl, am Vormittag vor der letzten Abfahrt zum Manöver eine Ovation auf dem Bahnhof dargebracht hatten, bei der durch mehrere Damen, darunter Fräulein Petersen und Fräulein Hupfeld, Buketts mit Ansprachen in poetischer Form überreicht wurden.
So endeten diese Kaisertage, an die sich für mich vielfach interessante Erinnerungen knüpfen.
[14.21 Gründung des Fremdenverkehrsvereins]
Es war eine auffällige Erscheinung, daß, trotzdem Cassel und Wilhelmshöhe durch die Naturforscherversammlung, den Aufenthalt der kaiserlichen Herrschaften und die Kaisermanöver im Mittelpunkt der Ereignisse in Deutschland stand – in der auswärtigen Presse nur wenig Notiz von all diesen gewiß bemerkenswerten Vorgängen genommen wurde. Bei viel unbedeutenderen Anlässen an anderen Orten erschienen Leitartikel mit Illustrationen – Cassel aber blieb wie immer, auch diesmal völlig unberücksichtigt.
Dieser Umstand gab die Veranlassung dazu, daß im Hotel Royal eine Besprechung stattfand, an der mein Schwager Hermann Meyer, Buchdruckereibesitzer Adolf Gotthelft, Buchhändler Th. Kay und ich teilnahmen, mit der Absicht, durch eine Sammlung in der Bürgerschaft Mittel aufzubringen, um ausführliche Mitteilungen mit den entsprechenden Illustrationen über die genannten Ereignisse in den gelesensten deutschen Zeitschriften zu veröffentlichen. Das Ergebnis der Sammlung, die ich übernahm, fiel über alles Erwarten günstig aus, es kamen über 17.000 Mark zusammen, ein Kapital, das den Fonds zur Gründung eines Vereins, des »Fremdenverkehrsvereins« bildete, zu dessen erstem Vorsitzenden ich gewählt wurde. – – –
[14.22 Erwerb des Hanauischen Palais’]
[380] Ehe ich es bei diesen Erinnerungsbildern genügen lasse, mit denen ich nur Schilderungen aus meinen früheren Jahren zu bringen beabsichtigt habe, will ich noch kurz darüber berichten, wie es kam, daß ich mich in Wilhelmshöhe ansiedelte, und welcher Umstand mir hierzu verhalf!
Bei Gelegenheit einer zufälligen Begegnung im Herbst 1880 mit Dr. Renner, dem Rechtsbeistand und Vermögensverwalter der Fürstin von Hanau, erkundigte ich mich, ob das Palais der Fürstin an der Königsstraße, das er zu verkaufen hatte, verkauft sei. Ich hatte ein Interesse daran, mich über den Verkauf dieses Besitztums zu informieren, weil ich für einen Reflektanten, der angab, dieses Palais an Hand gekauft zu haben, ein Projekt zum Umbau desselben gemacht hatte, dessen Ausführung mir übertragen werden sollte. Mein Auftraggeber aber hatte sich, nachdem ich das Projekt längst fertig gestellt hatte, nicht mehr bei mir sehen lassen, und so benutze ich das gelegentliche Zusammentreffen mit Dr.R., um nach dem Stand der Sache zu fragen. R. teilte mir mit, daß der Kauf gar nicht zustande gekommen sei; das Angebot wäre so erheblich unter der gestellten, schon sehr mäßigen Forderung, die er mir nannte, geblieben, daß er die Verhandlungen abgebrochen hätte. Ich entgegnete, daß mein Auftraggeber mir eine viel höhere Ankaufssumme genannt habe; das sei Schwindel gewesen, meinte R., zu dem mir von ihm genannten Preise könne ich das Palais jederzeit haben, wenn ich näheres erfahren wolle, solle ich bei ihm vorkommen.
Die Sache ging mir durch den Kopf; ich selbst hatte den Wert des kostbaren Besitztums, das ich durch eine genaue Besichtigung näher kennen gelernt hatte, viel höher taxiert. Ich trug mich mit dem Gedanken, den Kaufmännischen Verein, der damals ein eigenes Lokal suchte, für den Ankauf zu interessieren und mir den Umbau zu sichern. Mit einigen Mitgliedern des genannten Vereins traf ich im Hotel Royal zusammen und besprach diese Angelegenheit mit ihnen, fand auch sehr viel Meinung dafür. Einer derselben – es war einer [381] meiner Bauherren – Adolf Gotthelft – rief mich aber zur Seite und riet mir, doch unbesorgt das Geschäft allein zu machen, es würde mir nicht schwer fallen – und ich folgte seinem Rate.
Andern Tags ging ich mit dieser Absicht zu Dr. R., der sich freute, daß ich dem Ankauf näher treten wollte. Er stellte die Bedingungen so günstig für mich, daß mir der Kauf ermöglicht wurde, und so wurde ich ganz unverhofft Besitzer des Hanauischen Palais, das jahrelang vergeblich feilgehalten war.
In welcher Weise ich das Palais umgebaut habe, ist bekannt. Es war mir dabei besonders darum zu tun, dem längst gefühlten Bedürfnis nach einem vornehmen Restaurant Rechnung zu tragen, und so entstand das Palais-Restaurant, das längere Jahre hindurch unter Leitung meines Schwagers Carl Meyer die erste Stelle unter den hiesigen derartigen Etablissements einnahm. Hierzu kamen die fünf Läden und herrschaftliche Wohnungen, so daß mir das neue Besitztum eine gute Rente sicherte – ich kam in die Lage, wieder etwas Neues unternehmen zu können.
[14.23 Gründung der Villenkolonie Mulang]
Schon lange war es mein Wunsch, mich in Rücksicht auf meine gesundheitlichen Verhältnisse, die immer noch sehr zu wünschen übrig ließen, auf Wilhelmshöhe anzukaufen; diesen Wunsch konnte ich mir jetzt erfüllen. Mein Freund Julius Siebert sowie mein Vetter Hochapfel hatten sich bereits oben angekauft und sich schöne Sommersitze am Walde geschaffen.
Mein Plan ging aber weiter; ich beabsichtigte, nach dem System der englischen Cottages eine Anzahl Landhäuser, zu einer Kolonie vereinigt, gleichzeitig zu erbauen; und dazu mußte ich ein entsprechendes Bauterrain zu erwerben suchen. Als solches schien mir das dem Pensionshaus gegenüber liegende Domänenland besonders geeignet, von welchem ich die Erwerbung eines Teiles bei der Königlichen Domänenverwaltung nachsuchte. Zu gleicher Zeit war aber noch ein anderer Käufer, Kaufmann C. Schwarz, der auf dasselbe Grundstück reflektierte, mit einem Gesuch eingekommen, und um uns [382] gegenseitig keine Konkurrenz zu machen, erwarben wir gemeinschaftlich zwei Hektare des an die Parkanlagen angrenzenden Landes, die wir je zur Hälfte unter uns teilten.
Auf diesem Terrain legte ich für unsere gemeinschaftliche Rechnung eine neue Straße, die jetzige Burgfeldstraße, bis zur halben Länge an und erbaute an dieser meine ersten Villen, und zwar im Jahre 1881 drei (siehe Abbild.) und nach deren Vollendung die vierte; damit war der Anfang zur eigentlichen Villenkolonie gemacht.
[Zwischen den Seiten 382 und 383:]

Die ersten verkäuflichen Villen der Villen-Kolonie in Wilhelmshöhe.
Welche Entwickelungsperiode diese Kolonie während der bis heute verflossenen 26 Jahre durchgemacht hat, das lehrt der Augenschein. Da, wo ehedem Feld- und Wiesenland, ohne Baum und Strauch, das waldreiche Parkgebiet nur nüchtern umrahmte, bietet jetzt der Luftkurort Wilhelmshöhe mit seinen von üppigen Gärten umgebenen freundlichen Villen ein reizvolles Bild. – Dank der Tatkraft, Opferfreudigkeit und Eintracht seiner eingesessenen Bewohner ist hier ein Gemeinwesen entstanden, das in der Umgebung Cassels faum zum zweitenmal seinesgleichen finden dürfte.
Wenn auch die Villenkolonie politisch zur früheren Gemeinde Wahlershausen gehörte, so bestand doch zwischen dieser und der Kolonie keine Interessengemeinschaft. Alles, was die Kolonie zu ihrer Fortentwickelung benötigte, mußte sie zumeist aus sich selbst heraus schaffen. Obgleich die Gemeinde einen großen, wenn nicht den größten Teil der Steuern aus der Kolonie bezog, hatte sie keine oder nur geringe Mittel zu Aufwendungen in der Kolonie übrig. Trotzdem die Kolonie mit ihren Bedürfnissen wie eine melkende Kuh für die Wahlershäuser Bevölkerung eine reiche Einnahmequelle bildete, verhielt sich diese bei den Wahlen zur Gemeindevertretung geradezu feindselig gegen die Kolonie; sie ließ nur je einen Vertreter in den Gemeinderat und in den Gemeindeausschuß zu; eine längere Zeit dauernde Spannung in den Beziehungen zwischen beiden Teilen war die Folge hiervon.
Das waren Zustände, unter denen die Kolonie sehr zu leiden hatte, und die eine gänzliche Lostrennung von der räumlich getrennt liegenden Muttergemeinde wünschenswert machte; alle Versuche in dieser Richtung waren jedoch vergeblich. [383] Die Kolonie aber wahrte sich dadurch eine gewisse Selbständigkeit, daß sie, unabhängig von der alten Gemeinde, eine Genossenschaft bildete, für deren Rechnung das gesamte Kanalnetz mit Kläranlage zur Entwässerung und die umfangreiche Quellwasserleitungsanlage geschaffen wurde. Um die Bildung dieser Genossenschaft hat sich in hervorragender, tatkräftiger Weise unser damaliger erster Genossenschaftsvorsteher Julius Siebert im Interesse der Kolonie verdient gemacht, dem später Kaufmann Louis Reuse und nach diesem Oberst Mende als bewährte Nachfolger im Amte nacheiferten. Der beharrlichen Tatkraft eines seiner Mitbegründer, des Direktors Gustav Henkel, verdankt die Kolonie die Einführung der elektrischen Beleuchtung, ein wichtiger Faktor, der zur Entwickelung der Kolonie wesentlich beitrug. Und so hat sich die Kolonie fast ganz allein durch eigene Kraft entwickelt, gehalten und gehoben, bis zu dem Zeitpunkt, wo durch das neue Kommunalwahlgesetz eine unserer Steuerkraft entsprechende Vertretung in den Gemeindebehörden Sitz und Stimme erhielt; von nun ab besserten sich auch die Beziehungen zwischen beiden Teilen der Gemeinde. – – – –
Seit mehreren Jahren gehören wir nun zu Cassel; die Gemeinde Wahlershausen mit der Villenkolonie Wilhelmshöhe hat ihre Selbständigkeit der Großstadt opfern müssen – ob es ein Vorzug sein wird, diesem großen Gemeinwesen anzugehören – wer kann es wissen – bis jetzt merkt man im neuen Stadtteil Cassel-Wilhelmshöhe noch nichts davon – hoffen wir das beste!
Doch – – ich gerate in die neuere, ja in die neueste Zeit hinein – während sich diese Erinnerungsbilder lediglich auf frühere Jahre beschränken sollten; – deshalb will ich es hierbei bewenden lassen und schließen. Der Zweck, einen Teil meiner müßigen Zeit ausgefüllt zu haben, meine Angehörigen über manches aus meiner Vergangenheit, was ihnen bisher noch unbekannt war, aufzuklären und anderen Lesern vielleicht eine kleine Unterhaltung zu bieten – er möge damit erfüllt sein!
* * *
Erleben in Erinnerungsbildern
Beitrag eines Baumeisters zu Kassels historischem Konterfei – Gründer des Verkehrsvereins
»Eine hingebende, offene und gesellige Natur, dabei schaffensfreudig und für alle Schönheiten in Kunst und Natur empfänglich, für den Nächsten und die Allgemeinheit besorgt, ohne nach Anerkennung und nach Ämtern zu streben – das war Heinrich Schmidtmann!« So schrieb vor 50 Jahren eine Kasseler Zeitung zum Nachruf, als am 28. April 1921 ein Kasseler Bürger gestorben war, der im Laufe seines Lebens seine Vaterstadt nicht nur durch zahlreiche Bauwerke bereichert und intensiv am öffentlichen Leben teilgenommen hatte, sondern der auch durch Niederschrift seines eigenen Erlebens der Nachwelt ein Bild vom alten Kassel vermittelte.
Heinrich Schmidtmann (s. unser Bild aus seinen letzten Jahren) wurde am 22. Februar 1842 im großväterlichen Gasthaus »Zum halben Mond« in der Müllergasse geboren. Während seiner Ausbildungszeit als Steinhauer besuchte er die Bauhandwerkerschule und die Kasseler Kunstakademie, als Geselle die Baugewerkschule Holzminden. Er war Bauführer in Hannover, hörte dort Vorlesungen am Polytechnikum und machte sich da auch selbständig.
Als Schmidtmann 1866 nach Kassel zurückkehrte, bot sich dem Architekten und Baumeister hier ein weites Arbeitsfeld, besonders in dem wirtschaftlichen Aufschwung nach dem Krieg 1870/71. Schmidtmann baute zahlreiche Häuser im vorderen Westen, in der Bismarckstraße, der Hohenzollernstraße, der Kronprinzenstraße, die sog. »Sieben Raben« in der oberen Sophienstraße. Anlage und Ausbau neuer Straßenzüge, der Umbau des alten Palais Hanau zum Palaisrestaurant (später Hackerbräu, Obere Königsstraße 30), die Errichtung der ersten Häuser der Villenkolonie Wilhelmshöhe (s.a. Blick zurück 234), die Beteiligung am Aufbau der Gemäldegalerie sind u.a. als seine Werke zu nennen.
Besonders verdient machte sich Schmidtmann um die Gründung des Kasseler Fremdenverkehrsvereins. In seinen Erinnerungen schreibt er darüber:
»Es war eine auffällige Erscheinung, daß – trotzdem Cassel und Wilhelmshöhe durch die Naturforscherversammlung, den Aufenthalt der kaiserlichen Herrschaften und die Kaisermanöver im Mittelpunkt der Ereignisse in Deutschland stand – in der auswärtigen Presse nur wenig Notiz von all diesen gewiß bemerkenswerten Vorgängen genommen wurde. Bei viel unbedeutenderen Anlässen an anderen Orten erschienen Leitartikel und Illustrationen – Cassel aber blieb wie immer auch diesmal völlig unberücksichtigt.«
»Dieser Umstand gab die Veranlassung dazu«, berichtet Schmidtmann weiter, »daß im Hotel Royal eine Besprechung stattfand, an der mein Schwager Hermann Meyer, Buchdruckereibesitzer Adolf Gotthelft, Buchhändler Th. Kay und ich teilnahmen mit der Absicht, durch eine Sammlung in der Bürgerschaft Mittel aufzubringen, um ausführliche Mitteilungen mit den entsprechenden Illustrationen über die genannten Ereignisse in den gelesensten deutschen Zeitschriften zu veröffentlichen. Das Ergebnis der Sammlung, die ich übernahm, fiel über alles Erwarten günstig aus; es kamen über 17.000 Mark zusammen, ein Kapital, das den Fonds zur Gründung eines Vereins ... bildete, zu dessen erstem Vorsitzenden ich gewählt wurde.«
Das war im Jahre 1879 die Geburtsstunde des bis auf den heutigen Tag bestehenden Kasseler Verkehrsvereins.
Obwohl Schmidtmann sich seiner mangelnden schriftstellerischen Übung bewußt war, ließ er doch – auf Drängen von Verwandten und Freunden – die Eindrücke seines vielbewegten Lebens in Buchform erscheinen. 1907 (und 1910 in zweiter Auflage) kamen seine »Erinnerungsbilder« heraus, denen auch die obigen Sätze über den Verkehrsverein entnommen sind. In anschaulicher Weise entwarf Schmidtmann hier ein Bild des Kasseler Lebens sowie der Entwicklung der Stadt in der zweiten Hälfte des vorigen Jahrhunderts.
»Mögen meine Schilderungen dem Leser so recht vor Augen führen«, so schrieb Schmidtmann im Vorwort, »wie anspruchslos und bescheiden die früheren Verhältnisse waren im Vergleich zu den heutigen – möge dieser Vergleich auf der anderen Seite aber auch dartun, was aus Cassel seit dem Beginn des von mir geschilderten Zeitabschnitts geworden ist ...«
Tatsächlich ist das Schmidtmannsche Buch bis auf den heutigen Tag für den Kasselaner, der in die Vergangenheit seiner Stadt blicken will, eine glückliche Fundgrube. Schmidtmann – durchaus kein besonders schreibgewandter Mann – faßte den Mut, sein Erleben in und mit Kassel zu Papier zu bringen. Wie wichtig das war, kann besonders heute empfunden werden, da der letzte Krieg so viele Erinnerungsstücke vernichtet, hat. Das Schmidtmannsche Vorbild möge daher auch die alten Kasselaner von heute anregen, ihr Wissen und Erleben um Kassel aus ihrer Zeit festzuhalten. Hier als Berater, Helfer und schließlich Bewahrer bietet sich das Kasseler Stadtarchiv an, dessen Anliegen es u.a. ist, in der genauen Kenntnis von der historischen Entwicklung unserer Stadt keine Lücken klaffen zu lassen.
Daß Schmidtmann etwas Wesentliches über seinen Beruf hinaus getan hatte, empfand man in Kassel besonders, als er vor 50 Jahren starb. Außerordentlich groß war die Beteiligung aus allen Kreisen der Bürgerschaft bei der Beerdigung am 2. Mai 1921 auf dem Hauptfriedhof. Pfarrer Stein hielt eine zu Herzen gehende Rede über das Bibelwort: »Ein treuer Mann wird stets gesegnet.«
Fotos: Friedrich Forssman, 14.3.2021.
Dank an Stefan Lange (→) für den Hinweis auf die Grabstelle, Hauptfriedhof, Parzelle 13.
Inschriften auf dem Grab:
Hier ruht in Gott
Heinrich Schmidtmann
geb. den 22. Febr. 1842
gest. den 28. April 1921.
Sophie
Schmidtmann
* 23.2.1850 | †
9.12.1875
[geb. Buerdorf, erste Frau von Heinrich Schmidtmann]
Christian
Schmidtmann
* 2.3.1872 | † 23.10.1955
Ilse Schmidtmann
* 19.4.1882 | † 7.7.1966
[Christian, »Christel«, ältester Sohn von Sophie; Christians Frau Ilse, geb. Wolff aus Potsdam]
Emma
Schmidtmann
* 25.11.1848 | † 22.12.1933
[geb. Buerdorf, zweite Frau von Heinrich Schmidtmann, Schwester der ersten Frau Sophie]
Almut Schmidtmann
* 21.7.1952 | † 6.11.1979
Hans-Albrecht Schmidtmann
* 25.10.1904 | † 6.11.1979

»Von links oben: Schwiegersohn Egbert, Sohn Hans Albrecht, Tochter Ilselotte, Tochter Erika, Schwiegersohn Franz, Schwiegertochter Ilsemaria, auf dem Schoß von Christel und rechts stehend die Zwillinge Sabine und Susi, auf dem Schoß von Ilse Enkelin Mechthild, vier Monate alt, untere Reihe die Enkel Holger, Birgit und Thomas.« – Siehe den ausführlichen Kommentar zum Foto in der rechten Spalte unten.
Im April 2024 trat Herr Holger von Hugo, ein Urenkel Heinrich Schmidtmanns mit mir in Kontakt. Er schrieb:
»Meine Mutter (1914–2000) war die jüngste Tochter von Christian Schmidtmann, dem ältesten Sohn Heinrichs und sein späterer Partner in der Firma H. Schmidtmann & Sohn. Mein Großvater Christian (»Christel«) lebte von 1872 bis 1955, und ich (Jg. 1943) kann mich noch gut an ihn erinnern.«
Herrn von Hugos Korrekturen zu den Bildlegenden im Schmidtmann-Album habe ich dort eingearbeitet und mit dem Kürzel »H.v.H.« gekennzeichnet. Er schrieb weiter:
»Gerne will ich Ihnen erzählen, wie es mit den Nachkommen Christels weiterging. Christel und seine zehn Jahre jüngere Frau Ilse, geborene Wolff aus Potsdam, führten eine ausgesprochen glückliche und lange Ehe, aus der vier Kinder und acht Enkel hervorgingen:
1. Hans-Albrecht Schmidtmann (1904–1979), verheiratet mit Ilsemaria, geb. Lohse (1916–2006). 3 Kinder: Mechthild (geb. 1951); Almut (1952–1968); Heino (geb. 1955). Mechthild ist verheiratet, hat zwei Kinder und drei Enkel. Heino ist kinderlos und verheiratet. Er ist der letzte Schmidtmann unter den Nachkommen von Christel. Hans Albrecht hat Bauingenieurwesen studiert und die Firma H. Schmidtmann & Sohn erst zusammen mit seinem Vater und später alleine weitergeführt. Er musste die Firma, die in Kassel einen guten Namen hatte, nach über 100-jährigem Bestehen mangels Nachfolger liquidieren.
2. Gisela (1907–1945), verheiratet mit Fritz Köhler in Lebehn/Schlesien, wo sie kurz nach dem Krieg an Unterernährung und Typhus starb. Keine Kinder.
3. Erika (1911–2006), verheiratet mit Franz Brey (1912–2000). Sohn Thomas (1943–2018); Zwillinge Sabine und Susanne (geb. 1947). Die Familie ist nach Kriegsende nach Spanien ausgewandert, wo die Zwillinge mit ihren Familien noch heute leben.
4. Ilselotte (1914–2000), verheiratet mit Egbert von Hugo (1910–1992). Tochter Birgit (geb. 1940), verh., 3 Kinder, 6 Enkel; Sohn Holger (geb. 1943), verwitwet, keine Kinder.
Der unbestrittene Mittelpunkt der Familie war meine von allen geliebte Großmutter Ilse Schmidtmann, geb. Wolff, die Frau von Christel Schmidtmann. Sie war auch in den elf Jahren, in denen sie Witwe war, noch sehr aktiv. Mehrfach hat sie ihre Tochter in Spanien besucht, und noch kurz vor ihrem Tod hat sie ihre Kindheitserinnerungen aus Potsdam niedergeschrieben, wobei sie uns alle mit ihrem phänomenalen Gedächtnis überrascht hat.«
Zum Foto in der linken Spalte schreibt Herr von Hugo:
»Das Foto entstand im Sommer 1951, als die spanischen Verwandten zu Besuch waren, im Garten des Hauses Landgraf-Karl-Straße 27, das damals Schmidtmanns gehörte. Nach dem Krieg wohnten da alle, die auf dem Foto sind (mit Ausnahme des Besuchs aus Spanien), dazu anfangs noch zwei Tanten, vermutlich die Schwestern von Christel, in einer Wohnung.
In dieser Wohnung, von der Straße her gesehen im Obergeschoß links, befand sich ab ca. 1948 außerdem das provisorische Büro der Firma Schmidtmann, in dem auch die einzige Angestellte meistens übernachtete, weil ihr der Fußweg nach Elgershausen zu weit war. Für alle gab es eine Toilette und zwei Waschbecken in der Küche und im Bad. Die Badewanne diente Hans Albrecht als Bett.
Diese prekäre Situation änderte sich 1952: die Familien Schmidtmann Senior und Junior zogen in den Neubau Kohlenstraße 124, wo sich auch das Büro und der Lagerplatz der Firma befanden; meine Familie zog in die Karthäuserstraße 5 (→), in das Haus, das von Christian Schmidtmann entworfen, gebaut (ca. 1912) und bis zur Bombennacht im Oktober 1943 bewohnt worden war. Nach schweren Schäden war es 1952 wieder bewohnbar; es steht heute noch.
Bei meiner Schilderung der Wohnverhältnisse in der Landgraf-Karl-Straße sollte freilich nicht der Eindruck entstehen, dass alle von mir genannten Personen gleichzeitig dort gewohnt haben. Mein Vater zum Beispiel ist erst Ende 1947 aus Gefangenschaft zurückgekommen, Tante Ilsemaria kam deutlich später, möglicherweise erst 1950 dazu, meine beiden Großtanten sind vielleicht schon 1946 oder 47 verstorben (die eine war ja eine verheiratete Potente), und wann das Büro eingerichtet wurde, kann ich auch nicht sagen, vielleicht war das auch erst 1949 oder 1950.«
*MA Mulang-Archiv, Privatarchiv des Autors und Betreibers dieser Website, Friedrich Forssman – mit »MA•rl« bzw. »MA•dr« sind Objekte aus den früheren Beständen der Sammlerkollegen Rolf Lang und Dieter Rüsseler bezeichnet